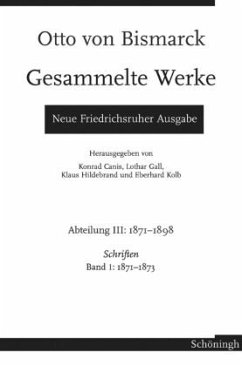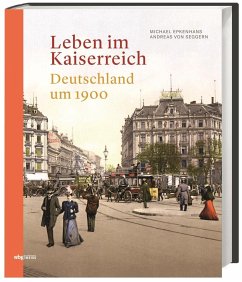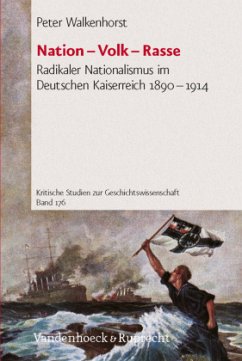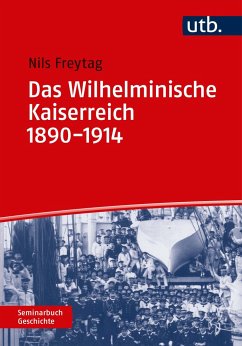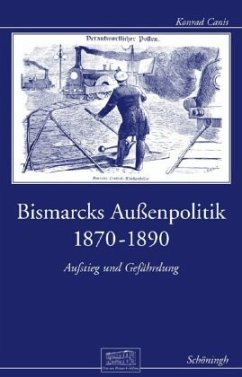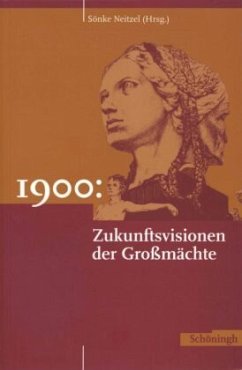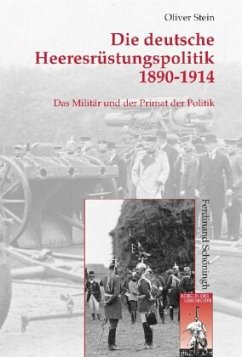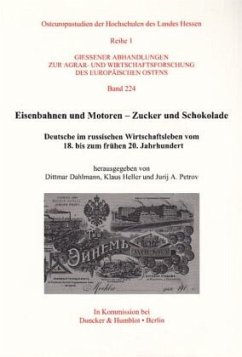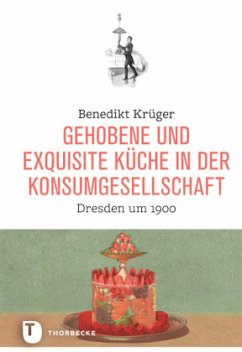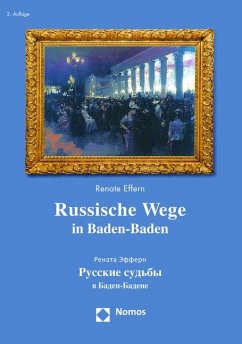den Zaren durch ein kompliziertes Vertragswerk, an dessen Ende der Rückversicherungsvertrag von 1887 stand, für sich zu gewinnen, um dem cauchemar des coalitions zu entrinnen. Immanente Voraussetzungen dafür waren Selbstbescheidung und gegenseitiges Vertrauen, die Zügelung nationaler Leidenschaften und die "Pflege" gutnachbarschaftlicher wirtschaftlicher Beziehungen.
Während ersteres mehr oder weniger durchgängig gegeben war - in der Theorie schloß Bismarck bekanntlich sogar nicht aus, Österreich-Ungarn zu opfern, um Rußland an der Seite des Reiches zu halten -, mangelte es an letzterem bereits in den späten 1880er Jahren. Durch wirtschaftliche "Keulenschläge" hatte der alternde Kanzler dem Zaren "seinen Vorteil" beizubringen versucht. Dabei hatte er unterschätzt, daß dieser, von inneren und ökonomischen Zwängen getrieben, seinen tiefsitzenden Antirepublikanismus vergessen und in Paris viel reichhaltigere Quellen finden konnte als in Berlin. Dennoch, und hier setzt die gut lesbare Studie an, war 1890 noch keineswegs entschieden, daß enge wirtschaftliche Beziehungen über kurz oder lang auch intensivere Kontakte auf politischem und militärischem Gebiet zwischen Rußland und Frankreich zur Folge haben würden. Den Weg dazu haben die "Wilhelminer" freilich selbst geebnet: Mit Bismarcks Entlassung im März 1890 riß der Draht nach Petersburg, und sosehr die Russen der Regierung in Berlin nachliefen, so wenig waren der neue Kanzler und der junge Kaiser bereit, die bisherige Außenpolitik fortzusetzen. Sie erschien ihnen zu kompliziert und zu widersprüchlich. Caprivi war zudem überzeugt, einen Zweifrontenkrieg nicht vermeiden zu können, und setzte daher militärisch-nüchtern auf eine starke Armee anstatt auf Verträge, die ihm das Papier nicht wert schienen, auf denen sie geschrieben waren. Hinzu kamen antirussische Ressentiments im Auswärtigen Amt, im Generalstab und in der Öffentlichkeit; bereits in der Doppelkrise hatten diese Kreise vehement einen Präventivkrieg nach Osten und - in der Verlängerung - eine Anlehnung an England gefordert. Bismarck hatte das eine zu verhindern gewußt, das andere zu sondieren versucht, um sich alle Optionen offenzuhalten.
Wilhelm II., Caprivi und, allen voran, die "Graue Eminenz der deutschen Außenpolitik, Holstein, sahen dies ganz anders: die "Globalisierung" europäischer Politik bot ihrer Meinung nach die Chance, zum größtmöglichen eigenen Nutzen zwischen den Flügelmächten operieren zu können, ohne sich vorzeitig selber Fesseln anlegen oder Rußlands Vormachtstellung anerkennen zu müssen. Die Beziehungen nach Petersburg "verfielen" daher - angefangen von den persönlichen Kontakten zwischen den Monarchen über tiefgreifende wirtschaftliche Differenzen und gegenseitige Vorwürfe hinsichtlich der Behandlung von Minderheiten bis hin zu außenpolitischen Konflikten in Europa und Asien.
Die Konsequenzen dieses "Verfalls" waren für das Deutsche Reich langfristig fatal. Seit 1891 näherten sich Rußland und Frankreich politisch und militärisch einander an und, wenn auch eher zögerlich, stimmte Alexander III. 1893 einer schriftlichen Fixierung der bisherigen Gespräche zu. Aus russischer Perspektive war dieser Schritt nur konsequent, und zu diesem Zeitpunkt bedeutete er auch nicht, daß damit der "Ring" geschmiedet war, der das Reich 1914 zu einer höchstgefährlichen Politik verleiten sollte. Im Gefühl der eigenen Stärke tat die Reichsleitung allerdings auch nichts, das Vertrauen des Zarenreiches wiederzugewinnen. Warnungen verhallten ungehört. Verantwortlich dafür war zunächst zweifellos der junge, impulsive Kaiser. Bereits 1891 hatte ein Berater des Zaren, Graf Lamsdorff, notiert: "Wilhelm II. verdient unsererseits ein schönes Denkmal, da er sich bemüht, die Position Deutschlands zu erschüttern, und auf diese Weise mittelbar unseren Interessen dient." Dies war allerdings nur die "halbe Wahrheit"; kaum weniger entscheidend war der weitverbreitete Wille, gleichberechtigte Weltmacht zu werden.
MICHAEL EPKENHANS
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 08.07.2003
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 08.07.2003