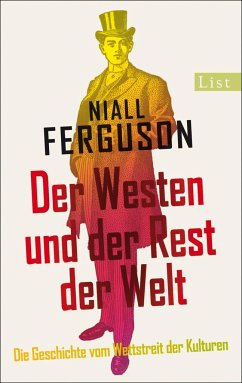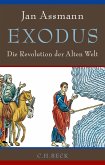Alle reden vom Niedergang des Westens. Was aber hat seinen Aufstieg ermöglicht? Niall Ferguson beschreibt sechs »Killerapplikationen«, die dem Westen gegenüber dem Rest der Welt Überlegenheit verschafft haben: Wettbewerb, Wissenschaft, Eigentum, Medizin, Konsum und Arbeitsmoral. Und er geht der Frage nach, ob wir gerade das Ende dieses Vorsprungs erleben, weil andere Weltregionen inzwischen genau auf diesen Gebieten besser sind als der Westen.
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Schneller als beim Risiko-Spielen ändert sich die Stärke von Imperien nur bei Niall Ferguson. Waren die USA in seinem vorigen Buch noch eine schier unaufhaltsame strahlende Weltmacht, sind sie nun eine matte rezessionsgeplagte Ex-Großmacht, und der aufsteigende Stern ist natürlich China. Immerhin bilden Imperien auch weiterhin die zentrale Maßeinheit in Fergusons politischem Denken, und so galoppiert auch Rezensent Herfried Münkler mit uns einmal durch die Weltgeschichte, um Aufstieg und Fall der Römischen, Osmanischen und Chinesischen Reiche abzuhandeln, die dann doch im 15. Jahrhundert wider Erwarten von Europa in den Schatten gestellt wurden. Ferguson führt eine Reihe von Gründen für die Hegemonie des Westens an - Wettbewerb, Wissenschaft, Medizin, Eigentum und Konsum -, die eben auch China für die imperiale Aufholjagd bräuchte. Dem Rezensenten erscheint allerdings fraglich, ob Weltgeschichte nach dem Modell der Apps funktioniert, die man sich nach Belieben runterlädt.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Wird China ohne demokratische Partizipation der Bevölkerung auf Dauer politisch stabil bleiben? Der britische Historiker Niall Ferguson lässt die Antwort offen.
Ist Chinas Aufstieg zur global dominanten Macht unaufhaltsam? Niall Ferguson, der bis vor kurzem die Vereinigten Staaten noch dazu bringen wollte, sich selbst als imperiale Macht zu akzeptieren und dementsprechend zu handeln, neigt dazu, die Frage zu bejahen, zumal die große Wirtschaftskrise von 2007 der chinesischen Ökonomie wenig anhaben konnte, während sie die Vereinigten Staaten und Europa schwer getroffen hat. Nachdem die Chinesen im Gefolge der Krise weiter aufgeholt haben - wer oder was sollte sie da eigentlich noch stoppen? Ein äußerer Akteur mit Sicherheit nicht, auch nicht ein im Niedergang befindliches Imperium wie das der Vereinigten Staaten. China kann nur noch an sich selbst scheitern - und da sieht Ferguson freilich eine Reihe von Stolpersteinen, von denen jeder für sich allein genügt, um das Reich der Mitte aus dem Tritt zu bringen.
Da sind zunächst die vielen Millionen Wanderarbeiter, die im immer reicher werdenden China eine Existenz führen, die schlechter ist als die der Paupers im frühkapitalistischen Europa. Dass die Einkommensunterschiede laut OECD im offiziell kommunistischen China weltweit die höchsten sind, zeigt Chinas Verwundbarkeit. China hat ein soziales Problem, das sich bei Fortsetzung des eingeschlagenen Weges nicht von selbst lösen wird. Wer nur auf die ökonomischen Zuwachsraten sieht, kann dieses soziale Problem leicht übersehen. Und ebenso wird er die ökologischen Probleme übersehen, die sich mit der forcierten Industrialisierung Chinas während der letzten drei Jahrzehnte aufgebaut haben.
Schließlich kommen noch die Folgen der Ein-Kind-Politik hinzu: Nicht bloß der Umstand, dass sich die demographische Pyramide in etwas mehr als einem Jahrzehnt umkehren und China japanische Probleme bekommen wird, sondern auch der gewaltige Überhang von Männern gegenüber Frauen, auch eine Folge der Ein-Kind-Politik, wird für soziale Probleme sorgen.
Es gibt gute Gründe für die Annahme, dass der Aufstieg Chinas bei weitem nicht so glatt und reibungslos verlaufen wird, wie er sich in den Kurven der Statistiker darstellt. Ob starke sozio-ökonomische Erschütterungen Chinas jedoch der westlichen Vormachtstellung zugutekämen oder den Westen mit in den Abgrund reißen würden, bleibt in Fergusons Analyse offen. Ferguson selbst hat vor einigen Jahren das Wort "Chimerika" mitgeprägt, in dem die enge Verflechtung der amerikanischen und der chinesischen Volkswirtschaft zum Ausdruck gebracht wird.
Auch wenn er inzwischen davon ausgeht, dass sich diese Verbindung wieder auflöst, so sind beide doch nach wie vor derart aufeinander angewiesen, dass der Kollaps Chinas auch die Vereinigten Staaten schwer treffen müsste. Um ihres eigenen Wohlergehens willen muss man in Washington also ein Interesse daran haben, dass sich der weitere Aufstieg Chinas einigermaßen reibungslos vollzieht.
Als Vorbild eines solchen Übergangs in der Dominanzposition der Weltwirtschaft und Weltpolitik hat Ferguson offenbar die Ablösung des britischen Weltreichs durch die Vereinigten Staaten vor Augen, bei der es weder zum großen Krieg noch zum Zusammenbruch des Wirtschaftslebens kam, wenn man denn die Weltwirtschaftskrise von 1929 dem ungeschickten Agieren der Regierungen und nicht der Übergabe des finanzpolitischen Staffelholzes von London nach New York zuschreibt. Dem stellt Ferguson den katastrophalen Zusammenbruch einiger anderer Imperien gegenüber, wobei Imperien in seiner Darstellung das institutionelle Zentrum einer Zivilisation darstellen.
Mehr noch als das Ende der Sowjetunion hat er dabei den Untergang des Römischen Reichs im Westen vor Augen, der vom Verschwinden einer städtischen Kultur und einer auf großräumigem Austausch beruhenden Wirtschaft begleitet war. Edward Gibbons Beschreibung dieses Untergangs, für deutsche Leser eher ein historischer Text, ist für Briten seit ihrem Erscheinen zwischen 1776 und 1788 - immerhin verfasste Edward Gibbon sechs opulente Bände - eine Mahnung an die Vergänglichkeit mächtiger Reiche. Die Position der Vereinigten Staaten in der Bush- und Obama-Ära gibt Ferguson Anlass, Gibbons Niedergangsanalysen mit einer Reihe von Entwicklungen zu verbinden, die er als Dekadenzindikatoren ansieht: Der Rückzug vom Hindukusch und/oder aus Mesopotamien sei seit jeher ein Anzeichen für den Niedergang eines Großreichs: Die Römer, die Briten und schließlich die Sowjets seien Amerika dabei vorangegangen. Nachdem Ferguson noch vor einem Jahrzehnt die Position der Vereinigten Staaten sehr positiv dargestellt hat, regiert nun bei ihm der Pessimismus. Für das amerikanische Imperium sieht er schwarz. Aber wie steht es dann mit der westlichen Zivilisation als Ganzem?
Fünf Jahrhunderte, so Ferguson, hatte der Westen, zunächst Europa allein, später im Verbund mit Amerika, gegenüber Ostasien die Nase vorn gehabt. Entgegen anderen globalgeschichtlichen Arbeiten, die erst für das neunzehnte Jahrhundert von einer deutlichen Überlegenheit des Westens ausgehen, sieht Ferguson deren Anfänge im fünfzehnten Jahrhundert und stellt dazu die Seefahrten des chinesischen Admirals Zheng He und die des Portugiesen Vasco da Gama einander gegenüber, bei denen die Chinesen zwar die überlegenen Ressourcen ins Spiel brachten, aber die Portugiesen den größeren Mut und das größere Geschick bewiesen.
Wie also kam es zu diesem ganz unwahrscheinlichen Aufstieg (West-)Europas, in dessen Verlauf der Westen nicht nur zum wirtschaftlich führenden Raum, sondern auch zum politisch-militärischen Herrn der Welt wurde? Ein Beobachter des fünfzehnten Jahrhunderts hätte kaum auf Europa gesetzt, und wenn er an der weiteren Ausdehnung der chinesischen Macht gezweifelt hätte, dann hätte er vermutlich dem Osmanischen Reich eine solche Rolle zugetraut.
Immerhin hatten die Türken auf europäischem Boden Fuß gefasst und stießen nun kontinuierlich weiter vor, bis sie schließlich vor Wien standen. Aber schon im achtzehnten Jahrhundert fragten sich viele im Osmanenreich, wie es dazu kommen konnte, dass die zunächst so rückständigen und unterlegenen Europäer immer mächtiger geworden waren und inzwischen das Heft des Handelns in die Hand bekommen hatten.
Das ist auch Fergusons Frage, der er über weite Strecken seines Buches nachgeht. Für ihn gibt es jedoch nicht einen einzigen Grund für diesen Aufstieg, sondern ein ganzes Bündel von Ursachen: Da ist der Wettbewerb mehrerer Staaten, der die europäische Geschichte bestimmt und die Ausbildung von Selbstzufriedenheit blockiert hat; sodann eine dynamische Entwicklung der Wissenschaft, die eine sonst nirgendwo erreichte praktische Wirksamkeit erlangte; da ist weiterhin die Rechtsfigur des Eigentums, die Mühe und Anstrengung für den Einzelnen attraktiv werden ließ, und das obendrein in Verbindung mit einer Regierungsform, bei der die Eigentümer mehr und mehr Einfluss auf die Gestaltung der politischen Ordnung gewannen.
Eine besonders wichtige Rolle, so Ferguson, spielte die Medizin, die es den Europäern erlaubte, in Gebieten zu überleben, in denen andere zuvor von Krankheiten dezimiert und wieder herausgedrängt worden waren. Bei allen Greueltaten des Kolonialismus rubriziert Ferguson den medizinischen Fortschritt, den der Westen auch den Afrikanern gebracht habe, als eine Legitimation seiner Herrschaft, wie sie keine andere Macht für sich in Anspruch nehmen könne. Eine wichtige Rolle kam schließlich dem Konsum zu, insbesondere der Bekleidung, denn darüber ist die Massenkaufkraft entwickelt worden. Und schließlich ist da noch die Arbeitsethik, die innerhalb des Westens bestimmte Regionen zu herausgehobenen Zentren der Wertschöpfung werden ließ.
Ferguson nun hat dieses Ursachenbündel nicht als multikausalen Komplex für den Aufstieg des Westens definiert, sondern es nach dem Modell von Applikationen beschrieben, die man einzeln auf sein iPhone herunterladen kann. Das Aufholen der anderen gegenüber dem Westen ist danach als ein Herunterladen von Apps zu verstehen, bei dem einige auf mehr und andere auf weniger Apps Zugriff genommen haben.
Was Ferguson jedoch offenlässt, ist die Frage, ob zum Einholen des Westens alle Apps heruntergeladen werden müssen oder ob einige dafür genügen. Konkret: Wird China auch ohne demokratische Partizipation der Bevölkerung auf Dauer politisch stabil bleiben? Das aber ist die letztlich entscheidende Frage, zu deren Bearbeitung Ferguson den Weg geebnet, aber keine Antwort gegeben hat. So handelt es sich um eine spannende, vor allem technik- und wissensgeschichtlich angelegte Globalgeschichte der letzten Jahrhunderte.
Fergusons Sherpas, die für ihn lesen und sortieren (die letzten Bücher entstanden im Zusammenhang mit Dokumentationssendungen fürs Fernsehen), haben viel zusammengetragen, und Ferguson hat das Material geschickt aufbereitet. Das Buch liest sich gut, und bisweilen ist es sogar spannend. Aber die selbstgestellte Frage, um deren Beantwortung willen Ferguson den Gang durch die Geschichte unternommen hat, bleibt am Schluss offen oder wird vieldeutig beantwortet. So kann Ferguson, wie auch immer es kommt, sagen, er habe es vorausgesagt.
HERFRIED MÜNKLER.
Niall Ferguson: "Der Westen und der Rest der Welt". Die Geschichte vom Wettstreit der Kulturen.
Aus dem Englischen von Michael Bayer und Stephan Gebauer. Propyläen Verlag, Berlin 2011. 559 S., geb., 24,99 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

und schießen
Wie kam es, dass Europa einst die Welt beherrschte?
Es gibt bessere Antworten als die von Niall Ferguson
Die Geschichte erfreut sich beim lesenden und fernsehschauenden Publikum großer Beliebtheit. Ein Historiker, der sich klug anstellt, kann viel Geld verdienen. Wer ein Massenpublikum erreichen will, macht sich die Arbeit allerdings sehr viel einfacher, wenn er nicht nach den Standards seines Faches vorgeht, sondern seine Arbeiten nach dem Geschmack des Zeitgeistes konzipiert. Der ist freilich schnelllebig. Was gestern interessant war, ist heute schon langweilig geworden. Der clevere Historiker wird sich also alle paar Jahre selbst überholen.
Wie macht man das, wenn man zur Quellenforschung keine große Lust mehr hat? Man kramt alte Begriffe und Konzepte wieder aus. Die werden dann poliert und präsentiert wie neu.
Nachdem Niall Ferguson mit einer Arbeit über Hamburg in den Jahrzehnten vor der Großen Inflation glanzvoll promoviert hatte, blühte ihm das Schicksal, sein Leben an einer britischen Eliteuniversität zu fristen, anerkannt und mit mäßigem Einkommen. Das wollte er nicht. Sein Glück war, dass viele britische Verleger Bücher schätzen, die „outrageous“ sind, also: Bücher, in denen schrille Thesen intelligent vertreten werden. 1998 argumentierte Ferguson in Buchlänge, dass eigentlich Großbritannien für den Ausbruch des Ersten Weltkriegs die Verantwortung trage. Das war, was man bei Musikstars den Durchbruch nennt.
Ferguson machte in den USA Karriere. Derzeit hat er eine Professur in Harvard inne und dazu eine an der London School of Economics. Wie oft seine Studenten auf beiden Seiten des Atlantiks ihn zu sehen bekommen, sei dahingestellt. Auf jeden Fall ist er fleißig und politisch am Ball. Den Irak-Krieg der Bush-Regierung unterstützte er. Nachdem er den „Untergang des britischen Weltreiches“ noch mal ganz „neu“ dargestellt hatte (2003), wandte er sich dem „Amerikanischen Imperium“ zu (2004), sodann den Beziehungen zwischen den USA und China, die er mit dem Neologismus „Chimerica“ beschrieb, womit gesagt sein sollte, dass die USA und China das Weltgeschehen bestimmen: China kauft die Anleihen der Vereinigten Staaten und erlaubt ihnen somit die unbegrenzte Schuldenaufnahme; im Gegenzug kann China sich erlauben, die Welt mit seinen Waren zu überfluten. Als Ferguson merkte, dass dieses Arrangement auf die Dauer nicht halten kann, als die Finanzkrise ausbrach, kam er auf alte Theorien zurück.
Sein neues Buch behandelt den Begriff der westlichen Zivilisation. Auch damit liegt er ganz im Trend. Anders als der intellektuelle Scharfmacher Samuel Huntington redet er nicht von einem „Kampf der Kulturen“: Ferguson belegt, dass auch in jüngster Zeit die meisten Kriege nicht zwischen „Kulturen“ ausgefochten wurden, sondern dass Angehörige derselben Kultur einander an die Gurgel gingen. Gleichwohl setzt auch Ferguson auf Konflikte. Die islamische Kultur hält er für zurückgeblieben und nachgerade verachtenswert. Mit dieser Ansicht kommt er bei vielen Amerikanern gut an.
Klüger als Huntington, legt er sein Augenmerk auf wirtschaftliche Konkurrenzkämpfe. Seine Thesen haben vieles mit der Weltsicht europäischer Imperialisten von 1900 gemeinsam. Die „westliche“ Zivilisation, die er beschreibt, sieht er von äußeren Mächten bedrängt. Selbstredend steht bei ihm die westliche Zivilisation nur für Gutes, die äußeren Mächte hingegen (China!) haben heute eigentlich nur insoweit „Zivilisation“, als sie sich die vom Westen abschauen.
Ferguson fragt: Warum hat der „Westen“ in der Welt nach 1500 die Oberhand gewonnen? Zum Westen zählt er West- und Mitteleuropa sowie die USA. Seine Antwort: Die westliche Zivilisation. Die beschreibt er so, wie gebildete Leute, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts bei einem Glas Rotwein über die Vorzüge des Abendlandes und seinen drohenden Untergang redeten, es auch schon hätten tun können: die überlegene Wissenschaft; die Rechtssicherheit (der Soziologe Max Weber nannte das: den neuzeitlichen Typ bürokratischer Herrschaft); die überlegenen medizinischen Kenntnisse des Westens; Marktwirtschaft und Wettbewerb (beides gemeinsam kann man auch „Kapitalismus“ nennen); und schließlich: die christliche Arbeitsethik.
Vor einigen Jahren wurde in den Kreisen, in denen Niall Ferguson verkehrt, anders geredet: Anlässlich des Afghanistan-Krieges und dann, als die USA 2003 in Irak einmarschierten, hieß es noch, die Demokratie sei allen diktatorialen Systemen überlegen. Ein näherer Blick auf Länder wie China und Singapur hat die Ideologen an den US-Universitäten eines Besseren belehrt. Ferguson musste sich etwas Neues ausdenken. Was ihm einfiel, ist eine Kompilation von lauter Gedanken, die andere vor ihm besser formuliert haben. Was ihm einfiel: Es gehe um die westliche „Zivilisation“.
Schauen wir uns Fergusons Argumentation näher an. Nolens volens erkennt er an: Die Wissenschaft war in China bis in die Frühe Neuzeit hinein viel innovativer als in Europa. Die Ming-Dynastie mit ihrer Politik der Selbstgenügsamkeit warf das Land dann zurück. Der Historiker David Landes hat das 1998 damit erklärt, dass es in China keinen Markt gab: „In Europa hatte das Unternehmertum freie Hand. Innovation kam zum Zuge.“ Heißt das, Ferguson habe recht, wenn er behauptet, China sei in der Stagnation versunken? Nein, schon im 18. Jahrhundert taten chinesische Händler das Ihre dazu, so etwas wie den Weltmarkt mitaufzubauen. Der wirkliche Niedergang Chinas setzte im 19. Jahrhundert ein, als die Briten dort mit Militärgewalt ihre Vorstellung von Handel durchsetzten, als sie China, wie zuvor Indien, zu einem Land degradierten, das britische Waren importieren musste.
Wie sehr die Waffengewalt des Westens die Welt beeinflusst hat, will Ferguson nicht wahrhaben. Das liegt auch daran, dass er den Moment, als der Westen die Führung der Welt übernahm, auf das Jahr 1500 festsetzt. Das ist ein Hirngespinst. Damals begannen einzelne Abenteurer die Welt zu erkunden. Die Spanier taten es mit Feuerwaffen, deshalb waren sie in Lateinamerika erfolgreich. Den Engländern und Schotten, die um 1600 an der amerikanischen Ostküste anlandeten, nützten ihre Waffen gar nichts; ohne Hilfe der Indianer wären sie alsbald verhungert. Und die Entdeckungsreisenden jener Tage waren heilfroh, wenn sie es wieder nach Hause schafften und erzählen konnten, dass es auf fremden Erdteilen Kannibalen gebe, die sich blau anmalten und in der Kiepe zum Essen ein Menschenbein mitbrächten.
Nur in der Rückschau erscheint Europas Erfolgsgeschichte um 1500 zu beginnen. Tatsächlich war damals noch alles offen. Erst als die Industrialisierung einsetzte, begannen europäische Länder, die Hegemonie über die Welt zu übernehmen, also etwa um 1800. Spanien war diesbezüglich damals längst nicht mehr satisfaktionsfähig. Es blieben die Niederlande und das Britische Empire. Schon im 18. Jahrhundert konnten die Niederlande zur See mit Großbritannien nicht mehr mithalten. Und mit dem Londoner Kapitalmarkt konnte Amsterdam nicht konkurrieren. Die schnelle britische Industrialisierung tat ein Übriges.
Die Frage, die sich stellt: Wie kam es zur Industrialisierung in Europa und nicht anderswo? Diese Frage hat vor Ferguson schon viele Autoren umgetrieben. Zwei Herangehensweisen gibt es: Warum war Europa „besser“? Oder: Warum haben andere Länder „versagt“? Was Ferguson über andere Länder schreibt, ist auf Stammtischniveau, wenngleich sein Recherche-Team ihn mit vielen gelehrten Fußnoten versehen hat. Also: Warum haben Europa und dann die USA rund zweihundert Jahre lang über den „Rest der Welt“, wie Ferguson es nennt, triumphiert?
Dazu hat der Autor nichts Neues zu sagen. Er greift ausführlich auf Max Webers Idee von der protestantischen Arbeitsethik zurück. Webers Idee ist von der Forschung zwar widerlegt worden. Aber Ferguson schreibt mit Hinblick auf den amerikanischen Markt. In den USA ist der Protestantismus, aufgesplittert in viele Kirchen, dominierend. Ferguson insinuiert, dass der Protestantismus doch eine ganz besondere Arbeitsethik mit sich bringe. Warum scheint Europa heutzutage auf dem absteigenden Ast zu sein? „Die Europäer arbeiten nicht nur weniger, sie beten auch weniger“ als die Amerikaner. Warum ist China wirtschaftlich erfolgreich? „Zählt man die 20 Millionen Katholiken hinzu, könnte es in China bis zu 130 Millionen Christen geben.“ Das entspräche, was Ferguson nicht schreibt, einem Bevölkerungsanteil von gerade einmal fünfzehn Prozent. Er selbst nimmt sein Gerede von der Bedeutung der Religion für wirtschaftliches Prosperieren an anderer Stelle zurück.
Die vernünftigen Argumente, die Ferguson vorträgt, finden sich schon in David Landes’ Buch „Wohlstand und Armut der Nationen“. Landes schreibt: Die christlich-jüdische Kultur habe körperliche Arbeit immer geachtet; sie habe nicht mit der Natur leben, sondern die Natur unterwerfen wollen; außerdem habe sie einen linearen, progressiven Zeitbegriff, der – im Gegensatz zum zyklischen Zeitbegriff anderer Kulturen – den Glauben an steten Fortschritt möglich machte; entscheidend sei gewesen: im christlich-jüdischen Kulturraum hätten freie Märkte sich entfalten können.
Fergusons Buch wirkt, als ob er David Landes’ gute Argumentation umgeschraubt und für seinen Text und die dazugehörige TV-Serie passend gemacht habe. Das Ganze liest sich wie eine gelehrte Drehbuchvorlage. Da gibt es viele einzelne Episoden, die hochinteressant sind. Aber wenn Ferguson eine These vorträgt, die begründet werden müsste, weicht er oftmals sofort auf ein Einzelschicksal aus. Das Buch ist durchaus lesenswert. Vieles wird erzählt. Erklärt wird allerdings nichts. Das Buch ist enttäuschend wie eine Kinder-Wundertüte: Die sieht toll aus, aber es ist nichts drin, was hält.
FRANZISKA AUGSTEIN
NIALL FERGUSON: Der Westen und der Rest der Welt. Die Geschichte vom Wettstreit der Kulturen. Aus dem Englischen von Michael Bayer und Stephan Gebauer. Propyläen Verlag, Berlin 2011. 559 Seiten, 24, 99 Euro.
Der hochehrgeizige Historiker
muss zusehen, dass er immer
mit dem Zeitgeist geht.
Wie sehr die Waffengewalt des
Westens die Weltgeschichte
beeinflusste, sieht Ferguson nicht.
Wozu eine komplizierte Sache
erklären, wenn man auf
Einzelschicksale ausweichen kann?
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de