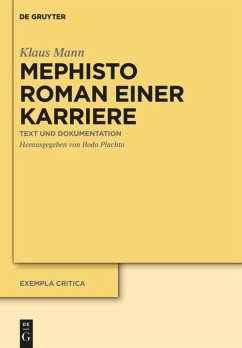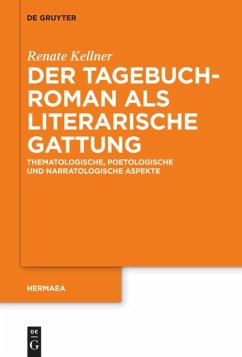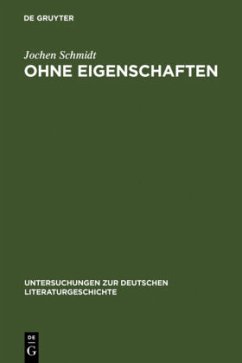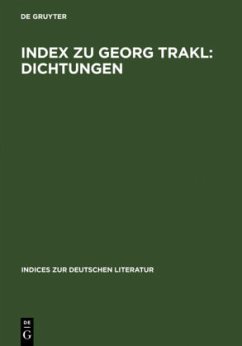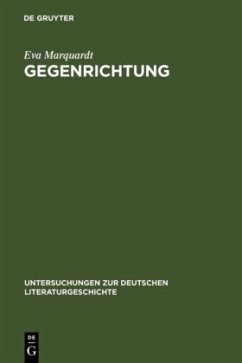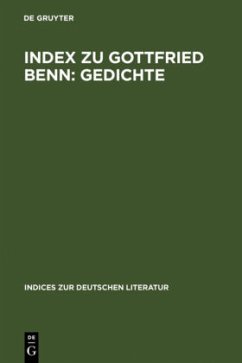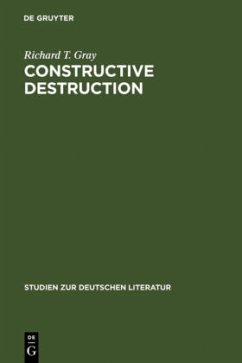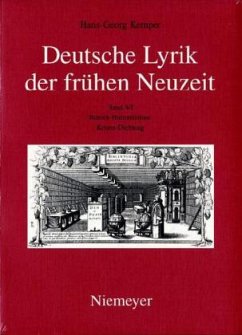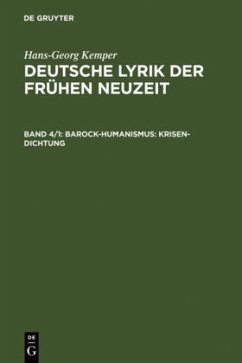respektloses Untermietsverhältnis. Wenn einer eingenisteten Binsenweisheit das Wort oder noch besser der Sinn herumgedreht wird, zeigt das aphoristische Spiel seinen diabolischen Kern. Aphorismen sind nichts für tapfere Helden, denn hier stiehlt die Sprache ihnen nicht nur die Schau, sondern auch die Selbstgewißheit. Mephisto ist Aphoristiker, Faust nicht.
Ein Ding schierer Unmöglichkeit scheint es, der vielfältigen Welt des Aphorismus mit wissenschaftlicher Systematik zu Leibe zu rücken. "Die Seele jeder Ordnung ist ein großer Papierkorb", warnte Kurt Tucholsky in einem jener "Schnipsel", die das Genre des Aphorismus in zeitgemäßes Understatement kleideten. Auch aus Schnipseln läßt sich ein Lebenswerk auftürmen. Karl Kraus und Elias Canetti sind mit ihrer Aphorismen-Produktion herausragende Beispiele dafür, auch Wittgensteins "Tractatus" oder Adornos "Minima Moralia" verdanken ihre konzise Ausdruckskraft der aphoristischen Form. Dieweil die Moderne den großen Erzählungen mißtraut, schätzt sie den lapidaren Aphorismus.
Friedemann Spicker benötigt für seine Geschichte des deutschen Aphorismus im zwanzigsten Jahrhundert genau eintausend engbedruckte Seiten. Das ist, von einem ausgewiesenen Kenner vorgelegt, eine Menge an fußnotenschwerer Gelehrsamkeit, die den wohlfeilen Einwand gegen das Unternehmen schon vorprogrammiert. Der Autor selbst räumt ein, seine Arbeit müsse das "Unverhältnis zwischen ihrer Form und der ihres Gegenstandes" als Hypothek auf sich nehmen.
Wo der einzelne Aphorismus zündende Funken schlägt und die Sprüchesammlung immerhin noch ein Schmunzeln weckt, bleibt dem Literaturhistoriker nur, die Trockenfrüchte zu sezieren. In ihrer altmodischen Vorliebe für halbvergessene "minor poets" und Nebenwege der Literaturgeschichte trifft sich Spickers pointillistisch gesättigte Studie durchaus mit der Detailversessenheit aphoristischer Sprachbehandlung, die bei den Besten des Faches im dreifachen Sinne "pünktlich" verfährt: akkurat, treffsicher, zeitgenau.
Vor sieben Jahren hatte Spicker bereits eine inzwischen zum Standardwerk avancierte Geschichte zu "Begriff und Gattung" des Aphorismus vom achtzehnten Jahrhundert bis 1912 vorgelegt. Methodische Probleme der Gattungsdefinition und ihrer Geschichtsschreibung nehmen im Nachfolgewerk keinen großen Raum ein. Dabei hätte die Frage, ob ein derart okkasionell und idiosynkratisch ausgeformtes Genre überhaupt im historischen Zusammenhang darstellbar ist, gerade für die in Gegenwartsnähe zunehmend ausfransenden Traditionsfäden durchaus ein übergreifendes Reflexionskriterium abgeben können.
Die Begriffe Spiel, Bild und Erkenntnis taugen als leitende Kategorien nur bedingt. Wenig verraten sie über die Überlappungszonen zu benachbarten Textformen wie Spruchweisheit, Maxime, Glosse, Epigramm, Bonmot oder Witz. Implizit sind solche Abgrenzungsfragen in Spickers Textmaterial allgegenwärtig, versucht sich doch ein umfangreicher Teil der Aphoristik an möglichst pointenreichen Bestimmungen dessen, was einen Aphorismus ausmacht. Auf der Habenseite beeindrucken die Fülle der ausgewerteten Quellen, die solide Verdichtung einer weitverzweigten Forschungsliteratur und vor allem die mit ausgiebigen Kostproben angereicherten Kommentare, die sich weder im Ästhetischen noch im Politischen vor deutlichen Wertungen scheuen.
Bei aller Heterogenität des Materials und der Autoren läßt Spickers Darstellung bestimmte Grundzüge und Entwicklungstendenzen klar hervortreten. Gegenüber der klassischen französischen Moralistik hat der moderne deutsche Aphorismus eine schwindende "ethische Dimension". Gelegentlich gewann der Tonfall erbaulicher Lebensweisheiten kurzzeitig die Oberhand, etwa im Kontext der Inneren Emigration und der restaurativen Nachkriegsjahre, dann wieder dominierte das sich von Nietzsche herleitende Programm einer Sprachkritik als Ideologiekritik, unübertrefflich im Aphorismenwerk des Karl Kraus. Am übermächtigen Steinbruch dieses Jahrhundertautors mühten ganze Generationen sich ab; "nur kein Karl Kraus werden", schwor sich Peter Handke.
Der erfolgreiche Aphorismus genießt keinen Urheberschutz. Wie ein solitärer Diamant, der nur locker dem samtenen Futteral aufsitzt, wird er gerne, das heißt: rasch und bedenkenlos, gestohlen. In Friedemann Spickers Literaturgeschichte des Aphorismus wimmelt es nur so von funkelnd zugeschliffenen Sätzen, die einem bekannt vorkommen. In diesem würdigen Kompendium versammelt, versprechen sie reichen Finderlohn.
ALEXANDER HONOLD
Friedemann Spicker: "Der deutsche Aphorismus im 20. Jahrhundert". Spiel, Bild, Erkenntnis. Niemeyer Verlag, Tübingen 2004. 1000 S., geb., 154,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
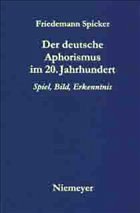






 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 04.08.2005
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 04.08.2005