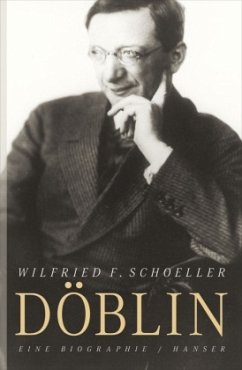Wilfried F. Schoeller legt die erste umfassende Biographie über Alfred Döblin vor, den großen "Unbekannten" der Literaturgeschichte Deutschlands, der sich nie aus Thomas Manns Schatten befreien konnte. Das Werk zeigt einen Menschen, der als Arzt und Künstler, als Jude und Katholik, als Patriot und Sozialist in die Tragödien des 20. Jahrhunderts hineingezogen wurde. Schoeller führt die vielen, oft widersprüchlichen Facetten dieses Lebens vor. Und er macht deutlich, was es in Döblins gigantischem erzählerischen Kosmos noch zu entdecken gibt.

Nicht zu fassen, dass wir darauf Jahrzehnte warten mussten: Wilfried F. Schoellers Biographie Alfred Döblins schließt eine klaffende Lücke.
Von Wolfgang Schneider
Nicht nur wegen "Berlin Alexanderplatz" gehört Alfred Döblin zu den fünf bedeutendsten deutschsprachigen Prosaautoren des zwanzigsten Jahrhunderts. Kaum zu glauben deshalb, dass es bis vor wenigen Tagen keine angemessene Biographie gab. Kein Universitätsgermanist fühlte sich für die klaffende Lücke zuständig. Jetzt hat sich der Kulturjournalist Wilfried F. Schoeller der aufwendigen Vermittlungsarbeit angenommen - mit dem schönen Nebeneffekt, dass die neunhundert Seiten dieser überfälligsten aller Schriftstellerbiographien sehr lesbar geworden sind.
Der Erzrivale, Antipode und heimliche Maßstab Döblins war der drei Jahre ältere Thomas Mann. Bei dem findet man, was man bei Döblin nicht findet: die Klassikeranmutung zu Lebzeiten, die stimmige Architektur eines Gesamtwerks, das noch heute ein geistiges Zuhause sein kann, weltanschaulich hochwertig möbliert, dazu als Kontrast die Verliese des Autobiographischen, die Tagebücher. Döblin hat für solche kulinarische Rezeption zu viele Turbulenzen produziert. Er lebte in improvisierten geistigen Gehäusen, oft windschief und instabil. Er liebte es, sich selbst den Boden wegzuziehen - ein "Verwerfungsclown", der seine Auffassungen ständig revidierte. Döblin sei der "wandlungsfähigste Schriftsteller unserer Zeit", rühmte Jorge Luis Borges. Für eine Biographie ist dieses rastlose Leben mit seinen Wendungen und Schicksalsschlägen eine grandiose Vorlage.
1878 wurde er in Stettin geboren; der Vater betrieb ein Schneideratelier. Zu Hause merkte man vom Judentum nicht viel. "Draußen begegnete mir der Antisemitismus wie selbstverständlich." Die gründliche Erschütterung der patriarchalischen Ordnung war das überschattende Erlebnis seiner Kindheit: Der Vater ließ die Mutter und die fünf Kinder im Stich und wanderte mit einer Geliebten nach Amerika aus. Armut und Sorge beherrschten Döblins Kindheit und Jugend, die ab 1888 in Berlin stattfand.
Seine Doktorarbeit schrieb er über Gedächtnisstörungen bei der Korsakoffschen Psychose: Trunksuchtbedingte Ausfälle werden mit Erinnerungen und Phantasiertem überblendet. Solche "Konfabulationen" kennzeichnen auch die Figuren seiner frühen Erzählungen, die grotesken Gaukeleien der Einbildungskraft unterliegen und Obsessionen, Tics und Surrealismen produzieren. 1905 begann Döblin als Assistenzarzt in psychiatrischen Kliniken zu arbeiten; der Menschendarsteller schulte sich in der Arbeit mit den Kranken, erlernte anhand der physiognomischen Auffälligkeiten sein Repertoire des gestischen Erzählens. So wurde er zum Mitbegründer des Expressionismus in Deutschland - über den er bald schon spottete: "Das Vieh ist erst zehn Jahre alt und hat schon Epigonen in zwanzigster Generation."
Konsequent verbot Döblin sich die erzählerische Innenschau: "Psychologie ist ein dilettantisches Vermuten, scholastisches Gerede, spintisierender Bombast, verfehlte, verheuchelte Lyrik." Er plädierte fürs Beobachten statt fürs Bescheidwissen. In seinem Groteskroman "Wadzeks Kampf mit der Dampfturbine", einem Lieblingsbuch Brechts, bleibt von den Figuren nur ein Ensemble naturalistisch protokollierter Gebärden und Grimassen: depersonifiziertes Personal eines "enigmatischen Romangebildes", in das "tausend Fäden Aberwitz gewirkt sind", schreibt Schoeller.
Den Großepiker begreift er in Reaktion auf das Großereignis des Ersten Weltkriegs. Döblin diente als Militärarzt hinter der Westfront. Der monumentale "Wallenstein" übersetzt die aktuellen Ereignisse in ein historisches "Schreckenskino": Wallenstein als "moderner Industriekapitän des Todes". Überhaupt ist Döblin ein Epiker des Krieges. Friedrich Becker in "November 1918" ist ein Kriegsversehrter; das späte Schmerzensbuch "Hamlet oder Die lange Nacht nimmt ein Ende" entwickelt ein komplexes, mythologisch grundiertes Familiendrama aus einem Kriegstrauma. Dicht ist die Schlacht-Motivik auch in "Berlin Alexanderplatz", wo Biberkopf seine Kriegsneurose von den Stellungskämpfen mit sich herumschleppt.
Schoeller folgt Döblin bewundernd in die "Vielseitigkeitsprüfung" der zwanziger Jahre: Der Vater dreier Söhne schuftete als Armenarzt im Berliner Osten, seine Praxis war oft eine Sozialstation, allein im Jahr 1925 absolvierte er zweitausend Hausbesuche. Nebenbei schrieb er ein umfangreiches Werk nach dem anderen und verfasste unter dem Pseudonym "Linke Poot" politische Glossen, in denen er mit der verratenen Revolution haderte. Um sein Budget aufzubessern, ließ er, der vom Theater wenig hielt, sich von der Breslauer Zeitung als Theaterkritiker engagieren - seine Texte, merkwürdig und spritzig, ergeben ein Panorama der Inflationszeit, als eine Theaterkarte eine halbe Milliarde kostete. Außerdem führte er Rundfunkdebatten, betrieb naturwissenschaftliche Studien, versenkte sich in Buddhismus und mystische Lehren. Aufgestört durch die Pogrome im Berliner Scheunenviertel 1923, begann er sich auch erstmals mit dem Judentum auseinanderzusetzen.
Nur einmal, im Herbst 1929, hatte er breitenwirksamen Erfolg mit "Berlin Alexanderplatz". Und wurde dann doch gleich wieder in den Schatten gestellt von seinem Rivalen. Nach Thomas Manns Nobelpreis verkauften sich die "Buddenbrooks" in nur sechs Wochen 700 000 Mal. Döblins Roman ist ein vibrierender Lobgesang auf die technisierte Metropole, ihr Tempo, ihre Dynamik, ihre wendigen, gewitzten Menschen. "Eindrucksvoll zart ist dieser Prolet Biberkopf angefasst", schreibt Schoeller. Aber Biberkopf spricht nicht die Sprache des klassenbewussten Arbeiters, und der unorthodoxe Linke Döblin wurde zum Lieblingsfeind der linientreuen Marxisten. Eine der heftigsten Literaturfehden der Weimarer Republik folgte - die Auswirkungen bis ins Jahr 1978 hatte, als Klaus Schröter in seiner dogmatischen, bis heute nicht ersetzten Rowohlt-Monographie die alten Vorwürfe aus der "Linkskurve" erneuerte. Döblin aber hatte bereits 1927 prophetisch die Übel des Staatssozialismus formuliert: "der schroffe Zentralismus, die Wissenschaftsgläubigkeit, der Militarismus, die ökonomische Verengung der Gedanken . . ."
Döblin war jetzt ein vielbeschäftigtes Mitglied diverser Dichter- und Künstlervereinigungen. Er polemisierte gegen die völkischen Autoren, diese "Herren vom allzu platten Lande". Am Tag nach dem Reichstagsbrand ging er ins Exil. Illusionen machte er sich nicht: Das Schlimmste an Hitler sei, dass er den Deutschen "wie angegossen" passe. Seine Kontakte zu französischen Diplomatenkreisen erwiesen sich in der Folgezeit als hilfreich. Im Juni 1940 aber musste er vor der Wehrmacht aus Paris flüchten - eine verstörende Irrfahrt folgte, Tage, die er als die "schwärzesten" seines Lebens bezeichnete. Auf der Suche nach seinen Angehörigen in der Provinzstadt Mende gestrandet, vertiefte er sich in der dortigen Kathedrale in das Leidensbild des gekreuzigten Christus. Von diesem Erweckungserlebnis datiert sein Katholizismus, mit dem er viele Kollegen aus Weimarer Zeit irritierte.
Unermüdlich produzierte er weiter: "Hacke ich nicht täglich meine fünfzehn, zwanzig Schreibseiten herunter, ist mir nicht wohl." Dieses Tempo erzeugte, wenn es gut lief, eine Prosa von einzigartiger Dynamik und Gegenwärtigkeit, einen synkopischen, oft wie improvisiert wirkenden Stil. Im kalifornischen Exil sollte er als Lohnschreiber bei Metro-Goldwyn-Meyer für den Film "Mrs. Miniver" probeweise ein Script liefern, und der Auftraggeber staunte nicht schlecht, als Döblin bereits nach zwei Tagen mit einem fertigen Text von vierzig Seiten anrückte.
Nach dem Krieg zögerte er keinen Augenblick, zurückzukehren nach Deutschland. Er wollte heraus aus der Isolation, mitwirken am Neuanfang. Im Dienst der französischen Besatzungsmacht entfaltete er bald rege kulturpolitische Aktivitäten, forderte etwa die Unterdrückung kriegsverherrlichender Werke - aber das einzige Buch, das er als Zensor verbot, stammte von ihm selbst: der kriegerische "Wallenstein", der ihm selbst nicht mehr geheuer war. Bald zog er ein bitteres Resümee seiner Rückkehr: "Und als ich wiederkam - da kam ich nicht wieder."
Mit viel Empathie beschreibt Schoeller die letzten Jahre des Siechtums. Döblin, ein geschlagener Hiob, an Parkinson erkrankt, von seiner Wirkungslosigkeit enttäuscht, ging noch einmal ins Exil nach Paris. Gelegentlich konnte er sich immer noch aufraffen, etwa zu einem maliziösen Nachruf ("Es gab diesen Thomas Mann, welcher die Bügelfalte zum Kunstprinzip erhob . . .") oder zur Änderung des christlichen Schlusses des "Hamlet", der 1956 in der DDR endlich doch noch veröffentlicht wurde. Schoeller sieht darin mehr als ein bloßes Zugeständnis, nämlich ein spätes "Verblassen der Frömmigkeit".
Die Biographie verfügt souverän über die Materialmassen. Bisweilen hätte man dem Buch etwas mehr erzählerische Zugkraft gewünscht; es gilt indes zu bedenken, dass Döblin Selbstauskünften aus Prinzip misstraute. Als Biograph, der sich an die Fakten hält, weicht Schoeller deshalb öfter auf eine andere Überlieferungsspur aus: Viel und zuverlässig ist von Kulturpolitik die Rede, von Döblins Interventionen im Literaturbetrieb. Diese große, gründlich recherchierte, Biographie, die mit ihren pointierten Werk-Vorstellungen oft Lese-Lust auf die Romane und Erzählungen Döblins macht, wird lange ein Standardwerk bleiben.
Wilfried F. Schoeller: "Döblin". Eine Biographie.
Hanser Verlag, München 2011. 911 S., geb., 34,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Er war flink, sprunghaft, unermüdlich: Wilfried F. Schoeller erzählt das Leben des Alfred Döblin
Alfred Döblin gehört zu den bekanntesten Unbekannten der deutschen Literaturgeschichte: der Antikapitalist, der zugleich Antimarxist sein wollte; der Jude, den das Jüdische zunächst nicht interessierte, der sich dann aber – von den Nazis auf sein Erbe zurückgeworfen – für die jüdische Siedlungspolitik engagierte und schließlich zum Katholizismus konvertierte; der Frankreichhasser, der nach dem Exil das Nachbarland jenseits des Rheins als sein Zuhause betrachtete; der engagierte Intellektuelle, der der Politik misstraute und für die Entwicklungen der Weimarer Republik wenig Feingefühl aufbrachte; der Autor monumentaler Werke, der keine Großschriftsteller mochte. Über diesen Autor gibt es viel zu erzählen, und dies hat nun endlich Wilfried F. Schoeller auf mehr als 800 Seiten getan, damit seinem Gegenstand widersprechend, der in einem knappen Krankenbericht über sich behauptete: „dieser Mensch hat kein bewegtes äußeres Leben geführt, dessen Beschreibung abenteuerliche oder originelle Situationen aufzeigen könnte“.
Schoeller legt die erste große Döblin-Biographie vor und überblickt zugleich ein inhaltlich und formal ungeheuer vielseitiges Werk aus Romanen und Drehbüchern, Radioprogrammen und Erzählungen, aus Essays, journalistischen und wissenschaftlichen Beiträgen. Döblin war, so sagte dieser selbst einmal gegenüber Gerhart Hauptmann, ein „Kilometerfresser von Papier“. Literaturwissenschaftler und einige Fans haben ihn für sich entdeckt. Aber damals wie heute steht sein Werk im Windschatten der Literaturgeschichte, und so galt es eine große Brücke zu schlagen, um den Abgrund zwischen „Deutungswissen und Ahnungslosigkeit“ zu überbrücken. An Döblins eigentümlicher Unbekanntheit dürfte sein Hang zu Monumentalwerken nicht ganz unschuldig sein. Er hat sich nicht an Kurt Pinthus gehalten, der den Romancier noch nicht kannte und in der Rezension von Döblins erster Erzählsammlung empfahl: „Seid kurz wie Döblin.“
Vielleicht liegt es auch an Döblins tiefer Abneigung gegen die autobiographische Selbstauskunft von Autoren. In einem Lebensrückblick zur Feier seines 50. Geburtstages schreibt er über sich: „Er ist 160 Zentimeter groß. Nacktgewicht 114 Pfund; Brustumfang, Einatmung: 92 cm, Ausatmung: 86 cm; Kopfmaße; Umfang 58,5 cm, Längsdurchmesser 22 cm, Querdurchmesser 16 cm. Er ist hereditär stark kurzsichtig und astigmatisch.“ Die Schwierigkeiten der Leser mit diesem Autor dürften aber vor allem daran liegen, dass er literarisch keinesfalls so berechenbar war wie körperlich. Mit fast jedem seiner Werke schlägt Döblin einen Haken und zwingt seine Leser dazu, sich neu zu orientieren: Einmal schickt er sie weit in die Vergangenheit zurück, dann wieder katapultiert er sie einige hundert Jahre voraus; hier spintisiert er naturmystisch vor sich hin, dort gibt er sich ganz versessen aufs Aktuelle, bastelt an technischem Gerät, nutzt die neuesten Medien und ruft den Filmstil aus. Wer mit den „Drei Sprüngen des Wan-Lu“, beflügelt vom imperialistischen Geist, irgendwo im alten Asien oder Orient gelandet ist, kann sich danach in „Wadzeks Kampf mit der Dampfturbine“ über die Technikgeschichte des 19. und frühen 20. Jahrhunderts informieren, anschließend mit dem „Wallenstein“ die Zeit des Dreißigjährigen Kriegs und mit „Berge Meere und Giganten“ eine sehr ferne Zukunft erkunden, um schließlich in einem gigantischen Dreiteiler über die Revolutionszeit des „November 1918“ zu versinken.
Und dann ist da noch die „Grabplatte der Aufmerksamkeit für die anderen Bücher Alfred Döblins“: „Berlin Alexanderplatz“. 1929, bei Erscheinen, war der Roman eine Sensation und ein Skandal zugleich. Er hat sich bis 1933 immerhin rund 45 000 Mal verkauft. Aber im selben Jahr gewann eine Sonderausgabe der „Buddenbrooks“ die Gunst der Leser langer Bücher – Thomas Mann, der große Rivale Döblins, brachte seinen Kaufmannsroman nach der Nobelpreisverleihung allein im Weihnachtsgeschäft des Jahres 1929 in 700 000 Exemplaren unter die Leser. Für Döblin war dies durchaus von Bedeutung. In „Wider die Verleger“ posaunte er: „Der Künstler begreift seit langem mit dem Rest seines Großhirns, daß nicht die schwärmerischen Gefühle der Verehrer ihn am Leben erhalten, sondern Kartoffeln, Fleisch und Eier auf dem Umweg über Money“.
Schwer berechenbar erscheint Döblin auch in seinen persönlichen Verhältnissen. 1911 etwa war er plötzlich nicht mehr sehr gut auf die Zeitschrift DerSturm, seine erste wichtige Publikationsplattform, zu sprechen und schreibt dem Herausgeber Herwarth Walden: „Lieber H.W., eben sehe ich den letzten ‚Sturm‘ an; bitte: schicken Sie ihn mir nicht weiter. Ich mag ihn nicht.“ Schuld daran war die Entscheidung Waldens, in diesem Heft zwar viele Freunde Döblins abzudrucken, aber nicht diesen selbst. Als behände beschreiben ihn frühe Weggefährten, flink und sprunghaft, lebhaft und unermüdlich. Mit Marinetti paktierte Döblin kurz und beschied diesen dann: „Pflegen Sie Ihren Futurismus. Ich pflege meinen Döblinismus.“ Samuel Fischer, der lange Jahre zu ihm hielt, litt unter den Launen seines Autors. Ironisch meinte Döblin einmal über die Erfahrung mit seinen Verlegern: „Durchschnittlich brauche ich, um ein Buch herauszubringen, vier Jahre, das heißt vier Jahre Ringkampf mit den Verlegern, welche damit zweifellos den Zweck der Reifung meiner Sachen und Anregung meiner Arbeitsfreude verbinden.“
Schoeller folgt diesen Volten beharrlich, sorgfältig, mit wohl erwogenem Urteil und mit Sympathie für den Proteus Döblin, aber ohne je die Distanz zu verlieren. Er weiß, welche Bücher ihm besser und welche ihm weniger gut oder sogar gar nicht gefallen. Mit nur wenigen Wechseln in Tempo und Emphase erschließt er uns Schritt für Schritt die literarische Welt der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts von den expressionistischen Anfängen Döblins, in denen „Menschstöhnen“ zum Himmel „schlägt“ und „Aug gegen Aug“ erbarmungslos „loht“, bis zu dem kleinen Grab auf einem Dorffriedhof in den Vogesen. Was man wissen muss, erklärt Schoeller; die zeitgeschichtlichen Kontexte werden so weit wie nötig mitgeliefert. Hätte man die 830 Seiten kürzen und raffen können? Vielleicht. Und doch wollte man nicht in der Haut des Lektors stecken, weil sich immer wieder eine jener Facetten findet, aus denen sich das Leben Döblins zusammensetzt. Hier lohnt sich schließlich jede Seite.
Als roter Faden zieht sich eine eigentümlich Spannung durch diese Biographie, die vom Elternhaus ausgeht: Der Vater war musisch begabt und amourös vielseitig interessiert, die Mutter pragmatisch und auf den Zusammenhalt der Familie bedacht. Da das Geld fehlte, konnte dieser Konflikt bei Döblins Eltern keine kreativen Kräfte freisetzen, bei ihm dagegen schon. Wie er in seinem Werk oftmals die Welt in polare Ordnungen aufspaltete, so stand er auch in Liebesdingen lange Zeit zwischen zwei Frauen, pendelte beruflich zwischen der literarischen Mission und der ärztlichen Profession und saß politisch zwischen den Stühlen. Hölderlin, Kleist und Dostojewski, Nietzsche und Schopenhauer wählte sich der junge Mann zu Leitsternen – das konnte schwerlich in ein glückliches, erfülltes, gut bürgerliches Dasein führen.
Aber all diese Spannungen befeuerten den besessenen Literaturarbeiter auf seinen gedanklichen Raubzügen durch die Weltgeschichte, bei seinen Flanerien durch wohlvertraute und auf seinen Bibliotheksmärschen durch fremde, unbekannte Städte und Gegenden. Mit Schoeller lassen sich hier einige Entdeckungen machen. Viele Leser werden nach der Lektüre der Biographie auf den „Aus- und Abschweifungsroman“ über die „Babylonische Wandrung“ ebenso gespannt sein wie auf das sachliche Gegenstück des verkappten Berlinromans „Pardon wird nicht gegeben“. Und alle werden mit Stefan Zweig übereinstimmen, der Döblin zum 60. Geburtstag schrieb: „Von allen deutschen Schriftstellern hat keiner eine regere, raschere, universalere Phantasie.“
STEFFEN MARTUS
WILFRIED F. SCHOELLER: Alfred Döblin. Eine Biographie. Carl Hanser Verlag. München 2011. 911 Seiten, 34,90 Euro.
„Pflegen Sie Ihren Futurismus.
Ich pflege meinen
Döblinismus.“
Ein Kilometerfresser von Papier: Alfred Döblin, 1948 bei einem Besuch in Berlin. Foto: Walter Heilig, Bundesarchiv
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Eine Dienstleistung der DIZ München GmbH
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
Allseits geschätzt, aber kaum gelesen - so schätzt Willi Jasper Alfred Döblins heutige Wirkung ein. Begrüßenswert ist deshalb die Biografie von Wilfried Schoeller, der streng chronologisch das Leben und Werk des Schriftstellers erfasst und dabei ein besonderes Augenmerk auf die vielen Schicksalsschläge legt, mit denen Döblin zu kämpfen hatte und die sein oeuvre geprägt haben. Selbstmorde von Bruder und Sohn, Beziehungskatastrophen und Exilerfahrung werden dargestellt und in Beziehung zu seinen Schriften gesetzt, wobei auch sein beruflicher Hintergrund als Nervenarzt eine wichtige Rolle spielte, wie der Rezensent betont. Trotz der Auswertung von neuen Quellen kann Schoeller in seiner "monumentalen" Lebensbeschreibung allerdings nicht mit neuen Enthüllungen aus dem Privatleben Döblins aufwarten, meint Jasper, der darüber aber nicht traurig ist.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
"Die Schilderung der Lebensumstände geht Hand in Hand mit der literaturgeschichtlichen Interpretation in dieser großartigen, überfälligen, ersten ausführlichen Biografie des Bruno Alfred Döblin." Katrin Hillgruber, Der Tagesspiegel, 30.09.11
"Wer Döblin kennt, ist dankbar für diesen umfassenden Wegweiser durch das Leben und das Werk eines herausragenden Autors und wer erst dabei ist, sich den literarischen Kosmos Döblin zu erschließen, der wird dankbar für die vielen Zusammenhänge sein, die Schoellers Biographie herstellt." Michael Opitz, Deutschlandradio Kultur, 30.09.11
"Aber eines garantiert dieses gewichtige Werk von Wilfried F. Schoeller: enormes Hintergrundwissen und neue Lust auf Alfred Döblin." Sabine Dultz, Münchner Merkur, 25.10.11
"Schoeller zeichnet die Lebensturbulenzen und die seelischen Konflikte dieses Erzählgenies behutsam und anschaulich nach, gestützt auf umfangreiches, zum Teil erstmals veröffentlichtes Quellenmaterial." NZZ am Sonntag, Manfred Koch, 30.10.11
"Der Literaturjournalist Wilfried F. Schoeller hat eine verdienstvolle Arbeit geleistet." Willi Jasper, ZEIT Literaturbeilage, 01.12.11
"Schoeller legt die erste große Döblin-Biographie vor und überblickt zugleich ein inhaltlich und formal ungeheuer vielseitiges Werk ... ." Steffen Martus, Süddeutsche Zeitung, 05.12.11
"...eine gründlich recherchierte und gut lesbare Werkbiografie, welche die umfangreichen Materialmassen souverän meistert." Michael Fischer, Tages-Anzeiger Zürich, 14.12.11
"Wer Döblin kennt, ist dankbar für diesen umfassenden Wegweiser durch das Leben und das Werk eines herausragenden Autors und wer erst dabei ist, sich den literarischen Kosmos Döblin zu erschließen, der wird dankbar für die vielen Zusammenhänge sein, die Schoellers Biographie herstellt." Michael Opitz, Deutschlandradio Kultur, 30.09.11
"Aber eines garantiert dieses gewichtige Werk von Wilfried F. Schoeller: enormes Hintergrundwissen und neue Lust auf Alfred Döblin." Sabine Dultz, Münchner Merkur, 25.10.11
"Schoeller zeichnet die Lebensturbulenzen und die seelischen Konflikte dieses Erzählgenies behutsam und anschaulich nach, gestützt auf umfangreiches, zum Teil erstmals veröffentlichtes Quellenmaterial." NZZ am Sonntag, Manfred Koch, 30.10.11
"Der Literaturjournalist Wilfried F. Schoeller hat eine verdienstvolle Arbeit geleistet." Willi Jasper, ZEIT Literaturbeilage, 01.12.11
"Schoeller legt die erste große Döblin-Biographie vor und überblickt zugleich ein inhaltlich und formal ungeheuer vielseitiges Werk ... ." Steffen Martus, Süddeutsche Zeitung, 05.12.11
"...eine gründlich recherchierte und gut lesbare Werkbiografie, welche die umfangreichen Materialmassen souverän meistert." Michael Fischer, Tages-Anzeiger Zürich, 14.12.11