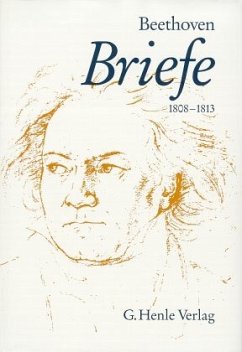Ein Muster an Sorgfalt und Vollständigkeit: Die Briefe Beethovens / Von Gerhard R. Koch
Hegels Wort von der Eule der Minerva, die ihren Flug erst in der Dämmerung beginne, dem Geist, der Phänomene erst in ihrem Verschwinden zu begreifen vermag, hat Michail Gorbatschow in der Perestroika-Hochphase drastisch paraphrasiert: Wer zu spät kommt, den straft die Geschichte. Für den Kulturbetrieb gilt noch eine Variante: Je größer Aufwand und Trubel sind, um so fraglicher wird, was von der Sache selber bleibt - die typische Gedenkjahr-Kalamität. Wie aber steht es um Beethoven, derzeit unbehelligt vom Jubiläums-Zirkus? Zwar gibt es eine gigantische Beethoven-Gesamt-Edition der Deutschen Grammophon; aber ob diese übers Repräsentative hinaus tatsächlich im einzelnen gehört wird und wirklich Relevantes über den gegenwärtigen Stand der Beethoven-Rezeption aussagt, bleibt fraglich. Überhaupt gibt es Anzeichen, daß die gewaltige Beethoven-Emphase früherer Generationen so nicht mehr existiert, zumal der Klassiker-Kanon an normativem Druck verloren hat - damit aber auch die "Einschüchterung durch Klassizität", gegen die Brecht anging. Der Kult um Idole, gleich welcher Art, ist nicht selten fatal gewesen; ein Nachlassen kann man also durchaus begrüßen.
Die Beethoven-Verehrung hat die wundersamsten Wandlungen durchgemacht: vom romantischen Geniekult, samt der hypertrophen, alle späteren Sinfoniker bedrückenden Vorbildfunktion, über die parareligiöse, auch national getönte Titanen-Anbetung mit ihren Denkmälern und Gipsbüsten, die Beschwörung des kompositorischen Revolutionärs, Leitfigur radikaler Moderne - bis hin zur Adaption durch die "Linke": Beethoven, der "Jakobiner". All diese Einschätzungen, so triftig wie schief, haben eines gemeinsam: Sie idealisieren und monumentalisieren den Komponisten, mag der Marmor nun schwarz, weiß oder rot sein. Ein wenig Frosch-Perspektive scheint da stets im Spiel. Dem wiederum entspricht der Kammerdiener-, gar Schlüsselloch-Blick: der menschlich-allzumenschliche Gigant, seine Leiden, Affären, Schrullen - Kleines im Großen, Großes im Kleinen, Beethoven, der Filmheros. Während für Beethoven-Exegeten wie August Halm oder Adorno, gut hegelianisch, das Individuum hinter dem Agenten des komponierenden Weltgeistes verschwand und das Interesse einzig den progressivsten Tendenzen des Werks galt. Fragen also über Fragen.
Nun liegt in sechs Bänden und einem Registerband die Neuedition der Beethoven-Briefe bei Henle vor; ein achter mit Addenda und Corrigenda wird das Unternehmen beenden. Schon jetzt kann man sagen: Es ist eine gewaltige Leistung, und für den, der sich speziell für Beethoven interessiert, eine wahre Fundgrube, als Dokumentensammlung unerläßlich. Das deutsch-österreichisch-englisch-amerikanische Team um Sieghard Brandenburg vom Bonner Beethoven-Archiv hat vorzügliche Arbeit geleistet, am Ende sogar eine Art Jahrhundertwerk. Die erste Sammlung der Beethoven-Briefe war schon 1865 erschienen; maßgeblich jedoch wurde Kapps Ausgabe aus dem Jahr 1923 von immerhin 1470 Briefen. Danach erschienen weitere ambitionierte Ausgaben, kurioserweise jedoch auf englisch und russisch.
Das Henle-Unternehmen bedeutet eine Art qualitativen Sprung, präsentiert es doch nicht nur nunmehr die 1789 erhaltenen Briefe Beethovens, sondern auch 370 an diesen gerichtete, außerdem 163 Briefe, die sich auf den Komponisten beziehen. Ein schier überbordendes Gesamt-Konvolut also, chronologisch geordnet (oft auch nur erschlossen) und numeriert: vom ersten Schreiben des Zwölfjährigen (14. Oktober 1783) an den Bonner Kurfürsten Maximilian Friedrich bis zum letzten an das St. Petersburger Handels- und Wechselhaus Stieglitz & Co. vom 21. März 1827. Beethovens Leben, keine siebenundfünfzig Jahre während, erscheint also über zweiundvierzig Jahre hindurch erstaunlich lückenlos dokumentiert, wie mit einem dichten Netz von Dokumenten überzogen. Rein quantitativ ist dies eine immense Fülle, Zeugnis auch von der enormen, nicht selten bizarren Beethovenschen Mitteilungslust. Sämtliche Empfänger und Absender, auch alle Textanfänge sind aufgelistet - und dem Ortsregister korrelieren sogar zwei eigens veröffentlichte historische Pläne der Stadt Wien.
In Orthographie und Interpunktion hat man sich an die Beethovenschen Originale gehalten; deren graphisches Tohuwabohu zu entziffern ist mühsam genug. Beethovens Rechtschreibung dürfte heutigen Normverfechtern die Haare zu Berge stehen lassen: Begriffe und Namen, auch den eigenen, schreibt er mit anarchischer Irregularität. Was Vollständigkeit und Authentizität betrifft, muß die Ausgabe als mustergültig betrachtet werden. Daß sie gerade zu keinem Jubiläum erschien, muß der Autonomie und Würde von Wissenschaft zugute gehalten werden, die sich nicht nach dem Markt zu richten hat: Eine Edition ist fertig, wenn die Arbeit an ihr abgeschlossen ist.
Liest man in ihr, so kann man sich trotzdem nicht ganz des Gefühls des ein wenig Verspäteten erwehren. Die Brisanz des Biographischen mag einst größer gewesen sein; jetzt dominiert die Puzzle-Monumentalität des Historischen. Scheint Beethoven ästhetisch wie ideell, darin also auch ideologisch, ferner zu rücken, so ist das Interesse an der Person erst recht nicht mehr brennend. Das Gefühl der Unmittelbarkeit jedenfalls will sich nicht immer so packend einstellen, wie dies bei früheren Brief-Lektüren mitunter vorkam.
Aber noch etwas anderes läßt das Gefühl, in einem riesigen Zettelkasten zu stöbern, wie spannnend auch immer, labyrinthisch wuchern - also auch das der Ungreifbarkeit wachsen: Beethoven war nicht unbedingt der Mann des ästhetischen und politischen Diskurses, der übergreifenden literarischen Strategien. Wer sich Aufschluß erhofft über Beethovens Ansichten zum eigenen Komponieren, zu eigenen Werken, zu fremden Komponisten, zur generellen Lage der Musik und der Künste, aber auch zur politischen Lage oder zum allgemeinen Weltbild, der wird zwar immer wieder fündig werden. Doch ein systematischerer Zusammenhang der Äußerungen ist nur selten auszumachen. Verglichen mit den Schriften E.T.A. Hoffmanns, Schumanns, Berlioz', Liszts, erst recht Wagners, Debussys, Busonis wie Pfitzners, Schönbergs bleiben Beethovens Briefe in der Regel spontane Äußerungen, selten polemisch oder apologetisch stilisiert. Dies wiederum ist auch eine erhebliche Qualität: Es sind gleichsam prompte Mitteilungen, manchmal praktisch bedingt, manchmal Wutausbrüche - etwa über Verleger, Kopisten, Notenstecher - und oft am bewegendsten Kommunikations-Notate aus der Augenblickslaune heraus, nicht selten bizarr, oft sogar von regelrecht dadaistischem Sprachwitz.
Alfred Brendel hat Beethovens Diabelli-Variationen unter dem Gesichtspunkt aufsplitternden Humors beschrieben und erklärt. Etwas vom fast berserkerhaft drastischen Witz taucht auch immer wieder in den Briefen auf. Da tritt er, darin letztlich doch "Jakobiner", selbstbewußt, ja unwirsch auf, nimmt kein Blatt vor den Mund, auch gegenüber den Mächtigen nicht, von deren Gunst er sich sehr wohl abhängig wußte. Als Fürst Lobkowitz 1805 befand, zwei Fagotte statt dreier würden es für "Fidelio" auch tun, reagierte Beethoven: "Wenn Eure Durchlaucht nur die Instrumente so besetzen, so scheiß ich drauf." Und an Fürst Lichnowsky schrieb er 1806: "Fürst, was Sie sind, sind Sie durch Zufall und Geburt, was ich bin, bin ich durch mich; Fürsten hat es und wird es noch Tausende geben; Beethoven gibt's nur einen ec."
Beethovens brieflicher Umgangston ist häufig ungeniert. An seinen Freund, den Hofrat Zmeskall, schreibt er: "liebster Baron Dreckfahrer . . . hol' sie der Teufel, ich mag nichts von ihrer ganzen Moral wissen. Kraft ist die Moral der Menschen, die sich vor anderen auszeichnen, und sie ist auch die meinige . . ." Doch auch die Pfaffen bekommen ihr Fett. Da werden Pfarrer attackiert, die sich vor allem prügelnd ihrer Zöglinge annehmen. Und der "Jakobiner" wird fuchsteufelswild, hält man ihm die Vorzüge von Religion und neuer Innerlichkeit entgegen. Da beharrt er auf Aufklärung und revolutionärem Ideal. Parallelen zur Gegenwart sind keineswegs ausgeschlossen.
Natürlich bezieht sich Beethoven häufig auf genuin musikalische Sachverhalte. So schreibt er über die "Eroica" - "die Simphonie ist eigentlich betitelt Ponaparte" - an den Leipziger Verlag Breitkopf und Härtel: "Mein Bruder glaubte anfangs . . . sie würde zu lang seyn wenn der erste Theil des ersten Stücks wiederholt würde, aber nach öfterer Aufführung derselben fand es sich, daß es sogar nachtheilig sey, wenn der erste Theil nicht widerholt würde." Beethoven war also für die Wiederholung der Kopfsatz-Exposition. Sogar Klavier-Fingersätze teilt er dem Verleger mit, etwa zum Es-Dur-Trio op.70,2. Sie sind nicht die nächstliegenden, zielen eher bewußt auf Kraft und Deutlichkeit der Sechzehntel. Doch so entschieden, wütend, verbittert er sich zu Detailfragen der Notation äußert: In der Frage der Satzfolge der Hammerklaviersonate erweist er sich als erstaunlich kulant. So schreibt er am 19. März 1819 an Ferdinand Ries: ". . . oder sie können auch das Largo auslaßen u. gleich bey der Fuge das letzte Stück anfangen, oder das erste Stück alsdenn das Adagio u. zum 3-ten das Scherzo u. ,das' g N0.4 sammt largo u. Allo risoluto ganz weglaßen, oder sie nehmen nur das erste Stück und Scherzo als (ganze Sonate)." Auch hier also sind die Briefe, darin wohltuend unprätentiös, keineswegs frei von Widersprüchen. Attacken auf den Adel schließen Wohlverhalten keineswegs aus. Und selbst der Furor gegen eine ihn verkommen dünkende Menschheit läßt nicht die manchmal krämerhafte Pfennigfuchserei gegenüber Verlegern oder Mäzenen und vor allem Bediensteten verkennen. Ja in manchen Bereichen wie etwa dem Haushalt, erst recht im Konflikt um den Neffen Karl, nimmt Beethovens Verhalten unzweifelhaft paranoide Züge an und wirkt sich das Mißtrauen des Ertaubten nicht selten obsessiv aus. Da tobt der Titan voller Ingrimm im Nähkästchen.
So ziehen sich verschiedene Stränge durch die Briefe, stetig sich wiederholende Klagen über den schlechten Gesundheitszustand, die Schlechtigkeit der Leute, die miesen Verleger, die Standesschranken, die ihm häufig den Kontakt mit angebeteten Damen der "besseren Kreise" erschwerten, die manisch-paranoide Überaktivität im Kampf mit seiner Schwägerin um seinen Neffen Karl. Es sind auch Bekenntnisse eines großen Leidenden, der sich immer wieder mit groteskem Witz über einen niederträchtigen Weltzustand ausläßt, aber gerade Freunde mit derbsten Kraftausdrücken belegt: ein ganz offenkundig zartes Gemüt, das sich betont rabiat gibt. Es sind ungeschönte Dokumente im wahrsten Wortsinne, frei von der Selbststilisierung eines Edelmenschen. Daß er sich mit Goethe nicht so recht vertrug, wirkt verständlich.
All dies ist natürlich schon lange hinlänglich bekannt. Ganz neue Aspekte jedenfalls vermittelt diese vorbildliche Briefedition kaum. Dies hat sie mit manchen Kompendien und Briefsammlungen gemein. Die Überfülle des Materials droht manche strukturiertere Perspektive zu verhindern. Dies wiederum schmälert den exemplarischen Wert dieser Arbeit nicht im mindesten. Doch die Vergegenwärtigung Beethovens muß auf anderem Terrain erfolgen.
Ludwig van Beethoven: "Briefwechsel". Gesamtausgabe. Mit einem Vorwort von Sieghard Brandenburg. Band 1: 1783-1807.344 S., 1996.Band 2:1803-1813. 388 S., 1996. Band 3: 1814-1816. 368 S., 1996. Band 4: 1817-1822. 560 S., 1997. Band 5: 1823- 1824. 408 S., 1997. Band 6: 1825-1827. 398 S., 1997.Band 7: Registerband. 319 S., 1998. Alle im G. Henle Verlag, München. Geb., je 168,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main