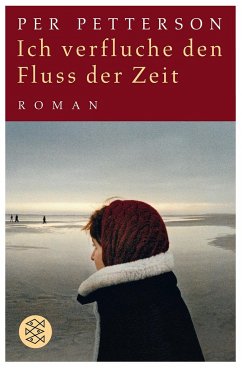November 1989. Die Mauer ist gefallen, eine Ära geht zu Ende. Arvids Mutter erfährt, dass sie an Krebs erkrankt ist. Ohne ihren Mann und ihre erwachsenen Söhne möchte sie noch einmal in ihre Heimat, ins Ferienhaus auf Jütland. Arvid, der selber gerade ein großes Problem hat, er steht unmittelbar vor seiner Scheidung, fährt ihr einfach nach. Das Verhältnis zwischen Mutter und Sohn war nie gut, Arvid war das Sorgenkind, ungeschickt und querköpfig. Nur in einer Sache fühlen sie sich verbunden, durch die Leidenschaft für Filme und Bücher. In raffinierten Rückblenden erzählt Per Petterson diese Geschichte von Mutter und Sohn, Alter und Jugend, Kränkungen und nachgetragener Liebe. Per Petterson evoziert mit wenigen Worten ganze Welten.

Jeden Tag aufs Neue sprachlos: Per Petterson erzählt wieder von seinem wortkargen Helden Arvid Jansen
Im Herbst 1989 ist Arvid Jansen 37 Jahre alt und weiß nicht weiter. Petterson-Leser kennen Arvid Jansen, den mit dem Autor das Lebensalter und vielleicht das eine oder andere mehr verbindet, aus früheren Romanen – nur in „Pferde stehlen”, Pettersons Erfolgs- und Durchbruchs-Buch aus dem Jahre 2003, trat er nicht auf. Nun also, in Pettersons jüngstem Roman mit dem Mao Zedong entlehnten Titel „Ich verfluche den Fluss der Zeit” (für das Petterson den Literaturpreis des Nordischen Rates erhalten hat), ist Arvid Jansen in seiner ganzen Ratlosigkeit und Wortkargheit wieder da. „Brüchige Bilder von der Abreise, dem Ort. / Ich verfluche den Fluss der Zeit: zweiunddreißig Jahre ist es her”, so lässt sich der Große Vorsitzende in einem seiner 37 Gedichte vernehmen, und Arvid Jansen, zu jener Zeit – Anfang der siebziger Jahre – ein bekennender Maoist und Fabrikarbeiter, liebt dieses Gedicht, „weil es einen menschlichen Mao zeigte, einen, dem ich mich verbunden fühlte, einen, der spürte, wie die Zeit seinen Körper heimsuchte”. Vielleicht hat Arvid Jansen an Mao gar nicht die Revolution geliebt, sondern die Melancholie dieser Zeilen und darin vor allem die Klage über den „Fluss der Zeit”.
Im Herbst 1989 also erfährt Arvid Jansens Mutter, dass sie Krebs hat und bald sterben wird. „Eine Weile blieb sie einfach am Küchentisch sitzen, den Briefumschlag in der Hand, und sah aus dem Fenster auf denselben Rasen, denselben weißen Lattenzaun, denselben Wäscheständer und dieselben absolut identischen grauen Reihenhäuser, die sie seit vielen Jahren sah, und sie dachte, was sie schon seit fast genauso vielen Jahren dachte, dass es ihr hier überhaupt nicht gefiel.” Kein Wunder, dass diese Erzählweise alle Welt an Hemingway und Raymond Carver und andere Erzväter des „Lakonischen” erinnert. Während aber der Carversche Sound der Lakonik heute vielfach nur dazu dient, erzählerische Nulllösungen stilistisch zu adeln, hat Petterson tatsächlich eine Geschichte zu erzählen. Sie handelt von gewöhnlichen Menschen in außergewöhnlichen Situationen, und davon, wie diesen Menschen auch und gerade in außergewöhnlichen Situationen die Sprache fehlt.
Selten sagen hier die Figuren zur richtigen Zeit das Richtige oder auch nur Passende. Was sie empfinden oder denken, drückt sich viel eher in einem bestimmten Licht der Landschaft oder in einer stummen Geste aus. Nicht, dass diese Figuren eine besondere Neigung zum Unglück hätten. Einmal fährt Arvid mit seinen beiden Töchtern im Auto über Land, und „einfach über diese Straßen fahren und Beatles-Songs singen, bergauf, bergab, in ständig neuen Kurven und Biegungen, die Äcker abwechselnd rechts blassgrün und links graubraun, wie es in diesem Herbst, 1989, im matten Licht von Nittedal, in Nannested und ganz oben bei Eidsvoll der Fall war” – und man spürt, dass die diffuse Lebens-Sehnsucht dieser Figuren in Pettersons Sprache ihren idealen Ort gefunden hat.
Lauter verpatzte Auftritte
Die Mutter zieht sich zum Sterben in ein Ferienhaus im heimatlichen Nordjütland zurück, und Arvid, einer von vier Söhnen, nimmt bald darauf die Holger Danske von Norwegen hinüber nach Dänemark, um seine Mutter zu besuchen. Die Mutter will eigentlich nur in Ruhe gelassen werden und die Bücher – Grass, Somerset Maugham – , die sie mitgenommen hat, lesen. Der einzige Grund, warum ihr Sohn sie besucht, kann nur sein, dass er „blank” ist, vermutet sie. Aber Arvid steckt selbst in einer Lebenskrise. „Ich werde geschieden, sagte ich”, und wie sich dann Mutter und Sohn über die Scheidung und ihre möglichen Ursachen unterhalten, das bringt die ganze, gar nicht unbedingt dumpfe, sondern bloß alltägliche Sprachlosigkeit im Umgang der beiden ans Licht.
Das Gespräch versickert, man raucht zusammen eine Zigarette und noch eine und trinkt dazu einen Calvados. Von sehr weit weg sind die Schallwellen der großen Geschichte zu verspüren, „Die Mauer fällt” steht auf allen Titelseiten, und Arvid Jansen hat sich in seiner Lebensmitte in einem dunklen Wald verlaufen.
Der Roman blendet zurück in die revolutionären Frühsiebziger, als der junge Arvid sein Elternhaus verließ und sich den maoistischen Kadern von Oslo anschloss, obwohl er sich immer für Bücher und Filme mehr interessierte als für Politik. In der Rolle des Agitators findet sich Arvid selbst fehlbesetzt; sein romantisches Ideal von der Befreiung der Völker findet eher Nahrung an Büchern, wie etwa an Jan Myrdals Afghanistan-Buch „Kreuzweg der Kulturen”: „Ich setzte mich an den Küchentisch und las. Über den Sätzen entspann sich ein Himmel. Die Welt entfaltete sich in all ihrer Weite, rückwärts in der Zeit, vorwärts in der Zeit, die Geschichte war ein langer Strom, und wir waren Teil des Stroms.” Da ist er wieder, Maos „Fluss der Zeit”. Als alter Mann war Mao durch den Jangtse geschwommen, nicht nur, um ein Zeichen seiner Rüstigkeit zu setzen, sondern auch, um den revolutionären Prozess mit dem Lauf der Naturgewalten bildlich zu vereinen.
Was Arvid Jansen an der Revolution begeistert hatte, war ihre (und seine) Sehnsucht nach anderen Verhältnissen gewesen. Jetzt, 1989, bricht anderswo eine neue Revolution los, aber der Alt-Maoist Arvid ergeht sich in Melancholie. Vom Fluss der Zeit, der „1989” ermöglicht hat, ist er kein Teil mehr. Als seine Mutter ihren fünfzigsten Geburtstag feiert, will Arvid eine Rede halten, und zwar über den Rio Grande. Seitdem der Rio Grande streckenweise ausgetrocknet ist, sei es eine Kleinigkeit, von einem Ufer zum anderen zu gelangen, was doch eine „gute Nachricht” sei. Aber dann betrinkt sich Arvid auf dem Fest zu schnell, verliert sein Manuskript und verpatzt seinen Auftritt. Wie er überhaupt die meisten Auftritte seines Lebens verpatzt hat.
Das viele Scheitern könnte larmoyant werden, aber es wird es nicht, weil Arvid Jansen – zum Glück, möchte man sagen – auch dazu die Sprache fehlt. Stattdessen setzt er sich am Ende einfach ins nordjütländische Dünengras: „Ich zog ein paar Halme aus einem Büschel Dünengras, steckte sie in den Mund und kaute darauf herum. Sie waren hart und schnitten mir in die Zunge, woraufhin ich mehrere Halme nahm, fast eine Handvoll, sie in den Mund steckte und gründlich auf ihnen herumkaute . . . ” CHRISTOPH BARTMANN
PER PETTERSON: Ich verfluche den Fluss der Zeit. Roman. Aus dem Norwegischen übersetzt von Ina Kronenberger. Carl Hanser Verlag, München 2009. 240 Seiten, 17, 90 Euro.
Keine Fähre setzt über den Fluss der Zeit, aber die Fähre von Oslo nach Frederikshavn (Jütland) bringt den Sohn zur kranken Mutter Foto: imago/Martin Werner
Per Petterson Foto: Peter Peitsch / peitschphoto.com
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.sz-content.de

Per Pettersons neues Buch ist sein bisher bestes
Von Peter Urban-Halle
Vor zehn Jahren erschien der erste Roman von Per Petterson auf Deutsch, "Sehnsucht nach Sibirien", ein Buch voller Freuden und Schrecken, voller Überraschungen. Es spielt im dänischen Frederikshavn, teilweise unter der deutschen Besatzung, aber Petterson will nicht die Politik, sondern die Menschen erkunden. Fasziniert steht der Leser vor seinen Figuren wie die Ich-Erzählerin des Romans vor ihrem geliebten schlafenden Bruder: Nackt und unverhüllt liegt er vor ihr, doch für sie bleibt er fern.
Oft genug erscheinen einem nicht nur die anderen unerforschlich, sondern ist man sich auch selbst ein Rätsel. Pettersons Durchbruch nicht nur in Deutschland war vor drei Jahren der herausragende Roman "Pferde stehlen". Kann ich "als Hauptperson meines eigenen Lebens hervortreten", oder nimmt ein anderer diesen Rang ein? Diese Einleitungsfrage aus Dickens' "David Copperfield" zitiert die Tochter des knapp siebzigjährigen Trond, ohne zu wissen, dass es die Grundfrage seines Lebens ist.
Der neue Roman führt dieses Nachdenken über das Leben konsequent fort. Aus trauernder und skeptischer Reflexion wird radikaler Lebenszweifel. Diesmal setzt sich ein Sohn, Arvid heißt er (der noch in anderen Romanen Pettersons vorkommt), mit seiner Mutter auseinander. Beide, Mutter und Sohn, haben auf ihre Weise existentielle Probleme. Sie hat gerade erfahren, dass sie Magenkrebs hat, wenn schon, dann hätte sie, die Raucherin, eher mit Lungenkrebs gerechnet. Die Dänin fährt zunächst in ihr Ferienhaus bei Skagen, um allein zu sein. Ihr Sohn steht derweil kurz vor der Scheidung von seiner Jugendliebe. Jetzt fährt er mit seinen Töchterchen durch die Gegend und singt mit ihnen alte Beatles-Lieder, und wenn er dann wieder zu Hause ist, kneift er die Augen zusammen, denn es "war ohnehin nicht schwer zu erkennen: Sie wollte mich nicht mehr haben".
Pettersons lässt seine Romane gern vor einem großen historischen Hintergrund spielen: Besatzungszeit, Jahrtausendwechsel, hier ist es der Fall der Mauer. Aber die geschichtlichen Ereignisse sind höchstens eine Art symbolische Grundierung. Den Mauerfall kriegt Arvid kaum mit, wichtig ist, dass bei ihm alles zusammenbricht. "Ich verfluche den Fluss der Zeit" ist die überwältigende Geschichte eines großen Versagens, in seiner Folgerichtigkeit packender als alles, was wir von Petterson auf Deutsch bislang lesen konnten. Arvid ertrinkt beinahe im Brackwasser, bevor er merkt, dass er da eigentlich stehen kann. Die Rede zum fünfzigsten Geburtstag seiner Mutter, sorgfältig vorbereitet, geht in die Binsen, weil er volltrunken ist, das Einzige, was er ihr sagen kann, ist: "Ich kann mich an nichts von dir erinnern." Schon als Junge lernt er, "herunterzuschlucken" und zu tun, "als wenn nichts wäre. Dann sah es aus, als hätte das, was ich tat, einen Sinn, eine Richtung, aber das hatte es nicht." Seine natürliche Ernsthaftigkeit lässt die Sinnlosigkeit nur noch sinnloser erscheinen. Seine Ohnmacht zeigt sich zuweilen ganz wörtlich. In der eindrucksvollsten Passage dieses eindrucksvollen Buchs fällt Arvid die Kiefer am Ferienhaus, noch nie hat er einen Baum gefällt, zweimal verliert er bei der Ackerei das Bewusstsein, und fortschaffen kann er den Stamm auch nicht, die Kiefer bleibt einfach liegen. Seine Mutter, die sie seit langem weghaben wollte, dankt es ihm kaum: "Sie hatte die Kiefer schon vergessen."
Dass sich alles zu wiederholen scheint, ist für Arvid das Schlimmste: "Ich nahm denselben Weg noch einmal, den ich vor wenigen Stunden gekommen war. Es fühlte sich etwas lächerlich an, als käme ich nicht voran, sondern wiederholte nur, was ich schon einmal getan hatte." Und in diesem Buch hilft auch die Erinnerung nicht mehr. Der "Fluss der Zeit", ein Mao-Zitat, ist unaufhaltsam und grausam. Irgendwann trifft Arvid einen ehemaligen Freund, nur um festzustellen: "Unsere Freundschaft war zu Ende, und ich vermisste sie sogleich, das, was sie einmal gewesen war, das, was aus ihr hätte werden können, aber alle Sommer waren verschwunden, und nicht nur, weil ich sie nach 25 Jahren vergessen hatte, sondern weil es keinen Sinn mehr hatte, sich an sie zu erinnern." Im Grunde brauchte man nur diesen schlichten Satz zu zitieren, um dieses wunderbare, melancholische, hoffnungslose, aber nie eisige Buch zu verstehen, das so groß ist, weil es den Menschen eigentlich gar nicht durchleuchten oder gar sezieren will und ihm so vielleicht am nächsten kommt.
Per Petterson: "Ich verfluche den Fluss der Zeit". Roman. Aus dem Norwegischen von Ina Kronenberger. Hanser Verlag, München 2009. 239 S., geb., 17,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension
Sehr beeindruckt schreibt Rezensent Christoph Schröder über Per Pettersons "Ich verfluche den Fluss der Zeit", der zeitlich vor Pettersons vorigem Roman "Im Kielwasser" angesiedelt ist. Hier lebt die Mutter des Erzählers Arvid noch, ist jedoch gerade mit Magenkrebs diagnostiziert worden. Arvid reist ihr hinterher, um, wie der Rezensent beschreibt, ihr einmal mehr seine Liebe hinterher zu tragen. Schröder hat den Roman nicht nur als ein Buch über die vergebliche Liebe zu einer kalten Mutter gelesen, sondern auch über den "Sprung im Charakter", über die "erschütternde Zwangsläufigkeit", mit der das Leben verrinnt, ein verfehltes zumal. Gesprochen wird kaum in diesem Roman, warnt der Rezensent noch, doch Trauer und Verlorenheit sind immer präsent.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH