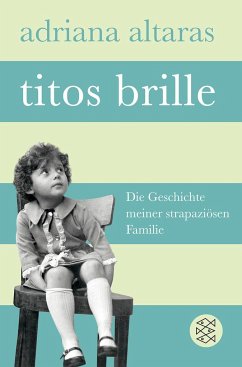Adriana Altaras führt ein ganz normal chaotisches und unorthodoxes Leben in Berlin: mit zwei fußballbegeisterten Söhnen, einem westfälischen Ehemann, der ihre jüdischen Neurosen stoisch erträgt, und mit einem ewig nörgelnden, stets liebeskranken Freund. Alles bestens also ... bis ihre Eltern sterben und sie eine Wohnung erbt, die seit 40 Jahren nicht mehr ausgemistet wurde. Fassungslos kämpft sich die Erzählerin durch kuriose Hinterlassenschaften, bewegende Briefe und uralte Fotos. Dabei kommen nicht nur turbulente Familiengeheimnisse ans Tageslicht, auch die Toten reden von nun an mit und erzählen ihre eigenen Geschichten.

Leidenschaftlich heiter: Die Schauspielerin und Regisseurin Adriana Altaras hat mit "Titos Brille" eine unterhaltsame, anregende und weise Geschichte ihrer jüdischen Familie geschrieben.
Von Irene Bazinger
Noch ist die zweite Seite des Prologs in Adriana Altaras' Buch "Titos Brille" nicht vorüber, da macht die Autorin schon klar Schiff: "Ich bin Jüdin. Jahrgang 1960. So, jetzt ist es heraus." Und so, wie sie zu den biographischen Fakten ihren ironisch erleichterten Stoßseufzer fügt, wird sie fürderhin die Geschichte ihrer "strapaziösen Familie" erzählen: Ohne Umschweife, ohne Scheu, ohne Sentimentalität - aber mit viel Zärtlichkeit und großem Witz.
Ausgebildet als Schauspielerin und oft als Regisseurin aktiv, scheint Adriana Altaras an ihr literarisches Debüt wie in eine Theaterprobe gegangen zu sein: Ärmel hoch - und durch. Ohne Angst vor zahlreichen ähnlichen Publikationen der letzten Zeit oder vor der schriftlichen Fixierung einer Vergangenheit, deren Irrungen, Wirrungen und Geheimnisse sie nicht ganz wird lösen können (was sie auch nie behauptet), breitet sie eine verzweigte Familienchronik aus. Die nationalsozialistische Vernichtungspolitik ist natürlich ein zentrales Thema, und den Passagen, in denen Adriana Altaras den Kampf vor allem ihrer Mutter um enteigneten Besitz weiterführt, ist die Empörung und die Wut über bürokratische Hürden und staatliche Missachtung deutlich eingeschrieben. Angesichts dessen ist es unerheblich, ob der Amtsschimmel in Deutschland, Kroatien oder der Schweiz wiehert.
Die Eltern lebten in Jugoslawien, kämpften als Partisanen gegen die Faschisten, gerieten später mit dem sozialistischen Staat in Konflikt und kamen schließlich auf nicht unkomplizierten Wegen mit der kleinen, in Zagreb geborenen Tochter nach Hessen. Der Vater arbeitete als Oberarzt am städtischen Klinikum, die Mutter war Architektin. Sie nahmen die deutsche Staatsbürgerschaft an und gründeten in Gießen, wo sie sich niederließen, 1978 wieder eine Jüdische Gemeinde. Beide wurden mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.
Nach dem Tod der Eltern und der Konfrontation mit deren Nachlass wird Adriana Altaras, deren Vornamen an das einstmals vor der Haustür gelegene Adriatische Meer erinnern sollte, verstärkt zur Auseinandersetzung mit ihrer Herkunft gezwungen. Daraus ergibt sich ein neuer Blick auf ihr eigenes Leben und die innere Notwendigkeit, Kontakte zu den über die halbe Welt verstreuten Verwandten aufzufrischen oder zu knüpfen. Die Kapitel heißen etwa "Der Rabbi mit der Aldi-Tüte", "Wer wegwirft, ist ein Faschist" oder "Bar jeder Mizwa" und sind mit wunderbar leichter Hand und furchtlosem Humor geschrieben. Angereichert sind sie durch kurze, kursiv hervorgehobene Einschübe mit Traum- oder Albtraumvisionen, ungenierten Witzen ("Werden alle Juden klug geboren? Nein! Aber die Dummen lassen wir gleich taufen . . ."), Erinnerungen und allerlei Anmerkungen in direkter Rede, die eine unmittelbare Verbindung zu den Toten herstellen. Die Dibbuks, die sich da äußern, sind allerdings eher nette, aufmerksame Stimmen aus dem Jenseits und drängen sich nicht in den Vordergrund.
Als in Deutschland aufgewachsenes Kind von Überlebenden des Holocaust sind Altaras' Reflexionen über Exil und Heimat von eigener Erfahrung geprägt, ebenso wie ihr Umgang mit jüdischer Tradition und Religion, die sie mit Sympathie und kritischer Distanz betrachtet. Doch ob sie in die Vergangenheit oder in die Zukunft schaut, stets tut sie es mit leidenschaftlicher Heiterkeit und stilsicherer Unverblümtheit, fabuliert sich von Mantua, wo sie die Sommerferien bei ihrer geliebten Tante verbrachte, in eine heutige New Yorker Synagoge, vom Konzentrationslager auf der Insel Rab, in dem ihre Mutter inhaftiert war, in ein Berliner In-Lokal, wo sie ihr Wiener Schnitzel genießt.
Auch das komplexe Verhältnis zwischen Deutschen und Juden wird häufig und meist halb erstaunt, halb schadenfroh angesprochen. Auf Liebesdinge hat es offensichtlich keine negativen Einflüsse, denn die Autorin betont geradezu ihre Schwäche für blonde, blauäugige Nordmänner. Auf ihr berufliches Tätigkeitsfeld freilich wirkt es sich besonders am Anfang aus, als die "Herrenmenschen" der Film- und Fernsehbranche die südländisch anmutende "Gastarbeiterin" bevorzugt als namenloses "Opfer" engagierten: "Ich spielte die Türkin, die Serbin, die Kroatin, die Griechin, die Russin, die Sizilianerin - wen auch immer. Fast immer putzte ich." Als sie ins Regiefach wechselt, ändert sich das: "Es war mir lieber zu besetzen, als besetzt zu werden - siehe Polen."
Lakonisch, flink und intelligent schildert Adriana Altaras in einem lockeren chronologischen Bogen sowohl ihre persönliche Entwicklung wie die Menschen und Begleitumstände, die für diese ausschlaggebend waren. Die Familie ist hier der Star, die sie uneitel in das Gesamtbild einfügt und deren Schicksal sie plastisch einzufangen versteht.
Da bedauert man es denn auch, dass auf Abbildungen komplett verzichtet wurde. Außerdem wären vorneweg oder im Anhang einige zusätzliche Jahreszahlen oder nüchterne biographische Stationen nützlich gewesen, damit man sich bei den flotten Zeitsprüngen rascher orientieren kann, und ein genaueres Lektorat, damit nicht jedes Flugzeug als "Flieger" bezeichnet wird. Aber abgesehen von solchen Kleinigkeiten ist "Titos Brille" herzhaftes, anregendes, kluges und amüsantes Lesefutter - keine hohe Literatur, dafür famos fesselnde Lebens- und manchmal auch spürbare Überlebenskunst.
Adriana Altaras: "Titos Brille". Die Geschichte meiner strapaziösen Familie.
Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln 2011. 272 S., geb., 18,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

trinken
Espresso
Adriana Altaras erzählt
in „Titos Brille“ eine
jüdisch-jugoslawische
Familiengeschichte
Von Kristina Maidt-Zinke
Um einen hochberühmten Romananfang zu parodieren: Alle jüdischen Familien ähneln einander. Aber vielleicht sind es auch nur die Geschichten, die einander gleichen wie siebenarmige Leuchter, von denen einer aus Bronze gefertigt wurde, ein zweiter aus Messing und der dritte aus Silber. Meist sind es Frauen, die diese Geschichten aufschreiben, und die Gemeinsamkeiten in Blickwinkel und Erzählton sind unübersehbar. Irene Dische, zum Beispiel, ließ eine erfundene Großmama aus dem amerikanisch-jüdischen Familiennähkästchen plaudern; Eva Menasse porträtierte ihre halb reale, halb fiktive österreichisch-jüdische Sippe unter dem weltläufigen Titel „Vienna“.
Jetzt fügt Adriana Altaras dem Genre eine aparte Variante hinzu. Die in Berlin lebende Schauspielerin und Regisseurin, 1960 in Zagreb geboren, ging in Italien und Deutschland zur Schule, studierte unter anderem in New York und hat nun eine turbulente, offenbar ganz authentische jüdische Familiengeschichte zu bieten, die quer durch Europa und das zwanzigste Jahrhundert verläuft und sich über die halbe Welt verzweigt.
„Titos Brille“ heißt dieses Prosadebüt, das mit Vorläufern und Artverwandten vor allem zwei Dinge teilt: Es besitzt weniger epische als anekdotische Qualitäten, und es geht mit der Frage der jüdischen Identität, zuweilen gar mit dem Holocaust-Thema, so ironisch-respektlos um, dass die deutsche „Generation Betroffenheit“ beim Lesen noch einen roten Kopf bekommen hätte. Die Autorin gehört derselben Generation an, doch ihr Erfahrungshintergrund ist ein anderer: „Wir hatten die Traumata unserer Eltern übernommen, sehr gründlich, sehr vollkommen. Wir sprachen von Lagern, die wir nie gesehen hatten, von dem Gefühl auf dem Todesmarsch, immer von Tod. Wir waren die exakten Kopien unserer Eltern und deren Geschichte.“
So klingt die ernste, die traurige Seite dieser autobiographischen Erzählung. In effektvollem Kontrast dazu steht die satirisch-kritische Farce mit hohem Wiedererkennungswert. Sie leuchtet etwa dann auf, wenn Adriana Altaras den Dreharbeiten für einen Kinofilm beiwohnt, in dem ihr Sohn David den jungen Michael Degen spielt: „Die Geschicklichkeit der deutschen Filmindustrie in Sachen Nazizeit war enorm gestiegen. Seit einiger Zeit waren die Deutschen auch nicht mehr nur Mörder, sie wurden gute und immer bessere Menschen. Im Film jedenfalls. Sie versteckten Juden und halfen, sie waren unschuldige Opfer in Dresden und hilflose Invalide auf der ,Wilhelm Gustloff’. Die Filme waren opulent, Dresden brannte, und der arme Hitler hatte jede Menge unverarbeiteter Gefühle.“
Mit der gleichen Unverblümtheit berichtet Altaras in locker verknüpften Episoden von der kroatischen Herkunft und dem italienischen Exil, vom Partisanenkampf der Eltern an der Seite Titos, ihrem Konflikt mit dem sozialistischen Regime und ihrem gutbürgerlichen dritten Leben im hessischen Gießen, wo die Mutter als Architektin arbeitete und der Vater als Mediziner mit Professorentitel, Beamtenstatus und Bundesverdienstkreuz. Der Tod der Eltern und die Sichtung des Nachlasses ist der Auslöser für Recherchen in der Familienchronik – auch das ist schon seit längerem ein beliebtes Romanthema, aber hier wird ein „Roman“ dankenswerterweise nicht vorgespiegelt.
Natürlich kommen Familiengeheimnisse ans Licht, natürlich kommt es zu mehr oder weniger skurrilen Differenzen zwischen den Hinterbliebenen. Auch treten die Dibbuks auf, die Seelen der ruhelosen Toten, die in die Lebenden schlüpfen und sie um den Schlaf bringen.
Adriana Altaras kokettiert genüsslich mit der Verrücktheit ihres Clans und dem kreativen Chaos ihres eigenen Lebens, aber auch mit ihrer Zugehörigkeit zu jener Berliner Szene, in der man im „Borchardt“ speist oder im privaten Salon am Wannsee mit einer „handverlesenen Gesellschaft“ kühlen Weißwein trinkt. Sie erzählt aus der Synagoge so locker wie aus dem Theater, bekennt sich zu ihrer Vorliebe für große, blonde, blauäugige Männer, die Dieter, Uwe oder Jens heißen, und zitiert einen „Standarddialog“ im Elternhaus, der an amerikanische Kinokomödien erinnert: „Wenn du uns keinen Juden heiratest, können wir dir nicht in Ruhe sterben.“ – „Na wunderbar, dann lebt ihr noch ein Weilchen.“
Auch jüdische Witze hat die Autorin im Repertoire, leider eher die schwächeren. Hinterhältiger zünden da oft ihre eigenen Aperçus: „An einem Sonntagabend liegt die Anmut Gießens im Verborgenen, im sehr Verborgenen.“ Wer eine jüdische Familie hat, braucht sich um Pointen nicht zu sorgen: Die schwärzesten und schönsten schreibt das Leben selbst. Zu den harmlosesten zählt jene, die dem Buch den Titel gab: In einer prekären Situation im kroatischen Partisanenkrieg repariert der Vater der Verfasserin Titos Brille. Er „wird zum Helden ernannt und bleibt es fortan“. Seine Tochter hat ihm nun ein Denkmal gesetzt. Zu einer literarischen Figur im eigentlichen Sinne ist er damit zwar noch nicht geworden, aber das dürfte seinen Dibbuk weniger stören als die Tatsache, dass es „im Himmel keinen Espresso gibt“.
Adriana Altaras
Titos Brille
Die Geschichte meiner strapaziösen Familie. Verlag Kiepenheuer und Witsch, Köln 2011. 266 S., 18,95 Euro.
„Dresden brannte, und der
arme Hitler hatte jede
Menge unverarbeiteter Gefühle“
Umsonst repariert: Tito 1996, auf einem Plakat mit zerschossener Brille. Foto: Wolfgang Bellwinkel/laif
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Rezensentin Kristina Maidt-Zinke sieht dem Genre der jüdischen Familiengeschichte mit Adriana Altaras' Buch eine neue, reizvolle Spielart hinzugefügt. Die Schauspielerin und Regisseurin, 1960 in Zagreb geboren und heute in Berlin lebend, hat mit fröhlicher Respektlosigkeit und Freude am Farcehaften die Geschichte ihrer Familie aufgeschrieben, erfahren wir. Dabei greift sie auch den Holocaust mit einer Sorglosigkeit auf, der manchem Betroffenheits-Deutschen die Schamesröte ins Gesicht treiben dürfte, so die Rezensentin. Auch wenn die Sichtung des Nachlasses der Eltern den Erzählanlass liefert und im Zuge dessen durchaus Verborgenes der Familiengeschichte ans Licht geholt wird, versucht die Autorin nicht, einen Roman zu entwickeln, sondern verlässt sich auf die "offenbar ganz authentische" Familienhistorie, stellt Maidt-Zinke zufrieden fest, die mit Vergnügen die grotesken Anekdoten und von den familiären "Verrücktheiten" gelesen hat. Sie muss allerdings zugeben, dass die jüdischen Witze, die die Autorin einstreut, nicht zu den besten gehören. Trotzdem, die respektlose Ironie, mit der Altaras das "Chaos" ihrer Familie und ihres eigenen Lebens behandelt, hat die Rezensentin sehr eingenommen.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Leidenschaftlich heiter: Adriana Altaras hat [...] eine unterhaltsame, anregende und weise Geschichte ihrer jüdischen Familie geschrieben. [...] famos fesselnde Lebens- und manchmal auch spürbare Überlebenskunst.« FAZ
"Eine geniale Familienaufstellung, aberwitzig, böse und liebevoll." "Rabbi" Dani Levy "Mann, schreibst du gut!" Bastian Pastewka