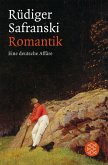Der Hygienediskurs des 19. Jahrhunderts versprach »Gesundheit und ein langes Leben« - und konstruierte so den modernen Körper. Er entwickelte aus der antiken Grammatik physischer Differenz eine moderne Sprache der »Individualität«. Er lehrte die Zeichen von Lust und Schmerz zu lesen, den Körper zu regulieren und ihn zu genießen. Sein heimliches, paradoxes Zentrum war der Reiz: Er ermöglichte »ächte Thätigkeit und ächten Genuss« und bedrohte im Exzess Leib und Leben. Auf ihn konzentrierte sich die hygienische »Sorge um sich«: Wer den Reiz kontrolliert, beherrscht seinen Körper - und damit sich selbst.

Philipp Sarasin steigt in die öffentliche Badewanne
Die Literatur über Biopolitik, über die Normalisierung und Normierung des bürgerlichen Subjekts ist zahlreich geworden. Auch kann man nicht behaupten, dass es der Bedeutung von Maschinenmetaphern für die Konstitution des Bildes vom modernen Menschen, überhaupt dem Moment des Körperlichen und der Körperlichkeit kulturgeschichtlicher Dinge an Interesse ermangelt hätte – weder in der neueren Medizin- und Wissenschaftsgeschichte noch in der Alltags- und Sozialgeschichte. Philipp Sarasin, seit kurzem Professor für Neuere Geschichte an der Universität Zürich, hat dieser wachsenden Industrie nicht einfach ein weiteres Inkrement hinzugefügt. Sein neues Buch versteht sich spezifisch als eine Diskursgeschichte der Hygiene, deren genealogische Geflechte und rhetorische Gefechte er von der französischen Enzyklopädie bis zum Vorabend des 1. Weltkriegs verfolgt.
Das Besondere an dieser Geschichte des Körpers über anderthalb Jahrhunderte hinweg ist ihr unaufgeregter Umgang mit der Legion gewordenen diskurstheoretischen Literatur, insbesondere aber mit ihrem Klassiker Foucault. Und es ist ihr meisterhaftes Spiel mit dem Detail, den Trouvaillen und der ganzen Kraft von deren oft unfreiwilliger Komik und Paradoxie, die dieser Geschichte ihr besonderes Flair verleiht. „So wollen wir den Vorhang aufziehen und hineinschauen mit unserem leiblichen Auge in das erhabene Schauwerk unsres eigenen Wissens”, heißt es in bezeichnender Verkehrung von Geist und Leib in Daniel Gottlob Moritz Schrebers „Anthropos, Der Wunderbau des menschlichen Organismus” vom Jahre 1859, dem Jahr des Erscheinens von Darwins „Entstehung der Arten”, mitten im Boom der industriellen Revolution.
Diskursgeschichten sind ja von ihrer Anlage her keine Mikrogeschichten. Sie versuchen sich an großen Linien, kümmern sich um Epochenschwellen vom einen Ende her und vom anderen um ihre Apotheosen. Das tut auch Sarasin, und er lässt seine Geschichte der Hygiene aus der Diskursmasse des 18. Jahrhunderts zehren. Sarasin sieht im Feld der medizintheoretischen Debatten des 18. Jahrhunderts drei Bereiche, aus denen die Hygienebewegung des 19. Jahrhunderts ihre formativen Elemente bezieht: erstens den Neohippokratismus mit seinen endlosen Permutationen der sogenannten sex res naturales; der Diät und der Diätetik; zweitens die Sprache der Irritabilität, der Sensibilität und des Reizes in der Tradition der anti-stahlschen Physiologie eines Albrecht von Haller; und schließlich die Theorie des Subjekts der medizinischen Aufklärer, wie sie vornehmlich aus der Schule von Montpellier hervorgingen und die Encyclopédie prägten.
Strom der Popularisierung
In seiner Beschreibung des Siegeszuges der Hygiene im 19. Jahrhundert setzt Sarasin überraschende neue Akzente. Er vertritt zum einen die These, dass es eben nicht die Wissenschaft der Physiologie mit ihrer Fachsprache war, die den entscheidenden Beitrag zur Konstruktion des modernen Körpers leistete. Er schreibt diese Leistung vielmehr dem verästelten, populärwissenschaftlich formulierten und distribuierten hygienischen Wissen zu, das mit seiner humoralpathologischen Grundstruktur und seiner Anpassungsfähigkeit auch für neue physiologische Erkenntnisse sowie mit seiner medizinkritischen Betonung gesundheitlicher Selbstregulation letztlich die alltagsmächtigste Wissensform darstellte.
Es ist die Assoziation der Hygienebewegung mit dem beispiellosen, insbesondere die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts auszeichnenden breiten Strom der Wissenspopularisierung, die jene Gesundheitsrevolution einleitete, von der die neuere Medizingeschichte plausibel behauptet hat, sie habe die der Bakteriologie eines Pasteur und Koch lange Zeit zugeschriebenen Volksgesundheits-Effekte der Mikrobenbekämpfung weitgehend vorweggenommen. Aber auch hier konfrontiert uns Sarasin mit dem Paradox der „langsamen Wiederkehr des Wassers”. Seine sich auf und an der Haut abspielende Geschichte des Waschens, die conquête de l'eau (Goubert) im 19. Jahrhundert steht hier exemplarisch dafür, dass man sich mit Gewinn der unfreiwilligen Teleologie des Diskurszwanges, der so viele Diskursgeschichten begleitet, widersetzen kann.
Sarasins ausgedehnter Streifzug durch die Bade- und Waschliteratur der Hygieniker Frankreichs und Deutschlands kulminiert in der Beobachtung, dass die endlose Debatte übers Baden den späten Veränderungen der Praxis der realen Reinigung des Körpers beziehungsweise den Veränderungen von Sauberkeitsstandards, Geruchsempfindlichkeiten und Schicklichkeitsnormen weit vorausgegangen ist (301-309). Jedenfalls weiß Alfred Becquerel 1851 in seinem „Traité d'hygiène publique et privée” zu berichten, dass im nachrevolutionären Paris um 1816 gerade einmal 500 öffentliche Badewannen existierten. Nach allem, was über den Einbau von Bädern in Privatwohnungen bekannt ist, war die Badewanne jedenfalls im privaten Haus auch am Ende des 19. Jahrhunderts noch eine Seltenheit und ein Luxus, den sich nur die Wohlhabenden leisteten.
Angler an Redeflüssen
Ob es sich um „Struktur, Kontext und Materialität des hygienischen Diskurses”, um die Semiotik des bürgerlichen Körpers, um Haut, Muskel und Nerven oder um den gefährlichen Sex, die Beherrschung und die Herrschaft der spermatischen Ökonomie handelt: Sarasin betont immer wieder, dass seine Art der Diskursgeschichte, die weder eine Geschichte materieller Alltagskultur noch eine Sozialgeschichte der Körperpflege darstellt, sondern eine Geschichte des öffentlichen Sprechens über den Körper und die Wirkungen, die dieses Sprechen zeitigt, dass diese Geschichte weniger an der schließenden als vielmehr an der öffnenden Funktion von solchen „Redeströmen” (Gugerli) interessiert ist: „Die Hygieniker des 19. Jahrhunderts öffneten den diskursiven Raum für die subjektive Freiheit, sich als ‘anders‘ als andere wahrzunehmen, ‘selbstverantwortlich‘ mit sich umzugehen und zwischen verschiedenen Verhaltensweisen eine Wahl zu treffen. Das heißt, sie boten nicht nur Normalisierungswissen, sondern auch ‘Individualisierungswissen‘ für den Körper des Subjekts.” So tritt neben die diachronen Vorläufe und Nachträglichkeiten die synchrone Koexistenz des sich scheinbarer Ausschließenden.
Sarasin weiß seine Geschichte der Bedrohung des Subjekts, seine Geschichten von Mäßigung und Unmäßigkeit, von Kontrolle und Exzess in jener spezifischen Form von Technologien des Selbst darzustellen, die ihre Kategorien entschieden vom Körper her definierten – einem reizbaren Körper, dessen Gleichgewicht es zu erhalten galt. Sie schieben sich zwischen den von der Logik der Unkeuschheit gezeichneten christlichen Körper und den „um sein Begehren kreisenden” psychoanalytischen Körper. Vor allem aber sieht er den „hygienischen” Körper des 19. Jahrhunderts eher als ein verzögertes, spätes Produkt der Aufklärung denn als Vorboten jener brave new world, die die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts beherrschen sollte: „Ich neige dazu, im Auftauchen der Eugenik oder vielmehr der Rassenhygiene gegen Ende des 19. Jahrhunderts eine wirkliche Diskontinuität zu sehen. Mit ihrem Auftauchen erlitt der klassisch moderne Glaube an die perfectibilité de l'homme – verstanden als Individuum – einen Einbruch. Dieser ist so tief greifend, dass in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts die kalte Ethik des ‘Volkskörpers‘ oder der ‘Rasse‘ die aufklärerischen Ideale mit neuen, harten und scheinbar wissenschaftlichen Argumenten verdrängten.”
HANS-JÖRG RHEINBERGER
PHILIPP SARASIN: Reizbare Maschinen. Eine Geschichte des Körpers 1765–1914. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2001. 509 Seiten, 33,90 Mark.
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.diz-muenchen.de

Philipp Sarasin spürt der bürgerlichen Erkundung des eigenen Körpers nach / Von Klaus Ungerer
Die Brüder, die Gleichen, sie stanken. Sie hatten die Festung gestürmt und geschminkte Häupter gefällt, sie standen im Zentrum der Macht - und stanken. Sie standen auf den Zinnen oder wo sonst siegreiche Klassen zu stehen pflegen, sie hoben die Arme zum Himmel, und gleichzeitig gingen auch die Nüstern pikiert aufwärts: Was riecht es denn hier so komisch? Das sind doch nicht etwa . . .? Wenn man denn einen braucht, war dies der Beginn der Moderne. Mit dem Sieg der Revolution stellte das Bürgertum sich selbst an die Nasenwand: Der Geruch, das bin ich. Höchste Zeit, einen verkommenen Besitz zu prüfen. Den eigenen Körper. Ihn abzustoßen fiel schwer, gut oder übel - das Ding mußte inventarisiert, geprüft, optimiert werden. Daß dies nicht längst schon geschah!
Ein wenig an Vorarbeit war allerdings doch schon erledigt, mindestens mal die Herren Hippokrates und Galen hatten erste Erkundungsschritte getan, deren Spuren sich folgen ließ. Insonderheit Galens Konzept der "sex res non naturales" hatte im mittelalterlich-magischen Gewand die Zeiten überdauert und Eingang in die Hygienetheorie gefunden. Folgender sechs Dinge weiser Verwalter sollte seinen Körper vor Krankheiten schützen können: Licht und Luft; Essen und Trinken; Bewegung und Ruhe; Wachen und Schlafen; Ausscheidungen; Gemütsbewegungen. Viel mehr als Vorbeugung sah die neohippokratische Medizin des achtzehnten Jahrhunderts nicht vor.
Im achtzehnten Jahrhundert setzt Philipp Sarasin mit seinem Buch "Reizbare Maschinen" ein, von da an sieht er zu, wie bürgerliches Denken und Handeln den Körper des Menschen erobert. Bei Friedrich Hoffmann gibt es keinen Naturzustand als Ideal, man sehe sich doch die maroden niederen Klassen mal an. Der eigene Leib soll nun kultiviert und vor jedem Exzeß bewahrt werden. Hoffmanns Leser ißt nicht bis zum Platzen. Er kalkuliert und wählt aus.
Für die Hygieniker war der Körper letztlich einer Maschine vergleichbar, die instand gehalten werden sollte, ehe es zu Fehlfunktionen käme. Als solche entworfen, überstand er sogar Vitalismus und Naturphilosophie. Eine Lebenskraft, mithin Seele, wurde von interessierten Kreisen zwar angemahnt, Seelenlosigkeit aber setzte sich durch. Anders ließ sich die Vivisektion jener Zeit wohl auch kaum überstehen. Albrecht von Haller zerpflückte und schnitt Tiere auf, um ihre Organe virtuos zu reizen: mit Nadeln, Zangen, Messern, Säure. Er entnahm Hirne, er entnahm Herzen und ließ sie auf dem Tische weiterpochen. Fazit des Mannes: "Die Wirkung des Willens und des Skalpells ist dieselbe." Ableitung für die Hygieniker via John Brown: Der Körper als solcher ist irritabel, das Leben ein Erregungszustand zwischen zu starken und zu schwachen Reizen. Es galt nun also, die Mitte zu finden, das rechte Maß. Planung tat not, der Körper mußte eine Verfassung erhalten "gleichwie derjenige, welcher in einer republique die heilsamen Gesetze und Statuta in acht nimmt, sich glückseelig machet". So sah es Hoffmann.
Glückseligkeit also winkte ihm, der die Regeln befolgte. Jedoch und aber: Wo standen denn die? Beginnen wir harmlos: Wieviel Essen braucht der Mensch? Darf sein Plaisir ihm als Ratgeber dienen? Unbedingt, meinte 1827 Charles Londe, die "süße und zuweilen fordernde Stimme der Lust" war ihm ein Reiz, dem zu folgen sei. Doch mahnten andere Stimmen: Zwar werde einem Einzelorgan so meistens Genüge getan, wo jedoch blieben die anderen? Es sei durch Regulierung Sorge zu tragen, "daß abgesehen davon die anderen Organe des Körpers gleichzeitig ihre vollständige Freiheit und Integrität bewahren". Hallé, der so sprach, war ganz zweifellos Republikaner. Ihm und anderen Dämpfern kam die Wissenschaft weiter zur Hilfe: Ließ das Frommen des Menschen sich nicht herleiten aus der Thermodynamik? Friedrich Erismann wußte 1879: "Der erwachsene Mensch entwickelt täglich etwa 3 Millionen Wärmeeinheiten." Wie er also befüllt werden muß, hatte Lorenz Sonderegger schon fünf Jahre vorher berechnet: "Eiweißstoffe (Fleisch), Eier, Käse, Kleber oder Legumin 130 Grammes, Fett (in Fleisch, Butter, Oel) 100" . . ., "zusammen also 3640 Grammes." Doch wie ließ sich solch gebieterische Präzision mit Rahel Varnhagen vereinbaren? "Ich verlange ein besonderes, persönliches Schicksal", schrieb sie 1831 an den Fürsten Pückler-Muskau. "Ich will allein, an meinen Übeln sterben, das bin ich; mein Karakter, meine Person, mein Physisches, mein Schicksal."
Der Individualisierung entgingen die Hygieniker nicht, auch wenn sie nach Normierung suchten. Schon das uralt bewährte Modell der vier Säfte und Temperamente hatte seit jeher eine Einzelbehandlung der Menschen nahegelegt: Der denkbaren Mischungen gab es unendlich viele. Auch hatte die neuzeitliche Vermessungstätigkeit den Menschen einerseits seines Leibes entfremdet, ihn andererseits auch ins Bewußtsein gehoben: Dieser Körper gehört mir. Und während die Medizin das Individuum aus dem Blick zu verlieren begann, um sich mit defekten Einzelteilen zu beschäftigen, blieb in der Hygienetheorie der Mensch noch lange als Gesamtheit erhalten.
Was die Hygieniker dachten und schrieben, wurde nicht nur in eingeweihten Zirkeln herumgereicht, sondern nachhaltig multipliziert: Das fallende neunzehnte Jahrhundert war die große Zeit der Populärwissenschaft. Als Gottes Autorität dahinschied, wurden neue Gewißheiten gerne genommen, die das damals noch ewige Naturgesetz bot. Die nüchterne Sprache, zu der die Fachwelt im Angesicht der heiklen Thematik griff, wurde prägend für das Verhältnis der Menschen zu ihren Körpern. Eine Sache aber gab es, über die sich auch dem besten Willen zum Trotz lange Zeit überhaupt nicht reden ließ: jene Delikatesse, die mancher schlicht "Körperlichkeit" nennt.
Die Theorien des Hygienikers Alexandre Parent-Dechâtelet erleichterten immerhin den spezifisch männlichen Zugang zum Sex: Der Säftehaushalt, so wurde argumentiert, gerate in Unordnung, stelle man dem starken Geschlecht kein Bordell zur Verfügung. Der neuen Erkenntnis beugten sich auch die Amtshengste des frühen neunzehnten Jahrhunderts und genehmigten Etablissements als seminale Entsorgungsanlagen. Hier hatte die Hygienetheorie also eingewirkt in den Gang der Welt, umgekehrt aber fanden die Fakten des Lebens nur sehr zögerlich Zutritt zur Verbalisierung. Hauchzart über die eigenen Leser in Sorge, schrieben Buchez und Trélat 1825: "Wir werden hier ganz sicher keine Darstellung des Geschlechtsverkehrs liefern." Es mußten noch einige Jahre ins Land gehen, ehe ein Vorgang, den ein anständiger Mensch als unappetitlich zu empfinden bemüht sein mußte, endlich auch unter der Lupe der Hygieniker lag.
Auguste Debay benannte und beschrieb als erster, was es an nie bemerkten Organen und Vorgängen gab, man schrieb das revolutionäre Jahr 1848, Debays Buch über die Ehehygiene verkaufte sich bis 1888 in 172 Auflagen. Nun gab es bürgerlichen Geschlechtsverkehr bis hin zum Klitoralvergnügen, das, Morgensterns Imperativ folgend, bis dahin nicht vorhanden war. Nun gerieten Begriffe ins Wanken, offenkundig gab es auch Sex außerhalb der Fortpflanzung, gab es Lust, sogar für Frauen. Den Hygienikern war hier ein neues Problem erwachsen, das nach bewährtem Muster bearbeitet werden mußte: Wieviel ist zuviel? Wieviel zuwenig? Was will die Lust uns sagen?
Sie wurde oft als Bedrohung empfunden oder war zumindest verdächtig. Nicht nur die Wissenschaft nahm sich ihrer an, Autoren wie Wedekind, Hugo oder Michelet führten über Jahre hinweg Buch über ihre Vereinigungen und Vereinsamungen. Sexueller Ausschweif wurde zumindest rhetorisch gestraft. "Der Arzt kann nur warnen", las man, und einiges wurde fürs Lottern in Aussicht gestellt: Impotenz, Nervenschwäche, Müdigkeit, Reizbarkeit, Traurigkeit, Neurosen, "Krankheiten des Gehirns und des Rückenmarks", Gliederzittern, Lähmung und Nervenerweichung, Nekrophilie. Nur eines war schlimmer: die Masturbation.
Für Philipp Sarasin ist die Sexualfurcht des neunzehnten Jahrhunderts und der Jahrhundertwende der Reflex einer Gesellschaftsordnung im Umbruch. Den Konflikt zwischen Lust und Ratio deutet er als verlängerten Geschlechterkampf: "Die Onanieangst spricht von der Suprematie des männlichen Gehirns über die ,weiblichen' Nerven und damit schließlich von der Kontrolle der Lust im Ehebett und im Bordell." So verknüpft er Irritationsmomente wie die grassierende Syphilisfurcht und die aufkeimende Frauenbewegung mit der Neurasthenie, die zur Jahrhundertwende eine regelrechte Modekrankheit war. Die Selbstwahrnehmung eines Patienten erscheint uns heute als Ergebnis einer Autosuggestion, die die Warnungen der frühen Sexualkundler erlebbar gemacht hat: "Seitdem konnte ich ganz genau wahrnehmen", gab ein Onanieopfer zu Protokoll, "wie die einzelnen Nerven sich loslösten und teils ins Rückenmark und in den Magen flossen. So muß ich sehen, wie mein Körper bereits bis auf einen kleinen Teil abgestorben ist, was sich deutlich in dem Verwesungsgeruch bemerkbar macht."
Wie es begann, endete das bürgerliche neunzehnte Jahrhundert also auch: mit schlechtem Geruch. Um 1900 meldete die Nase einen unrettbaren Verfall, wo sie gut hundert Jahre zuvor ein Signal zum Aufbruch gegeben hatte. Der fand nur sehr zögerlich statt. Widerstrebend begann das Bürgertum, sich zu waschen. Es war dies eine Verrichtung, die epochenlang in allen Klassen vergessen worden war. Sie durchzusetzen, war Überzeugungsarbeit geboten. Noch 1875 erschien in Boulogne-sur-Mer ein Büchlein, das den Leser mit viel gutem Zureden in die Wanne bugsieren wollte. Die "crasse" wurde geschildert, eine Hautumhüllung aus dem Dreck der Jahrhunderte, es wurde zum Rubbeln geraten und vor bösen Überraschungen gewarnt: "Man muß nun auch mit den Fingern zwischen den Zehen hindurchfahren, wo es noch viel mehr ,crasse' hat, die extrem übel riecht, vor allem, wenn sie schon lange hier ist." Im Vorwort schon stand die Warnung: "Um sich so zu reinigen, braucht es Mut." Der Lohn der Arbeit war ein weiteres Stück zukunftsweisender Individualhygiene: So ist's fein, meine Haut ist rein, soll niemand drin wohnen als ich ganz allein.
Philipp Sarasin: "Reizbare Maschinen". Eine Geschichte des Körpers 1765-1914. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2001. 510 S., br., 33,90 DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
"Philipp Sarasins Untersuchung beginnt ihre Geschichte des Körpers mit der Geschichte des Bürgerlichen Zeitalters. Als Initiationserlebnis eines neuen Körperverständnisses zitiert der Rezensent Klaus Ungerer eine erstaunliche Entdeckung der Französischen Revolution: "Die Brüder, die Gleichen, sie stanken". Von hier nimmt die Inventarisierung des Körpers ihren Ausgang, erzählt wird die Geschichte der Körperhygieniker, in deren Auffassungen sich manch Politisches spiegelt: von der Forderung nach einer "Verfassung" für den Körper zur Gleichberechtigung der Organe. Ungerer betont die Konflikte zwischen Normierung und Individualisierung, berichtet über den schwierigen und dornenreichen Weg bis zur relativ unbefangenen Rede über Sexualität. Zögerlich auch ließ sich das Bürgertum dazu überreden, gelegentlich wenigstens mit Wasser und Badewannen in Berührung zu kommen: "Um sich so zu reinigen, braucht es Mut", heißt es übers Wannenbad noch im Jahr 1875. Eine Wertung des Buchs und seiner, neben begeistert nacherzählten Beispielen offenbar auch vorhandenen Thesen nimmt der Rezensent nicht vor - die Lektüre scheint ihm aber Vergnügen bereitet zu haben.
© Perlentaucher Medien GmbH"
© Perlentaucher Medien GmbH"