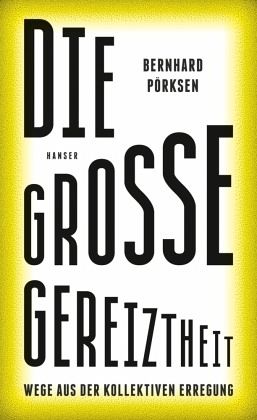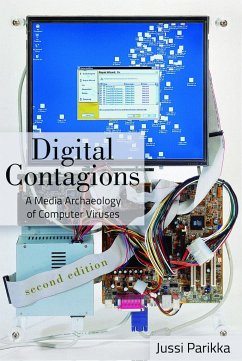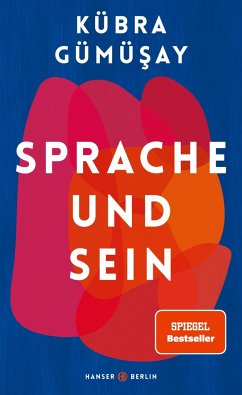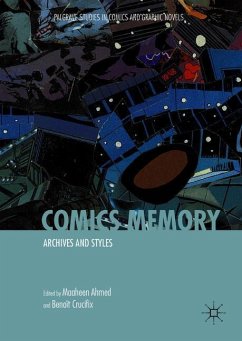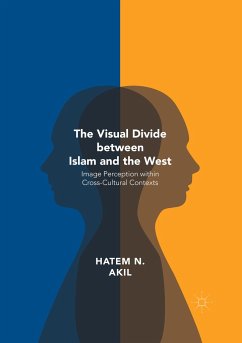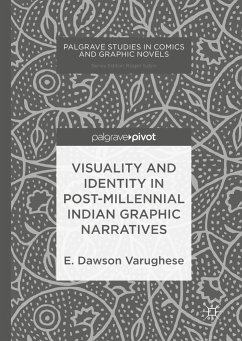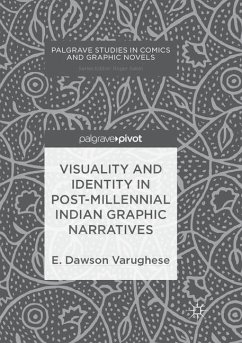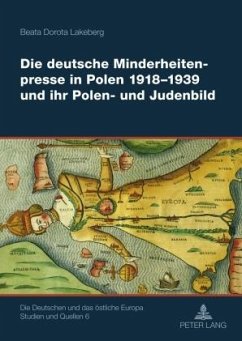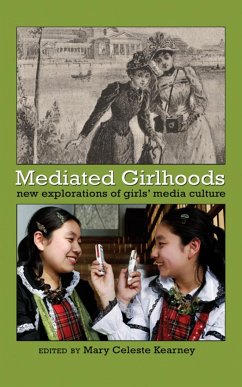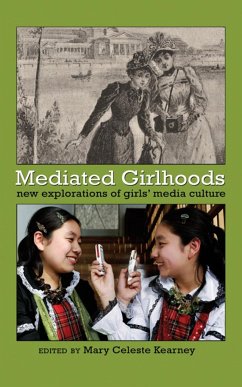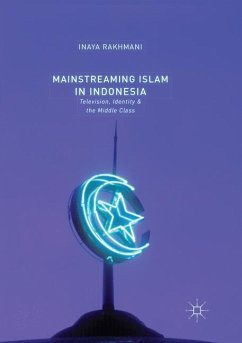Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Weitere Ausgaben:





Terrorwarnungen, Gerüchte, die Fake-News-Panik, Skandale und Spektakel in Echtzeit - die vernetzte Welt existiert längst in einer Stimmung der Nervosität und Gereiztheit. Bernhard Pörksen analysiert die Erregungsmuster des digitalen Zeitalters und beschreibt das große Geschäft mit der Desinformation. Er führt vor, wie sich unsere Idee von Wahrheit, die Dynamik von Enthüllungen und der Charakter von Debatten verändern. Heute ist jeder zum Sender geworden, der Einfluss etablierter Medien schwindet. In dieser Situation gehört der kluge Umgang mit Informationen zur Allgemeinbildung und s...
Terrorwarnungen, Gerüchte, die Fake-News-Panik, Skandale und Spektakel in Echtzeit - die vernetzte Welt existiert längst in einer Stimmung der Nervosität und Gereiztheit. Bernhard Pörksen analysiert die Erregungsmuster des digitalen Zeitalters und beschreibt das große Geschäft mit der Desinformation. Er führt vor, wie sich unsere Idee von Wahrheit, die Dynamik von Enthüllungen und der Charakter von Debatten verändern. Heute ist jeder zum Sender geworden, der Einfluss etablierter Medien schwindet. In dieser Situation gehört der kluge Umgang mit Informationen zur Allgemeinbildung und sollte in der Schule gelehrt werden. Medienmündigkeit ist zur Existenzfrage der Demokratie geworden.
Bernhard Pörksen, Jahrgang 1969, ist Professor für Medienwissenschaft an der Universität Tübingen und bekannt durch seine Arbeiten zur Skandalforschung (u.a. Der entfesselte Skandal, mit H. Detel) sowie seine Bücher mit dem Kybernetiker Heinz von Foerster und dem Psychologen Friedemann Schulz von Thun. Bei Hanser erschien: Die große Gereiztheit. Wege aus der kollektiven Erregung (2018) und Die Kunst des Miteinander-Redens. Über den Dialog in Gesellschaft und Politik (mit Friedemann Schulz von Thun, 2020).
Produktdetails
- Verlag: Hanser
- Artikelnr. des Verlages: 505/25844
- 4. Aufl.
- Seitenzahl: 256
- Erscheinungstermin: 13. Februar 2018
- Deutsch
- Abmessung: 210mm x 133mm x 22mm
- Gewicht: 372g
- ISBN-13: 9783446258440
- ISBN-10: 3446258442
- Artikelnr.: 49463986
Herstellerkennzeichnung
Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.
 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 10.03.2018
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 10.03.2018Mit ewiger Skepsis in die endlose Debatte
Ein Tweet kann ein Leben für immer zerstören: Bernhard Pörksen will die Dauererregung im Internet mit den Tugenden des Journalismus einhegen.
Von Thomas Thiel
Dass das Internet in seiner gegenwärtigen Form keinen guten Einfluss auf liberale und demokratische Gesellschaften ausübt, ist mittlerweile vielfach beschrieben und wird selbst von Verantwortlichen wie den Netzwerkbetreibern kaum noch bestritten. Es gibt diesbezüglich eine Reihe profunder Analysen, die am Ende jedoch, was kein Vorwurf ist, mehr oder weniger tastend nach einer Lösung suchen. Da macht es hellhörig, wenn der Medientheoretiker Bernhard Pörksen in seinem neuen Buch verspricht, sich nicht mit
Ein Tweet kann ein Leben für immer zerstören: Bernhard Pörksen will die Dauererregung im Internet mit den Tugenden des Journalismus einhegen.
Von Thomas Thiel
Dass das Internet in seiner gegenwärtigen Form keinen guten Einfluss auf liberale und demokratische Gesellschaften ausübt, ist mittlerweile vielfach beschrieben und wird selbst von Verantwortlichen wie den Netzwerkbetreibern kaum noch bestritten. Es gibt diesbezüglich eine Reihe profunder Analysen, die am Ende jedoch, was kein Vorwurf ist, mehr oder weniger tastend nach einer Lösung suchen. Da macht es hellhörig, wenn der Medientheoretiker Bernhard Pörksen in seinem neuen Buch verspricht, sich nicht mit
Mehr anzeigen
kleinen Schritten zufriedenzugeben.
Pörksen beschreibt das Internet als großen Verzerrer, der alle Filter und Formen, die für das Private wie das Politische notwendig sind, auflöst, das Unterste nach oben spült und gewohnte Rollenbilder durcheinanderwirbelt. Eine irische Schülerin, die von ihrer Schulkantine mit einer Krokette abgespeist wurde, kann so zum globalen Medienereignis werden, auch wenn der Fall über die Qualität der irischen Schulkost wenig aussagt. Ein harmloser Tweet kann einer amerikanischen Touristin Job und Reputation kosten. Und ein amerikanischer Absolvent, der für ein prahlerisches Bewerbungsvideo weltweit verlacht wurde, kann spurlos verschwinden, ohne dass sich seine Jäger dann noch für ihn interessieren.
Für Pörksen sind das keine Einzelereignisse, sondern Symptome einer generellen Verzerrung. "Das Geschehen auf dem Planeten", schreibt er, erscheint heute "als eine Hitliste des Merkwürdigen, Bizarren, Aufregenden." Dass diese Verschiebung schlecht für demokratische Gesellschaften ist, die nicht vom Spaß am Schrägen, sondern vom geteilten Interesse am Allgemeinen leben, versteht sich von selbst. Der Gedanke politischer Repräsentation wird, wie Pörksen darstellt, schon auf persönlicher Ebene geschliffen.
Politiker und andere Funktionsträger werden in den Internet-Mahlstrom gerissen und an politisch irrelevanten Charakterfehlern gemessen werden. Ein Ministerpräsident stibitzt einen Kugelschreiber, einem anderem sitzt die Hose schief, ein Nobelpreisträger macht einen dummen Spruch, das Netz schaut zu und hält Gericht, ohne dass sich einer der Beteiligten dafür verantworten müsste. Hinterher ist man enttäuscht über den allgemeinen Verlust von Autorität und Aura. Der Politikertypus, der aus dem Beobachtungsstress hervorgeht, baut darauf, dass seine Wähler verminderte Konsistenzansprüche an seine Politik stellen.
Mit dem Titel "Die große Gereiztheit" greift Pörksen eine Kapitelüberschrift aus Thomas Manns "Zauberberg" auf. Mann beschrieb eine kränklich-nervöse Gesellschaft, die auf den Weltkrieg zusteuert, wozu neben politischen Spannungen und geistigen Umbrüchen die beginnende Verkabelung des Globus beitrug. Heute sind die Nerven der Menschheit nach außen gewandert, schreibt Pörksen mit Marshall McLuhan, und bilden eine elektrische Umwelt. Fast jeder wird in einen Weltbewusstseinsstrom hineingezogen und fühlt sich, weil die Zuschreibungen so unklar sind, vom Weltgeschehen nicht nur pausenlos bedrängt, sondern auch in einer diffusen Weise verantwortlich gemacht. Der Rückzug in Filterblasen bietet dagegen keinen Schutz, sondern führt, off- wie online, zum umso härteren Zusammenprall der Weltsichten. Wer wagt sich da noch nach draußen?
Pörksen will sich das Engagement nicht nehmen lassen. Weniger überzeugend als seine Analyse ist allerdings sein Lösungsvorschlag, die konkrete Utopie einer redaktionellen Gesellschaft. Weil das Netz die Unterteilung zwischen Experten und Laien nicht treffe, so der Vorschlag, soll Journalismus zur allgemeinen Lebensform werden oder journalistische Prinzipien wie generalisierte Skepsis und Wahrheitssuche "im Bewusstsein der Vorläufigkeit" zumindest von jedem verinnerlicht und praktiziert werden.
Am Wert dieser Kompetenzen ist nicht zu zweifeln. In spezialisierten Gesellschaften gibt es aber immer noch andere dringende Beschäftigungen. Wenn der Appell nicht ins Leere gehen soll, wären die Grenzen der journalistischen Nebentätigkeit zu klären. Pörksen kokettiert stattdessen mit dem Vorurteil, dass Journalisten ihrem Publikum permanent im Modus der Herablassung begegnen und Kommunikation niemals im Interesse journalistischer Qualität begrenzen. Weshalb er sie dazu bringen will, Lesern und Zuschauern in einem "großen Gespräch" Rede und Antwort zu stehen, sie in die tägliche Arbeit einzubeziehen.
Das wurde schon mehrfach durchgespielt mit Leserreportern, Bloggern, Dialog-Redaktionen und ist jedes Mal ein Misserfolg gewesen: zu viel Rauschen, zu wenig Verlässlichkeit. Jetzt also noch einmal, mit noch mehr Schwung und Emphase? Der Dauerdiskurs, der Pörksen vorschwebt, läuft letztlich auf eine weitere Form der Permanenz hinaus, ein ewiges Debattieren an zahllosen Orten. Einer dieser Orte soll die Schule sein. Gegen Medienaufklärung im Unterricht lässt sich schwer etwas einwenden. Wer wie Pörksen aber gleich ein Schulfach Medienethik fordert, sollte auch sagen, welches er dafür streichen will und ob sich Schüler drei, fünf oder zwölf Jahre lang mit der medialen Produziertheit von Information beschäftigen sollen. Letzteres wäre dann doch ermüdend.
Was die Spielräume juristischer Regulierung betrifft, ist Pörksen knapper. Das Recht ist für ihn nur das letzte Mittel und soll die leidenschaftliche Debatte nicht ersticken. Der von Pörksen geforderte digitale Plattform-Rat ist ohne Sanktionsmacht ein stumpfes Schwert. Die härtere Nuss ist die Durchsetzung von Rechtsansprüchen gegenüber den Plattformen. Pörksen will deren Betreiber notfalls gerichtlich zu Transparenz zwingen. Wie das gelingen soll, hätte man gern genauer erfahren. Widerstandslos werden die Konzerne ihr Erfolgsgeheimnis nicht preisgeben. In jedem Fall scheint Strukturbildung das aussichtsreichere Mittel als rhetorische Entgrenzung. Dass große Wir aus unverbundenen Diskursteilnehmern verstärkt ja nur das ausführlich beschriebene Problem - das kenntnislose Mitreden.
Bernhard Pörksen: "Die große Gereiztheit". Wege aus der kollektiven Erregung.
Hanser Verlag, München 2018. 256 S., geb., 22,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Pörksen beschreibt das Internet als großen Verzerrer, der alle Filter und Formen, die für das Private wie das Politische notwendig sind, auflöst, das Unterste nach oben spült und gewohnte Rollenbilder durcheinanderwirbelt. Eine irische Schülerin, die von ihrer Schulkantine mit einer Krokette abgespeist wurde, kann so zum globalen Medienereignis werden, auch wenn der Fall über die Qualität der irischen Schulkost wenig aussagt. Ein harmloser Tweet kann einer amerikanischen Touristin Job und Reputation kosten. Und ein amerikanischer Absolvent, der für ein prahlerisches Bewerbungsvideo weltweit verlacht wurde, kann spurlos verschwinden, ohne dass sich seine Jäger dann noch für ihn interessieren.
Für Pörksen sind das keine Einzelereignisse, sondern Symptome einer generellen Verzerrung. "Das Geschehen auf dem Planeten", schreibt er, erscheint heute "als eine Hitliste des Merkwürdigen, Bizarren, Aufregenden." Dass diese Verschiebung schlecht für demokratische Gesellschaften ist, die nicht vom Spaß am Schrägen, sondern vom geteilten Interesse am Allgemeinen leben, versteht sich von selbst. Der Gedanke politischer Repräsentation wird, wie Pörksen darstellt, schon auf persönlicher Ebene geschliffen.
Politiker und andere Funktionsträger werden in den Internet-Mahlstrom gerissen und an politisch irrelevanten Charakterfehlern gemessen werden. Ein Ministerpräsident stibitzt einen Kugelschreiber, einem anderem sitzt die Hose schief, ein Nobelpreisträger macht einen dummen Spruch, das Netz schaut zu und hält Gericht, ohne dass sich einer der Beteiligten dafür verantworten müsste. Hinterher ist man enttäuscht über den allgemeinen Verlust von Autorität und Aura. Der Politikertypus, der aus dem Beobachtungsstress hervorgeht, baut darauf, dass seine Wähler verminderte Konsistenzansprüche an seine Politik stellen.
Mit dem Titel "Die große Gereiztheit" greift Pörksen eine Kapitelüberschrift aus Thomas Manns "Zauberberg" auf. Mann beschrieb eine kränklich-nervöse Gesellschaft, die auf den Weltkrieg zusteuert, wozu neben politischen Spannungen und geistigen Umbrüchen die beginnende Verkabelung des Globus beitrug. Heute sind die Nerven der Menschheit nach außen gewandert, schreibt Pörksen mit Marshall McLuhan, und bilden eine elektrische Umwelt. Fast jeder wird in einen Weltbewusstseinsstrom hineingezogen und fühlt sich, weil die Zuschreibungen so unklar sind, vom Weltgeschehen nicht nur pausenlos bedrängt, sondern auch in einer diffusen Weise verantwortlich gemacht. Der Rückzug in Filterblasen bietet dagegen keinen Schutz, sondern führt, off- wie online, zum umso härteren Zusammenprall der Weltsichten. Wer wagt sich da noch nach draußen?
Pörksen will sich das Engagement nicht nehmen lassen. Weniger überzeugend als seine Analyse ist allerdings sein Lösungsvorschlag, die konkrete Utopie einer redaktionellen Gesellschaft. Weil das Netz die Unterteilung zwischen Experten und Laien nicht treffe, so der Vorschlag, soll Journalismus zur allgemeinen Lebensform werden oder journalistische Prinzipien wie generalisierte Skepsis und Wahrheitssuche "im Bewusstsein der Vorläufigkeit" zumindest von jedem verinnerlicht und praktiziert werden.
Am Wert dieser Kompetenzen ist nicht zu zweifeln. In spezialisierten Gesellschaften gibt es aber immer noch andere dringende Beschäftigungen. Wenn der Appell nicht ins Leere gehen soll, wären die Grenzen der journalistischen Nebentätigkeit zu klären. Pörksen kokettiert stattdessen mit dem Vorurteil, dass Journalisten ihrem Publikum permanent im Modus der Herablassung begegnen und Kommunikation niemals im Interesse journalistischer Qualität begrenzen. Weshalb er sie dazu bringen will, Lesern und Zuschauern in einem "großen Gespräch" Rede und Antwort zu stehen, sie in die tägliche Arbeit einzubeziehen.
Das wurde schon mehrfach durchgespielt mit Leserreportern, Bloggern, Dialog-Redaktionen und ist jedes Mal ein Misserfolg gewesen: zu viel Rauschen, zu wenig Verlässlichkeit. Jetzt also noch einmal, mit noch mehr Schwung und Emphase? Der Dauerdiskurs, der Pörksen vorschwebt, läuft letztlich auf eine weitere Form der Permanenz hinaus, ein ewiges Debattieren an zahllosen Orten. Einer dieser Orte soll die Schule sein. Gegen Medienaufklärung im Unterricht lässt sich schwer etwas einwenden. Wer wie Pörksen aber gleich ein Schulfach Medienethik fordert, sollte auch sagen, welches er dafür streichen will und ob sich Schüler drei, fünf oder zwölf Jahre lang mit der medialen Produziertheit von Information beschäftigen sollen. Letzteres wäre dann doch ermüdend.
Was die Spielräume juristischer Regulierung betrifft, ist Pörksen knapper. Das Recht ist für ihn nur das letzte Mittel und soll die leidenschaftliche Debatte nicht ersticken. Der von Pörksen geforderte digitale Plattform-Rat ist ohne Sanktionsmacht ein stumpfes Schwert. Die härtere Nuss ist die Durchsetzung von Rechtsansprüchen gegenüber den Plattformen. Pörksen will deren Betreiber notfalls gerichtlich zu Transparenz zwingen. Wie das gelingen soll, hätte man gern genauer erfahren. Widerstandslos werden die Konzerne ihr Erfolgsgeheimnis nicht preisgeben. In jedem Fall scheint Strukturbildung das aussichtsreichere Mittel als rhetorische Entgrenzung. Dass große Wir aus unverbundenen Diskursteilnehmern verstärkt ja nur das ausführlich beschriebene Problem - das kenntnislose Mitreden.
Bernhard Pörksen: "Die große Gereiztheit". Wege aus der kollektiven Erregung.
Hanser Verlag, München 2018. 256 S., geb., 22,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Schließen
"Pörksens luzide Analyse gehört zu den Büchern der Stunde". Michael Kluger, Frankfurter Neue Presse, 06.03.18
"All das ist ebenso spannend wie nachvollziehbar zu lesen, weil Pörksen zwar das Besteck der Medientheorie zu benutzen versteht, doch stets eng verbunden bleibt mit dem konkreten Geschehen, mit Beispielen, mit Fällen (...) Gäbe es mehr Experten vom Rang Pörksens, wäre die Debatte vermutlich schon weiter - sachlicher nämlich." Tim Schleider, Stuttgarter Zeitung, 19.02.18
"Pflichtlektüre für alle, die wach durch Leben und Zeit gehen wollen." Otto Friedrich, Die Furche, 22.02.18
"Die große Gereiztheit" ist keine trockene Wissenschaftsprosa, sondern ein 256 Seiten langer Essay auf höchstem Niveau der Analyse,
"All das ist ebenso spannend wie nachvollziehbar zu lesen, weil Pörksen zwar das Besteck der Medientheorie zu benutzen versteht, doch stets eng verbunden bleibt mit dem konkreten Geschehen, mit Beispielen, mit Fällen (...) Gäbe es mehr Experten vom Rang Pörksens, wäre die Debatte vermutlich schon weiter - sachlicher nämlich." Tim Schleider, Stuttgarter Zeitung, 19.02.18
"Pflichtlektüre für alle, die wach durch Leben und Zeit gehen wollen." Otto Friedrich, Die Furche, 22.02.18
"Die große Gereiztheit" ist keine trockene Wissenschaftsprosa, sondern ein 256 Seiten langer Essay auf höchstem Niveau der Analyse,
Mehr anzeigen
der Differenzierung und der geschliffenen Sprache. Viele treffende Beispiele veranschaulichen das Gesagte. Und wie immer prägt Pörksen neue Begriffe, die seine Erkenntnis auf den Punkt bringen. Es ist ein Markenzeichen des Medienwissenschaftlers in der Medienwelt." Gernot Stegert, Schwäbisches Tagblatt, 19.02.18
"Exzellente Medienforschung, die mit vielen Geschichten vom "Kulturbruch der Digitalisierung" erzählt, die weder Angst schürt, noch Euphorie fliegen lässt und die - das ist der eigentliche Gewinn - Thesen formuliert, wie Journalismus jeden einzelnen, die Gesellschaft und die Demokratie retten kann." Paul-Josef Raue, kressNews, 19.02.18
"Ein eindringliches Plädoyer für eine Bildungsoffensive, die auf den medienmündigen Bürger zielt." Gunther Hartwig, Südwestpresse, 06.03.18
"Pörksen analysiert klug. Ein lesenswertes, anspruchsvolles Buch." enorm, 3/4 2018
"Ein sehr kluges und nachdenkliches Buch über die Auswirkungen der digitalen Gesellschaft vor (...) Wer besser verstehen will, wie soziale Medien und Netzdiskurse funktionieren, kommt an diesem Buch, das den Weg von der Medien- zur Empörungsdemokratie nachzeichnet, nicht vorbei." Jürgen Nielsen-Sikora, Glanz & Elend. Literatur und Zeitkritik, 09.03.18
"Mit dem Buch ist nicht so ohne weiteres fertig zu werden, führt es doch die Facetten einer 'Empörungsdemokratie' ohne Umschweife vor. Eine bittere Bestandsaufnahme. Dennoch der Appell, die Gesellschaft möge zur Besinnung kommen." Christian Thomas, Frankfurter Rundschau, 22.06.18
"Ein lesenswertes Sachbuch, das den 'kommunikativen Klimawandel' unserer Zeit treffend beschreibt." Susanne Schnabl, Die Presse, 31.03.18
"Exzellente Medienforschung, die mit vielen Geschichten vom "Kulturbruch der Digitalisierung" erzählt, die weder Angst schürt, noch Euphorie fliegen lässt und die - das ist der eigentliche Gewinn - Thesen formuliert, wie Journalismus jeden einzelnen, die Gesellschaft und die Demokratie retten kann." Paul-Josef Raue, kressNews, 19.02.18
"Ein eindringliches Plädoyer für eine Bildungsoffensive, die auf den medienmündigen Bürger zielt." Gunther Hartwig, Südwestpresse, 06.03.18
"Pörksen analysiert klug. Ein lesenswertes, anspruchsvolles Buch." enorm, 3/4 2018
"Ein sehr kluges und nachdenkliches Buch über die Auswirkungen der digitalen Gesellschaft vor (...) Wer besser verstehen will, wie soziale Medien und Netzdiskurse funktionieren, kommt an diesem Buch, das den Weg von der Medien- zur Empörungsdemokratie nachzeichnet, nicht vorbei." Jürgen Nielsen-Sikora, Glanz & Elend. Literatur und Zeitkritik, 09.03.18
"Mit dem Buch ist nicht so ohne weiteres fertig zu werden, führt es doch die Facetten einer 'Empörungsdemokratie' ohne Umschweife vor. Eine bittere Bestandsaufnahme. Dennoch der Appell, die Gesellschaft möge zur Besinnung kommen." Christian Thomas, Frankfurter Rundschau, 22.06.18
"Ein lesenswertes Sachbuch, das den 'kommunikativen Klimawandel' unserer Zeit treffend beschreibt." Susanne Schnabl, Die Presse, 31.03.18
Schließen
Für dieses Produkt wurde noch keine Bewertung abgegeben. Wir würden uns sehr freuen, wenn du die erste Bewertung schreibst!
Eine Bewertung schreiben
Eine Bewertung schreiben
Andere Kunden interessierten sich für