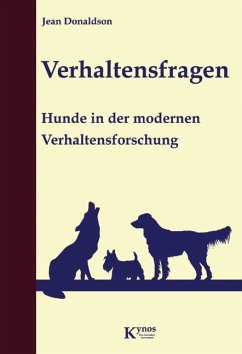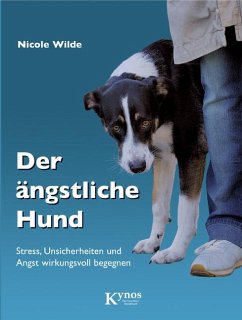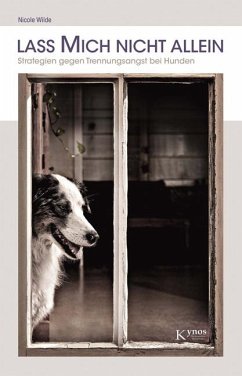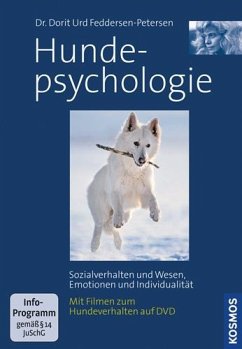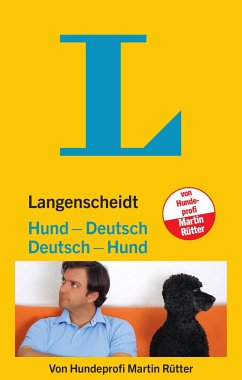doch eher in die Untiefen des Gemütslebens führt.
McConnell ist ein Hansdampf in allen Gassen. Sie ist ein reichlich ungenierter bekennender Hundefan, sie ist eine Verhaltenstherapeutin für gestresste Hunde, sie lebt mit einer Schafherde auf einer Farm, sie publiziert Bücher, Broschüren und Videos, sie tritt in Funk und Fernsehen auf und sie unterrichtet an der Universität von Wisconsin-Madison. Wohl deshalb ist ihr Buch eine Promenadenmischung geworden. Vom Spitz der Kopf, vom Mops der Schwanz, das andere weiß man nicht so ganz, kommt aber allem Anschein nach vom glänzend befellten Kurzhaardackel.
Manchmal spricht die Hundenärrin, manchmal die Tierpsychoanalytikerin und manchmal die Zoologieprofessorin. Und mit wem spricht sie? Mit allen, die sich irgendwie für Menschen und Haustiere und ihre Gefühle füreinander interessieren. Mit denen, die mit ihren Hunden glücklich sind und dieses Gefühl noch etwas vertiefen wollen, mit denen, die ein Problem mit ihrem Hund haben und Hilfe suchen, und mit denen, die ohne besonderen Grund einfach nur neugierig sind.
Aber vielleicht bin ich ja nur versehentlich in eine typisch weibliche Subkultur geraten, wo die Kommunikation nach anderen Regeln abläuft. Könnte es sein, dass die Amerikanerinnen aus der Provinz gerne Hundeausstellungen besuchen, während sich ihre Ehemänner lieber auf Waffenshows herumtreiben? Man traut sich in diesen antichauvinistischen Zeiten ja kaum, einen solchen Verdacht auszusprechen, aber ein Blick auf die Internetseite von McConnells Hundebuchfabrik bestätigt ihn. Alle Autoren und fast alle der zitierten enthusiastischen Leser sind Autorinnen und Leserinnen. Egal, auch wenn ich nicht ganz zur Zielgruppe gehöre, ich finde Kurzhaardackel auch viel besser als Pumpguns, im Blick auf Kinder sowieso.
Liebe muss man nicht begründen. Und wer für die Liebesbeziehungen seiner Mitmenschen Schulnoten vergibt, ist ein Rabauke und sonst nichts. Im Verlaufe des Zusammenlebens von Menschen und Hunden hat die Evolution die Hunde menschlicher und vielleicht auch die Menschen hundeähnlicher werden lassen. Was nach einer so langen Geschichte der Kohabitation manche Menschen und manche Hunde füreinander empfinden, ist wohl auch nicht anders als die Liebe zwischen Männern und Frauen oder zwischen Eltern und Kindern. Letzten Endes beruht das alles ja auch nur auf der Wirkung von Hormonen. Sagt man jedenfalls.
Die Autorin schildert ihre Affären mit ihren vierbeinigen Freunden und Freundinnen mit Inbrunst. Ihre große Liebe war Cool Hand Luke, ein Border Collie, mit dem sie gemeinsam die Schafe gehütet hat. Seinen Tod beschreibt sie so anrührend wie Old Shatterhand das Ende seines Blutsbruders Winnetou. Hunde sind eben auch nur Menschen. McConnell ist glücklich mit ihren Hunden, aber auch mit ihrer Katze, ihren Schafen und ihrem menschlichen Boyfriend Jim, außer während der unvermeidlichen Krisen. Nichts davon sollte man als Ersatz abtun, auch wenn man persönlich vielleicht anders gepolt ist.
Andere Teile des Buchs beschäftigen sich mit Verhaltenstherapie bei Konflikten zwischen Mensch und Hund oder Hund und Hund. Therapiert werden im Idealfall die, die es am nötigsten haben, und das müssen nicht immer die Hunde sein. Die Autorin verdient ihre Brötchen (und die Hundekuchen ihrer Mitbewohner) zumindest teilweise als eine solche Therapeutin. In den Vereinigten Staaten, wo der Psychoanalytiker so selbstverständlich ist wie der Zahnarzt - wenn man denn die nötigen Kreditkarten besitzt -, hat man zu derartigen, die Gattungen Hund und Mensch übergreifenden Therapieformen vielleicht ein besonders unverkrampftes Verhältnis. Die meisten Hunde sind wenig problematisch, sonst wären sie ja als Hausgenossen nicht so beliebt, aber manchmal treten doch unvorhergesehene Schwierigkeiten auf. Im Extremfall muss man dann wirklich zu verhindern versuchen, dass der Rottweiler irgendwann jemanden totbeißt. Besser also gleich den Kurzhaardackel kaufen, frisch von Züchters Tisch.
Die Autorin zeigt anhand von vielen Fallbeispielen, was alles schiefgehen kann und wo die Ursachen liegen oder liegen könnten. Dabei vermeidet sie monokausales Denken. Elsas Verhalten wird wie das unsere durch das Zusammenspiel von Vererbung und Erziehung festgelegt. Die Gene legen Grenzen fest, die auch mit größter Mühe nicht überschritten werden können. Es gibt zum Beispiel Hunde, die einfach nicht mit kleinen Kindern zurechtkommen. So ein Tier muss man dann weggeben, wenn der Nachwuchs da ist, das geht nicht anders.
Eine richtig schöne Lektüre sind diese Geschichten von erfolgreichen oder auch erfolglosen Therapien leider nicht. Wenn ich mich für die Psychologie von Hunden interessiere, dann kann ich zwar einiges dadurch lernen, dass ich Hunde mit einem gefährlichen Dachschaden vorgeführt bekomme; doch noch lieber würde ich nette Geschichten lesen, in denen Elsa allenfalls einmal den Briefträger anknurrt.
Die Autorin beschäftigt sich aber auch mit dem Hund an sich, ohne dass man dabei zwangsläufig mit gestörten Tieren konfrontiert wird. Das sind die schönsten Teile des Buchs. Im letzten Kapitel geht es ihr weniger um das Fühlen als um das Denken der Hunde, wenn man das überhaupt so genau trennen kann. Hier setzt sie sozusagen ihre zwei Doktorhüte - für Biologie und Psychologie - auf und doziert über aktuelle Forschungen. Dabei unterschlägt sie auch den Kurzhaardackel nicht.
Es scheint leider noch einen gewissen Mangel an Untersuchungen mit Hunden zu geben. Aber das macht nichts. Bei Tieren ist es ein Indiz für Intelligenz, wenn sie ihre Artgenossen manchmal reinlegen können. Schimpansen sind solche geborenen Gauner, aber auch Hunde haben etwas von diesem Talent. Auch McConnell mogelt ein wenig. Wenn etwas bei den Hunden noch nicht erforscht ist, dann berichtet sie einfach über andere Tiere wie Polarfüchse, Delphine, Graupapageien oder Menschen. Man kann ja hoffen, dass sich die Hunde ähnlich verhalten.
Vielleicht sind das nicht alles knallharte wissenschaftliche Beweise, aber insgesamt entsteht doch ein stimmiges Bild. Hunde unterscheiden sich von uns mehr quantitativ als qualitativ. Sie haben eine Art Bewusstsein, sie zeigen Ansätze zum abstrakten Denken und sie kennen auch Emotionen wie Trauer, Eifersucht und Mitleid. Das ist natürlich genau das, was der Dackelbesitzer lesen will, aber es muss ja deshalb nicht falsch sein.
ERNST HORST
Patricia B. McConnell: "Liebst du mich auch?" Die Gefühlswelt bei Mensch und Hund. Kynos Verlag, Mürlenbach 2007. 364 S., Abb., geb., 19,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
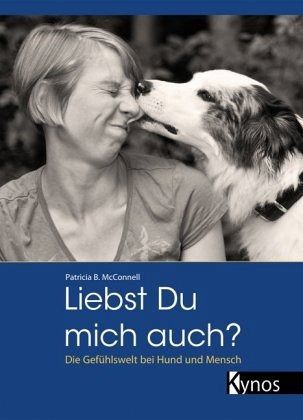





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 03.09.2007
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 03.09.2007