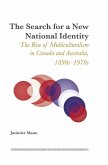Alexander Schmidt begleitet die Deutschen nach Amerika Von Franziska Augstein
Vor vier Jahren hat der Historiker Dan Diner ein Buch über den Antiamerikanismus in Deutschland publiziert. Darin stellte er das deutsche Murren über die Zustände im traditionslosen Amerika als verhohlene und nachgerade unterbewußte Unzufriedenheit mit dem Prozeß der Modernisierung dar, der die Deutschen des neunzehnten Jahrhunderts zutiefst irritierte. Vergleichbare Vermutungen waren zuvor schon angestellt worden, nur daß Diner von "Ressentiment" sprach, wo andere von Verunsicherung reden, und daß er zwischen dem deutschen Antiamerikanismus und dem Antisemitismus eine Parallele zog. Alles zusammen lief darauf hinaus, daß die Deutschen an einer Geistesverfassung litten, die sich so in anderen Ländern nicht finde. So überzogen die These war, so interessant hat sie die Frage gemacht, was die Deutschen von Amerika gehalten haben.
Seit der Unabhängigkeitserklärung ist von der Neuen Welt die drohende Verheißung ausgegangen, daß Europa eines Tages in die amerikanischen Fußstapfen treten werde. In der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts stürzte der Prozeß, der heute als Modernisierung bezeichnet wird, die Europäer in Selbstzweifel. Sollten die Deutschen Amerika tatsächlich besonders verabscheut haben, dann wäre das ein Indiz dafür, daß es so etwas wie eine deutsche Mentalität gegeben hätte, die für den Nationalsozialismus wie geschaffen war. In seinem Essay brachte Diner polemisch auf den Punkt, was andere Historiker in gediegener Entfernung umkreisten. Weil Diner es sich indes geschenkt hat, den offensichtlichen Einwänden gegen seine Darstellung den Wind aus den Segeln zu nehmen, steht sein Text auf wackeligen Füßen. Auf die ist Alexander Schmidts Arbeit über den "Amerika-Diskurs" des deutschen Bürgertums jetzt draufgetreten.
"Von jedem", schrieb G. K. Chesterton, "der nur für kurze Zeit nach Amerika geht, wird erwartet, daß er darüber ein Buch verfaßt." Auch die deutschen Bildungsbürger gaben ihr Teil dazu. Seiner Untersuchung des wilhelminischen Amerika-Bildes legt Schmidt rund hundert Reiseberichte zugrunde, die zwischen 1890 und 1914 publiziert wurden. Manche der Autoren fuhren in Geschäften, andere zum puren Vergnügen. Sie hatten nicht die Absicht, auszuwandern, und waren deshalb nicht darauf erpicht, alles golden zu finden, was in Amerika eitel glänzte. Die meisten waren gut betucht und hegten konservativ-nationalliberale Ansichten.
Diese sozial ziemlich homogene Gruppe nennt Schmidt die "Wilhelminer". Wäre es nur nach der von solchen Leuten gehegten Sympathie für traditionelle Werte gegangen, hätten sie die "moderne" Gesellschaft der Vereinigten Staaten im Namen des "deutschen Wesens" ablehnen müssen. Wie Schmidt darlegt, war das aber nicht der Fall. Hatte Dan Diner von dumpf empfundenen Ressentiments gesprochen, sahen Schmidts Zeugen sich in Amerika mit wachen Sinnen um, weil sie glaubten, in der Gesellschaft der weißen Amerikaner ein mögliches Modell der eigenen Zukunft vor Augen zu haben.
Um die Jahrhundertwende war die Wahrnehmung der Vereinigten Staaten zu Stereotypen geronnen, die viele Deutsche auf Besuch in Übersee bestätigt fanden. Die meisten hielten Amerika für ein "junges" und kulturloses Land. Es gab dort mehr soziale Gerechtigkeit als in Europa, andererseits waren die Einkommensunterschiede dafür um so größer: An die Stelle eines ständischen Sozialgefälles war die Herrschaft des Dollar getreten. Das von Präsident Jackson eingeführte "spoils system", die Ämterpatronage nach den Wahlen, bestätigte das europäische Urteil, daß in Amerika alles käuflich sei.
Es ist Schmidt hoch anzurechnen, daß er seine "Sozialgeschichte der Ideen" mit der historischen Wirklichkeit abgeglichen hat: Wie sich zeigt, lag das Urteil der zeitgenössischen Amerika-Besucher nicht weit von dem entfernt, was heute über die Sozial-und Wirtschaftsgeschichte der Vereinigten Staaten gelehrt wird. Von ihrem eigenen Land hatten die Wilhelminer hingegen eine rustikal verzerrte Vorstellung. Als wäre das hochindustrialisierte Deutsche Reich ein Weiler aus Katen und Buden gewesen, besannen die Reisenden sich allenthalben der deutschen Traditionalität und verkannten, wie sehr ihre Heimat selbst schon wie Amerika war.
Obwohl sie glaubten, daß dort alles anders sei, entdeckten die Wilhelminer mancherlei Gutes in der Neuen Welt. Diesen Umstand betont Schmidt genauso eindringlich wie die vielen Parallelen zwischen dem deutschen Amerika-Bild und den Ansichten, die in Frankreich sowie auf den Britischen Inseln herrschten. Überall wurden die amerikanische Gleichheit und die soziale Mobilität bewundert. Der technische Fortschritt und die Industrialisierung imponierten den Europäern, desgleichen der amerikanische Sinn fürs Praktische und die Vaterlandsliebe: "Der Yankee ist Patriot im Schlafen und im Wachen" wurde gesagt. Umgekehrt, schreibt Schmidt, seien Deutsche, Briten und Franzosen sich darin einig gewesen, Amerika als "Freiheitsstall" der "Gleichheitsflegel" zu betrachten, wie Heinrich Heine es nannte.
Den Europäern erschien "das Yankeekind sehr oft als vorlaut, unziemlich respektlos und unerträglich unerzogen". Wie sollte es auch anders sein, da so viele Amerikanerinnen arbeiten gingen, weil sie, wie der Amerika-Freund Hugo Münsterberg bemerkte, "einen eigenen Lebensinhalt suchten"? Daß in der Mittel- und Oberschicht der Vereinigten Staaten die schöngeistige Muße zum Ideal der Weiblichkeit gehörte, übersahen die europäischen Beobachter: So fixiert waren sie auf ihre Heimat, daß sie alle gesellschaftlichen Veränderungen, die ihnen künftig zu blühen schienen, auf die amerikanische Gesellschaft projezierten. In einem großen europäischen Kanon wetterten Amerikas Kritiker über den amerikanischen Materialismus, die schlechte Arbeitsplatzsicherung und das vermeintlich minderwertige Bildungssystem. Die Massenkultur wurde erst nach dem Ersten Weltkrieg zum Thema. Aber die Gesichtslosigkeit des amerikanisch mechanisierten Menschen machte den Europäern zu schaffen: "Naturen, die wie Uferkiesel gleich sind", stöhnte der heimattreue Romancier Wilhelm von Polenz. "Wahrhaftig, wenn das das Ergebnis des verflossenen Jahrhunderts wäre, dann hätten Männer wie Goethe, Emerson, Ruskin umsonst gelebt." Die gescheiterte Revolution von 1848 mochte den demokratischen Elan der Deutschen gebrochen haben, aber von der politischen Verfassung Amerikas hielten Franzosen und Briten danach auch nicht mehr viel. Zu düster nahm sich in ihrer Vorstellung die Mischung aus Pöbelherrschaft und korruptem Parteienstreit jenseits des Atlantiks aus.
Aus alldem zieht Schmidt den Schluß, daß die Idee von einem deutschen "kulturellen Sonderweg" haltlos sei. Nicht Deutschland, sondern ganz Europa habe sich gehütet, der eigenen Zukunft das "Modell Amerika" zu empfehlen: Die Vereinigten Staaten seien allenfalls als Vorbild für eine "Kurskorrektur" in Frage gekommen. Neben diesen Gemeinsamkeiten gab es indes auch nationale Eigenheiten. So taten die Franzosen sich darin hervor, über die Kulturlosigkeit der Yankees zu wettern. Die Deutschen hingegen entsetzten sich schon um die Jahrhundertwende über das Ausmaß der Naturzerstörung in Amerika. In der Prosa eines "Gartenlaube"-Journalisten säuselte es: In Amerika sei sie dahin, "die ,Waldpoesie', welche das Herz des Deutschen mit süßem Zauber erfüllt".
Während Franzosen und Briten die amerikanische Demokratie im großen und ganzen guthießen und nur die darin nistende Mißwirtschaft beklagten, bestritten deutsche Autoren den Wert des ganzen Unternehmens. An den Obrigkeitsstaat und Bismarcks Sozialgesetzgebung gewöhnt, erregten sie sich über die liberale Regellosigkeit in den Vereinigten Staaten. Schmidt zufolge sei es eine "deutsche Besonderheit" gewesen, "daß gerade die Rolle des starken Staates so positiv bewertet wurde und die demokratiefreundlichen Stimmen deutlich in der Minderheit blieben".
Das ist ein Punkt, der den Schwung behindert, mit dem "Reisen in die Moderne" zu der Ansicht drängt, daß die Deutschen nicht anders von Amerika gedacht hätten als andere Europäer. Schmidts Beharren auf diesem Punkt verträgt sich gut mit seinem Vorschlag, daß die Diskussion über die amerikanische Familie die "Kerndebatte über Modernisierung schlechthin" gewesen sei. Im Hinblick auf die "Frauenfrage" mochten Europas konservative Männer tatsächlich alle an einem Strang ziehen.
Im Verlauf seines Buches klopft Schmidt die verschiedenen Kriterien der Modernisierungstheorie daraufhin ab, ob die Wilhelminer sie in Amerika als bedauerliche Entgleisung oder als Schritt nach vorn wahrnahmen. Es ergibt sich, daß sie einigen Aspekten der Moderne sehr gewogen waren. Gemeinsam mit anderen Europäern kritisierten sie manches an Amerika und hielten anderes für vorbildlich. Schmidt resümiert, daß das "Bild vom illiberalen, modernisierungsfeindlichen, autoritär veranlagten und zivilisationskritischen deutschen Bürger des Kaiserreichs" überzogen sei. Der Gedanke führt freilich nicht weit: Schon die alte Theorie vom deutschen Sonderweg fußt ja auf der Idee, daß die Deutschen des Kaiserreiches die wirtschaftliche Modernisierung begrüßten, während sie sich im Politischen gegen Neuerungen sperrten.
Weil Schmidts Quellen ihm keine Handhabe geben, die These vom deutschen Sonderweg zu widerlegen, hat er ins nächste Fach gegriffen und daraus das Konzept eines "kulturellen Sonderweges" hervorgeholt. Damit wird er spielend fertig. Aber vermutlich würde nicht einmal ein hasardierender Historiker wie Dan Diner den Wilhelminern unterstellen, daß sie die Modernisierung auf allen Ebenen bekämpften. Freilich, Diners Behauptungen über die deutsche Modernisierungsphobie gingen auch so schon weit genug. Und viele Passagen in Schmidts Buch wirken wie versteckte Auseinandersetzungen mit Diners Thesen. Diese Absätze sind besonders interessant. Und Schmidt hätte sich nichts vergeben, hätte er Diners Essay nicht nur in der Bibliographie, sondern auch im Text erwähnt. Außerdem hätte es nicht geschadet, wenn Schmidts Einleitung fünfzig Seiten kürzer wäre. Methodisch fortifiziert wie die Maginotlinie, liest sich das Buch, als hätte die gesamte deutsche historische Fakultät dem Autor bei der Niederschrift prüfend über die Schulter geschaut. Das macht die Lektüre zwar zu einer Tour mit schwerem Gepäck, aber dafür ist das Buch ungemein solide. Man kann nicht immer alles haben. "Reisen in die Moderne" ist auch so eine beeindruckende Arbeit.
Alexander Schmidt: "Reisen in die Moderne". Der Amerika-Diskurs des deutschen Bürgertums vor dem Ersten Weltkrieg im europäischen Vergleich. Akademie Verlag, Berlin 1997. 328 S., geb., 98,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main