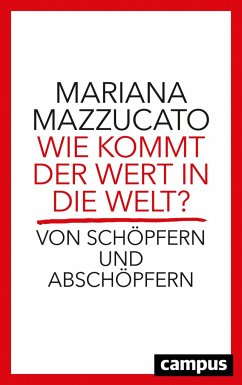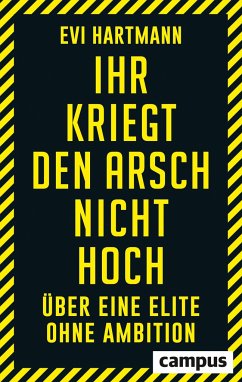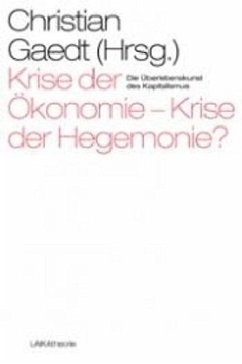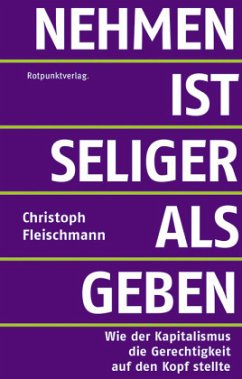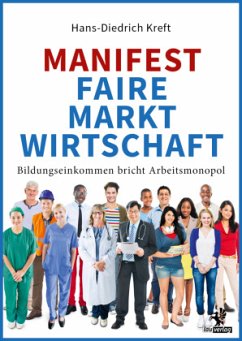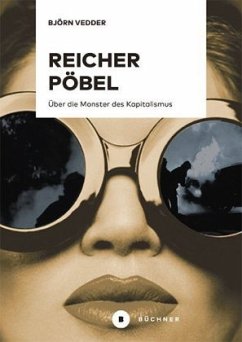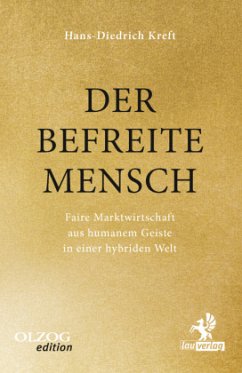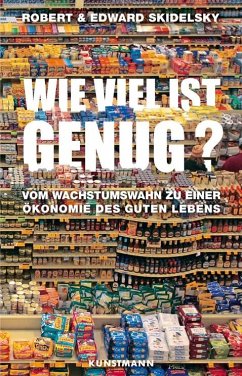Nicht lieferbar
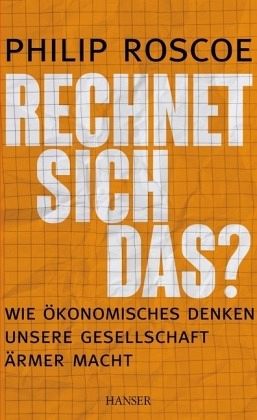
Rechnet sich das?
Wie ökonomisches Denken unsere Gesellschaft ärmer macht
Übersetzung: Proß-Gill, Ingrid
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Die Ökonomie ist eine Erfolgsgeschichte. Ökonomisches Denken wird nicht nur auf den engeren Bereich der Wirtschaft angewandt, sondern inzwischen auch darüber hinaus: Ist Bildung ein gutes Investment? Welcher Partner ist für mich am nützlichsten? Philip Roscoe kennt als Management-Professor die Sichtweise der Wirtschaft, weiß als Theologe und Philosoph aber auch um ihre Begrenztheit. Er argumentiert, dass die "Ökonomisierung" fast aller Bereiche uns nicht dabei hilft, ein sinnvolles Leben zu führen. Im Gegenteil: Indem wir nur auf den wirtschaftlichen Nutzen schauen, vergiften wir unser...
Die Ökonomie ist eine Erfolgsgeschichte. Ökonomisches Denken wird nicht nur auf den engeren Bereich der Wirtschaft angewandt, sondern inzwischen auch darüber hinaus: Ist Bildung ein gutes Investment? Welcher Partner ist für mich am nützlichsten? Philip Roscoe kennt als Management-Professor die Sichtweise der Wirtschaft, weiß als Theologe und Philosoph aber auch um ihre Begrenztheit. Er argumentiert, dass die "Ökonomisierung" fast aller Bereiche uns nicht dabei hilft, ein sinnvolles Leben zu führen. Im Gegenteil: Indem wir nur auf den wirtschaftlichen Nutzen schauen, vergiften wir unsere Beziehungen, richten unsere Gesellschaft und unsere Umwelt zugrunde und werden zu innerlich verarmten Menschen.
"Rechnet sich das?" steht auf der Shortlist des Deutschen Wirtschaftsbuchpreises.
"Rechnet sich das?" steht auf der Shortlist des Deutschen Wirtschaftsbuchpreises.