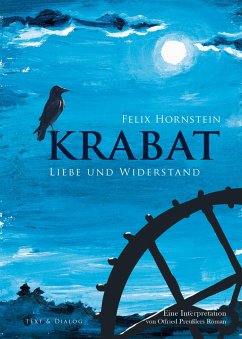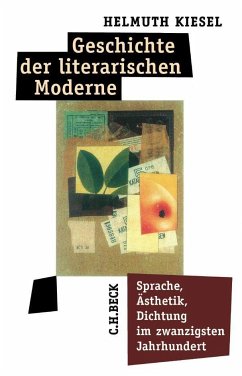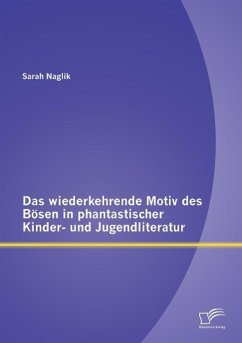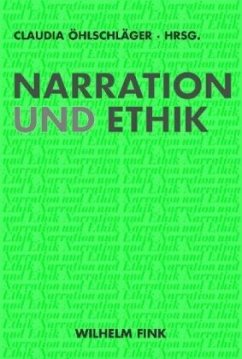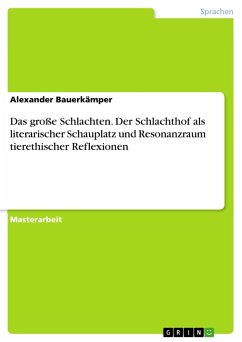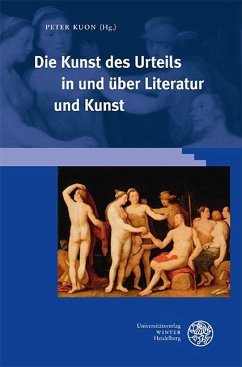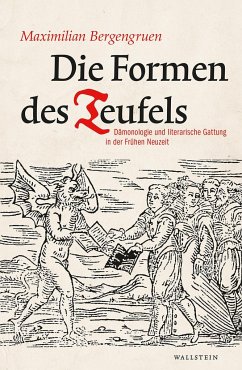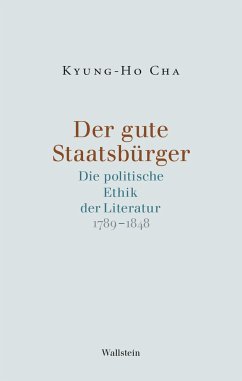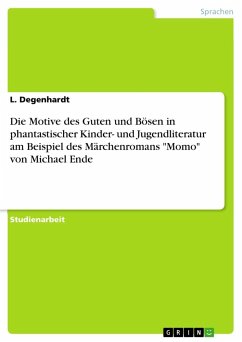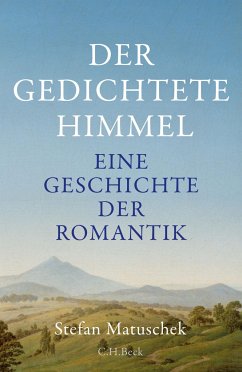"Autonomie" und "starke Wirkungen" pocht, sich zutraut, sogar ein vollkommen sinnloses Gewaltverbrechen "ästhetisch zu würdigen". Man beginne allmählich einzusehen, schrieb der englische Dichter Thomas De Quincey 1827, "dass zur künstlerischen Vollendung einer Mordtat doch etwas mehr gehört als zwei Dummköpfe, einer, der tötet, und einer, der getötet wird, ein Messer, eine Brieftasche und eine dunkle Gasse. Formgebung, meine Herren, Sinn für Gruppierung und Beleuchtung, poetisches Empfinden und Zartgefühl werden heute zu einer solchen Tat verlangt."
Unverkennbar will hier satirische Absicht die radikalen Konsequenzen eines exklusiv ästhetischen Weltverhältnisses sichtbar machen. Als Beispiel für Haltungen, die moralisch Fragwürdiges allein mit Rücksicht auf den künstlerischen Geschmack ansehen, dürfte De Quinceys Provokation jedoch in einer "Ästhetik des Bösen" Aufnahme finden.
Unter ebendiesem Titel hat der Berliner Germanist Peter-André Alt eine überwältigend materialreiche Studie vorgelegt, die Herkunft, Wandlungen und Wirkungen unserer Vorstellungen vom Bösen nachzuzeichnen sucht. Alt ist Literaturwissenschaftler, es ist deshalb nicht verwunderlich, dass er sich bei seinen Untersuchungen auf literarische Darstellungen des Phänomens konzentriert. Da allerdings, wie er - wohl nicht zu Unrecht - meint, poetische Texte in hervorragender Weise an der "Modellierung", also an den Verschiebungen und Weiterungen unserer Begriffe arbeiten, könnte die Aufhellung ihrer Verfahren zugleich einen Beitrag zur "Bewusstseinsgeschichte der Moderne" leisten.
Deren Einsatzpunkt markieren die bekannten krisenhaften Umbrüche. Gegen Ende des achtzehnten Jahrhunderts hatte sich die Erkenntnistheorie von Ansprüchen auf metaphysische Gewissheiten verabschiedet. Wahrheiten waren nur innerhalb des Reiches der Erscheinungen zu haben. Moralischen Halt musste das Subjekt in sich selber suchen, nachdem die Orientierungen des christlichen Weltbildes in einen Strudel der Erosion geraten waren. Dem Reflexionsaufwand, den eine auf Vernunftgründen ruhende Pflichtethik ihm abverlangte, stand die gebrechliche Anlage des von Affekten drangsalierten Menschen gegenüber. Und für die ästhetische Urteilskraft, die sich im Zeichen ihrer Selbstbestimmung aus den Schnüren der Gattungsreglements mit ihren pädagogischen Zwecksetzungen löste, begannen Hand in Hand mit einem rasant zunehmenden und zunehmend aufnahmebereiten Publikum die Abenteuer des Ausprobierens.
In dieser historischen Situation, so Peter-André Alt, erfahren die Erscheinungsweisen des Bösen in der Literatur einen Wandel. Zwar hatte die Erkenntniskritik der Aufklärung die Realexistenz böser Wesenheiten wie Satansgestalten, Hexen und Dämonen längst als Aberglauben entlarvt, aber ihre Funktion als anschauliche, über manchen Abgrund des Denkens und Mutmaßens hinweghelfende Rationalisierungen keineswegs mit erledigt. Letzte glaubwürdige Verkörperung ist Alt zufolge Goethes Mephisto, der allerdings in seinen widersprüchlichen Masken und Rollen weniger als Antipode der Schöpfung auftrete, vielmehr "das menschliche Bedürfnis nach einer Gegenwelt zum Ausdruck" bringe, die noch unbestimmt sei. Letztlich erscheine Mephisto "als Teil jener neuen Psychologie des Bösen", "die sich im Schatten seiner Vertreibung etabliert". Bei seinen Nachfolgern verblassen die äußerlichen Insignien und die meisten aus der christlich-mythologischen Tradition überkommenen Präfigurationen. Als offen oder verdeckt auftretender Gegenspieler legt, wie Peter von Matt es ausdrückte, "der Teufel seinen theologischen Mantel ab" und mutiert zum Intriganten. Die Hölle aber mitsamt ihren Bewohnern wird unsichtbar. Sie ist als destruktives Prinzip mit einer Vielzahl von Äußerungsmöglichkeiten ins Innere der Figuren umgezogen.
Erklärungsgründe für das Böse sind nicht länger Erbschuld, Sündenzwang und transzendente Mächte. An ihre Stelle tritt das nicht minder mysteriöse "Triebgeschehen". Mit dessen Auszeichnung jedoch gerät bei Alt ein fragwürdig mechanistischer Zug in die "Phantasiearbeit", besonders wenn es später als sowohl intellektuell wie kulturell angreifendes Moment der "Transgression" aufgefasst wird. Sein bedrohlich undurchdringlicher Raum jedenfalls wird von Kleist, Poe und Baudelaire über de Sade, Huysmans und Bataille bis hin zu Kafka, Jünger und Malaparte und schließlich Bret Easton Ellis und Jonathan Littell in immer erneuten Anläufen und Tabuverletzungen mit "Imaginationen" des Bösen ausgekleidet. Nach Alt existiert in der Moderne "keine Begriffsgeschichte des Bösen mehr, sondern nur eine Vielzahl ästhetischer Formen, die seine Erscheinungsweise reflektieren". Daher geht es nicht darum, "die Kategorie" des Bösen zu definieren, stattdessen möchte der Autor "exemplarische Merkmale" seiner literarischen Erscheinung erschließen.
Alt ist dabei überzeugt, dass es jenseits der isolierenden Besonderheit einzelner Texte "Grundmuster" darstellerischer Verfahren gibt, die "das Böse" als "Produkt einer eigenen Ästhetik" zugänglich machen. Diese Formen findet er in der Erzähl- und Wahrnehmungsperspektive der "Introspektion", den Rhythmen der "Wiederholung", der "Grenzverletzung oder Überschreitung" und des "Exzesses". Da diese Bestimmungen allerdings so allgemein sind, dass ihnen Distinktionskraft praktisch kaum mehr zukommt, ist es zweifelhaft, ob sie auch nur hinreichen würden, um etwa die exaltierten Monotonien de Sades von den revolvierenden Grotesken der Unterwerfung bei Robert Walser zu unterscheiden.
Alts Buch bietet einen souveränen, zuweilen von Sammelwut leicht vernebelten Überblick über die maßgebliche Literatur seines Gegenstandes und flankiert ihn mit einer schier unglaublichen Fülle poetologischer und philosophischer Erläuterungen. Dass er dabei selber häufig dem "Grundmuster" der Wiederholung opfert, indem er in kreisenden Bewegungen des Argumentierens und einem exzessiven Zitieren noch die letzte Falte vermuteter Unklarheit ausbügelt, erleichtert die Lektüre nicht. Hinzu kommt ein passagenweise recht eckiges Hantieren mit groben terminologischen Instrumenten aus dem Werkzeugkasten von Niklas Luhmann, das leider allzu oft auf Kosten der Prägnanz geht.
Abschluss von Alts Überlegungen zum "Fiktiven" und zur "literarischen Illusion" im letzten Kapitel ist die Bemühung, uns gegen die Versuchungen des "bösen Textes" zu wappnen. Wie geht das, wenn uns etwa ein Ich-Erzähler wie das Monstrum Max Aue aus Littells "Die Wohlgesinnten" zu sich hinüberzieht? Wir können, so Alt, das Böse überhaupt nur dann als böse identifizieren, wenn wir das Gute kennen und wissen, wo die Grenze verläuft.
Der teuflische Text besitzt a priori keine ernsthafte Aussicht, die Wette um die Seele seines Lesers zu gewinnen. Kulturelle Prägungen, zu denen nach Alt immer auch Restbestände an moralischen Intuitionen gehören, sind den Schauern der Angstlust stets vorgelagert. Wer an diesen Abwehrzauber glaubt - und was bleibt einem anderes übrig -, der achte sehr auf die Prägemaschinerie!
ROLF DÄHN
Peter-André Alt: "Ästhetik des Bösen".
C.H. Beck Verlag, München 2010. 714 S., Abb., geb., 34,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
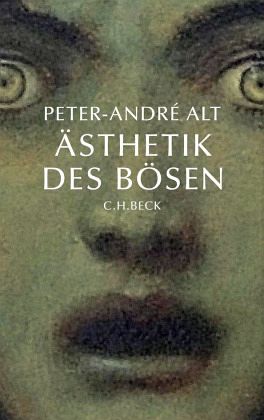




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 03.12.2010
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 03.12.2010