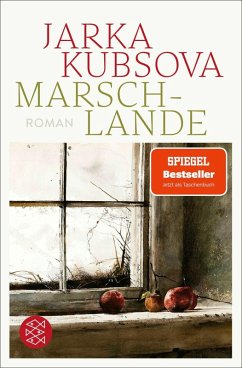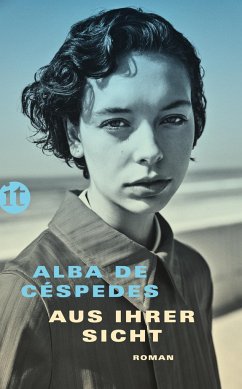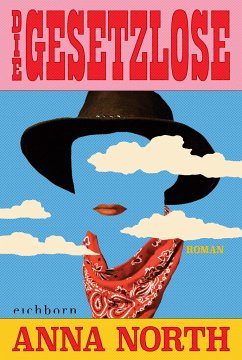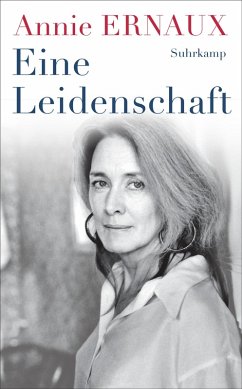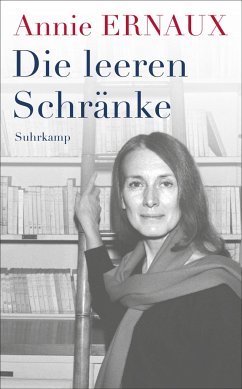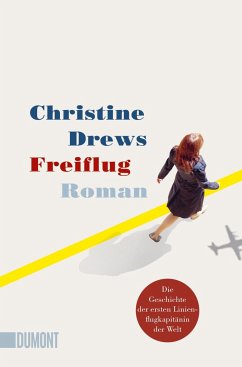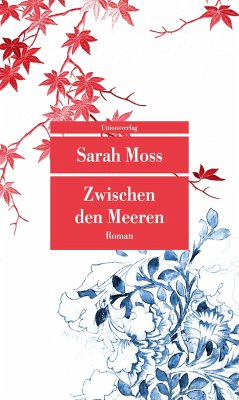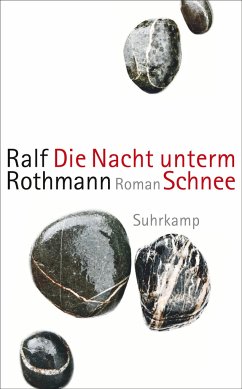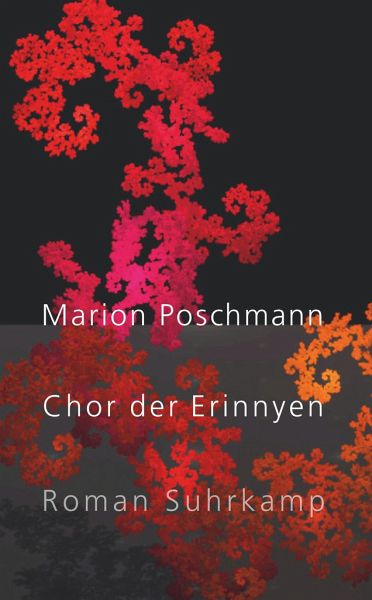
Chor der Erinnyen
Roman Die Parallelgeschichte zum Bestseller 'Die Kieferninseln'
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
13,00 €
inkl. MwSt.
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
In ihrer Parallelgeschichte zum Bestseller Die Kieferninseln schreibt Marion Poschmann humorvoll, poetisch und höchst originell über Kontrollverlust, aufdringliche Freundinnen und aufbegehrende Mütter, über den Frevel an der Natur und ihre fragile Schönheit, über die Dämonisierung von Frauen und die Kraft der Verbundenheit.Mathildas Mann hat fluchtartig das Haus verlassen, ohne Erklärung. Ob ihr das Sorge bereitet, lässt sie sich nicht anmerken. Sie, die Studienrätin für Mathematik und Musik, betrachtet die Dinge mit nüchterner Gelassenheit. Als eine Freundin aus Kindertagen auftau...
In ihrer Parallelgeschichte zum Bestseller Die Kieferninseln schreibt Marion Poschmann humorvoll, poetisch und höchst originell über Kontrollverlust, aufdringliche Freundinnen und aufbegehrende Mütter, über den Frevel an der Natur und ihre fragile Schönheit, über die Dämonisierung von Frauen und die Kraft der Verbundenheit.
Mathildas Mann hat fluchtartig das Haus verlassen, ohne Erklärung. Ob ihr das Sorge bereitet, lässt sie sich nicht anmerken. Sie, die Studienrätin für Mathematik und Musik, betrachtet die Dinge mit nüchterner Gelassenheit. Als eine Freundin aus Kindertagen auftaucht, ihre sonst so zurückhaltende Mutter plötzlich über eine geheimnisvolle Macht zu verfügen scheint und sie selbst von Visionen heimgesucht wird, kippt jedoch ihre rationale Welt ins Unheimliche. Hat sie von ihrer Mutter das Zweite Gesicht geerbt? Es kommt zu Waldbränden und skurrilen Heilritualen, es kommt Wind auf, dessen Flüstern ihr seltsam vertraut erscheint. Hört sie tatsächlich den Chor der Erinnyen?
Mathildas Mann hat fluchtartig das Haus verlassen, ohne Erklärung. Ob ihr das Sorge bereitet, lässt sie sich nicht anmerken. Sie, die Studienrätin für Mathematik und Musik, betrachtet die Dinge mit nüchterner Gelassenheit. Als eine Freundin aus Kindertagen auftaucht, ihre sonst so zurückhaltende Mutter plötzlich über eine geheimnisvolle Macht zu verfügen scheint und sie selbst von Visionen heimgesucht wird, kippt jedoch ihre rationale Welt ins Unheimliche. Hat sie von ihrer Mutter das Zweite Gesicht geerbt? Es kommt zu Waldbränden und skurrilen Heilritualen, es kommt Wind auf, dessen Flüstern ihr seltsam vertraut erscheint. Hört sie tatsächlich den Chor der Erinnyen?