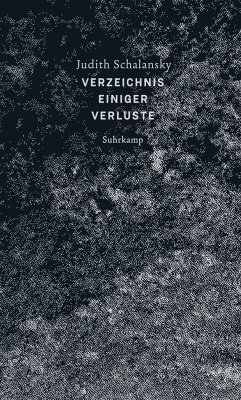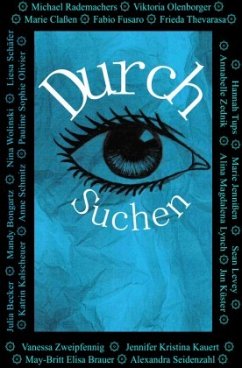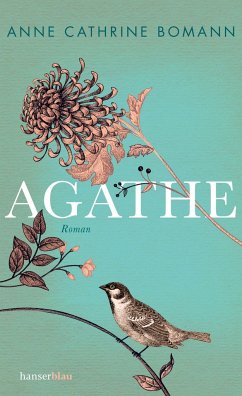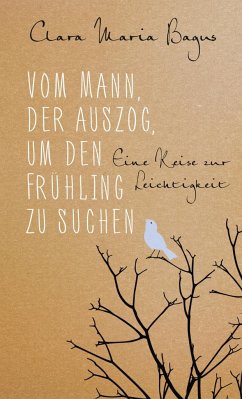Nicht lieferbar

An Schlaf war nicht zu denken
Roman
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Eine tiefgründig-gewitzte Geschichte vom Verlieren und Suchen und Wiederfinden. Und auch eine anrührende Geschichte von der Freundschaft.
Selbstverständlich ist Suchen das täglich Brot einer Agentur für Recherchen wie Sphinx. Mit Routine hat der neue Auftrag dennoch nichts zu tun. Dafür sorgt allein schon die Tatsache, daß das Suchobjekt eine Mutter ist und auch nicht irgendeine, sondern immerhin die Mutter Albert Chandelliers, der der beste Freund der Chefin Oda Lieberos ist. Und außerdem - trifft dieser so dringlich herbeigesehnte Auftrag nicht auf ein Häuflein Rechercheure, die bereits ein bißchen gerupft aus der langen Auftragsflaute hervorgegangen sind, wie Oda Lieberos bei der ersten Aufgabenbesprechung feststellen muß? Ist sie nicht selbst ein bißchen gerupft? Treten diese Individuen aus dem Wartestand, der die routiniert geübte Camouflage der drei Hauptfiguren bereits erheblich angekratzt hat, nicht unversehens in den Ausnahmezustand, der, reich an Schocks, gegen die Suchenden selber schlägt? "Erst gar keine Ereignissse, jetzt nur noch Ereignisse", sagt Lotte Matern, die rechte Hand der Chefin, nach einigenaufreibenden Tagen und Nächten, und der fuchsschlaue Leo Bonte, binnen Minuten von der Katze zur Maus befördert, ist am Ende gekennzeichnet nicht nur durch ein Veilchen. Oda Lieberos wiederum, Altphilologin, Schauspielerin, Altenpflegerin und langjährige Prinzipalin des Lübecker Taschentheaters, die die ererbte Agentur gewöhnlich souverän zusammenhält, muß im Verlauf der leidenschaftlichen Suche zusätzliche Verstandeskräfte mobilisieren, um nicht ihr eigenes Leben allzu radikal zu entrümpeln. Lotte Matern aber, die am Ende gar nicht mehr weiß, was Suchen ist und was Finden, erlebt mit schmerzlichem Erstaunen die Geburt des eigenen Denkens "aus schierer Lebensnotwendigkeit". Ein Auftrag also, der alle in seinen Bann schlägt.