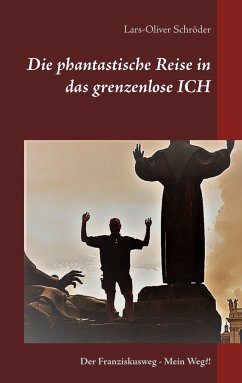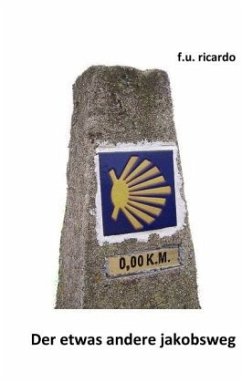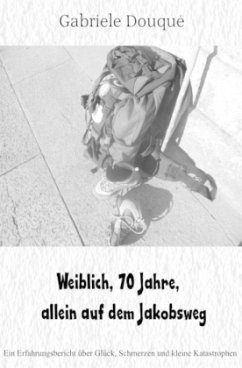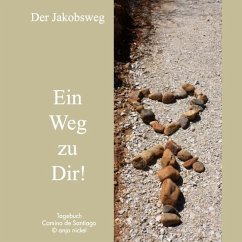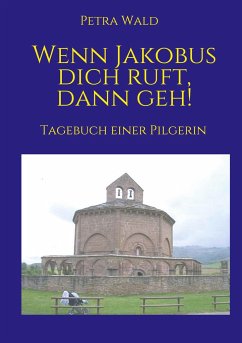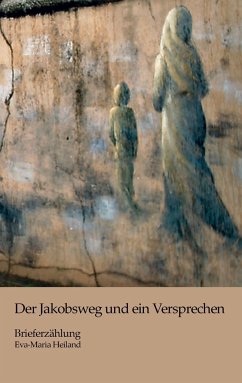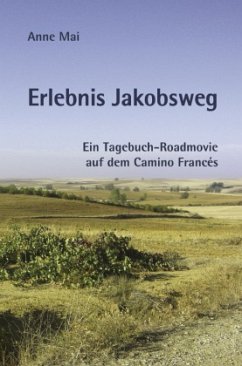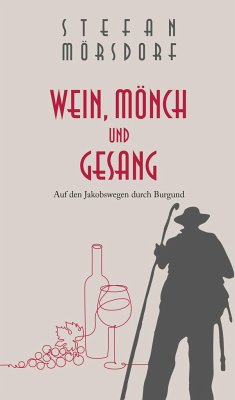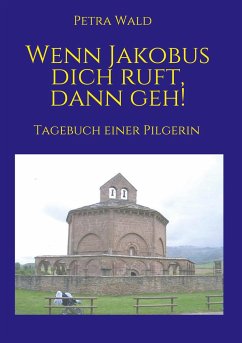Form des Haikus den entsprechenden Rahmen, das Aha-Moment in einer festen Form über das Papier zu tuschen. Bashô, der Wandermönch des späten siebzehnten Jahrhunderts, wurde im Fernen Osten zum Inbegriff einer Form, bei der das rituelle Pilgern sich unter dem Pinsel des Kalligraphen in Schrift verwandelt. Jede Etappe der Wanderschaft ist in wenigen Strichen flüchtig angedeutet, manchmal nur in vermeintlich nebensächlichen Details wie Blüten am Wegrand, Wind und Wolken, Stand von Mond und Sonne vergegenwärtigt, bevor eine Sentenz, meist zum Haiku-Dreizeiler oder Auftakt eines gemeinschaftlich weitergedichteten Renga komprimiert, das Erlebnis verewigt.
Seine in Japan stilbildende Pilgerfibel "Auf schmalen Pfaden durchs Hinterland" hat die Mainzer DVB jetzt in ihrer neuen, wunderbar gestalteten Handbibliothek Dieterich auf sepiabraunem Leinen im Taschenformat neu herausgegeben. Dazu gesellen sich auf frühlingsgrünem Leinen in der ebenso sorgfältigen wie lesbaren Übersetzung und Kommentierung des Japanologen Ekkehard May die Haibun Bashôs, eine mit der Pilgerreise korrespondierende meditative Gattung, die von der skizzenhaften Prosa direkt ins Haiku fließt - das Haibun liefert den Akt der Betrachtung, welcher der Niederschrift der Verse vorangeht, gleich mit.
Man stelle sich vor, ein Lyriker würde hierzulande zu seinen Gedichten immer gleich die Geschichte ihres Entstehungsprozesses mitliefern - das gibt es nur in Poetikvorlesungen und neuerdings der Frankfurter Anthologie, gewöhnlich wartet die Nachwelt noch immer auf postumen Einblick in Notizbücher, um hinter das Rätsel von Gedichten zu kommen. Bashô macht kein Rätsel aus seinen Haikus, und doch bleibt es ein Geheimnis, wie eine derartig anspielungsreiche, auf die lyrischen Meister der chinesischen Tang- und Sung-Dynastie zurückreichende Tradition so unmittelbar, wie hochgradig symbolverhaftete Bilder so unverbraucht und alltäglich wirken können.
Eine Kulturgeschichte des alten Japans versteckt sich hinter unscheinbaren Zeilen wie diesen: "Die ganze Nacht hindurch besorgt, ob der Himmel klar bleiben würde oder ob Wolken aufziehen könnten. Daher der Gedanke: Wolken von Zeit zu Zeit / gönnen den Menschen Rast / beim Mondbetrachten!"
Während Bashô zwischen den Zeilen seiner Haibun über sieben Jahrhunderte hinweg mit Li Bai oder Du Fu ins Zwiegespräch tritt, zeigt die 1950 in Toronto geborene Dichterin Anne Carson in ihrer "Anthropologie des Wassers", wie sie Anleihen bei Bashô und der fernöstlichen Tradition in zeitgenössischen Kontext versetzt. Anne Carson, bei uns mit ihrem im letzten Jahr bei S. Fischer erschienenen Lesebuch "Decreation" noch zu entdecken, ist eine Spezialistin für hybride Textsorten. Nicht nur Lyrik und Prosa, auch naturwissenschaftliche, insbesondere philologische und anthropologische Erkenntnisinteressen mischen sich mit popkulturellen Zitaten, Anspielungen auf verschiedenste Stimmen der Weltliteratur und Plots entferntester Genres, die miteinander zu verbinden bislang kaum jemand auf die Idee gekommen ist. Anthropologie des Wassers zeigt aufs schönste, wie extreme Gelehrsamkeit mühelos in Humor, Sinnlichkeit, Staunen und vice versa umschlägt - manchmal mitten in einem Satz. Anlässe ihrer Anthropologie sind eine Pilgertour nach Santiago de Compostela, eine Zeltwanderung über die Rocky Mountains und die Wasseroberfläche beim Schwimmen in Seen zu verschiedenen Tageszeiten.
Dialogpartner der Protagonistin sind Männer, die wie der Vater und Bruder die Imagination beschäftigen oder wie "Mein Cid" und der "Kaiser" durch Spanien und den amerikanischen Westen als Liebhaber folgen und als Akademiker ein Wissen über China und die Literatur verkörpern, das in ihren Texten widerhallt. Die Reise wird zum Abenteuer der Schrift, deren Etappen in tiefsinnig-kuriose Bilder münden: "Wann ist ein Pilger ein Foto? Wenn die Mischung aus Säure und Gefühl stimmt." Anne Carson gelingen en passant unerhörte Volten der Sprache, bei denen einem die Spucke wegbleibt: "Wie zwei Komponenten eines komplexen Satzes sitzen wir nebeneinander im Auto", "Dass Tinte ins Papier blutet, macht noch keinen Liebesakt" oder "Neon riecht wie Schockbehandlung und hinterlässt eine entsprechende Eispickelscharte im Kopf". Roland Barthes hatte in seinen Vorlesungen zur Vorbereitung des Romans verblüffend das Haiku an den Beginn gestellt. Liest man daraufhin Bashô und Anne Carson, versteht man besser, wie sich um diesen Geistesblitz von drei Zeilen die Geschichte einer ganzen Pilgerschaft verdichtet.
JAN VOLKER RÖHNERT
Anne Carson: "Anthropologie des Wassers".
Aus dem Amerikanischen und mit einem Nachwort von Marie Luise Knott. Verlag Matthes & Seitz, Berlin 2014. 130 S., geb., 19,90 [Euro].
Bashô: "Haibun". Hrsg. und aus dem Japanischen von Ekkehard May. Dieterich'sche Verlagsbuchhandlung, Mainz 2015. 60 S., geb., 29,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
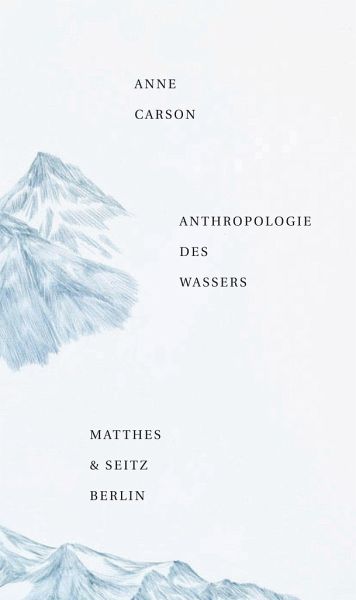




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 26.03.2015
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 26.03.2015