Wandlung durchgemacht, sie wohnen in Hochhäusern und sind sehr ehrgeizig geworden. Die bis 1945 vier Jahrzehnte währende japanische Kolonialisation und der westliche Einfluß, der im Korea-Krieg mit den amerikanischen Alliierten kam, haben dem Land einen mächtigen Modernisierungsschub beschert, der es nicht nur unter die zehn führenden Wirtschaftsnationen torpedierte, sondern die geteilte Nation auch zu einer der widersprüchlichsten unter den Globalkulturen machte.
Von individueller Zerrissenheit erzählt denn auch Kim Seong-Dongs Roman "Mandala". Es ist die Geschichte eines jungen Zen-Mönchs, dessen Askese durch die Begegnung mit Jisan, einem unorthodoxen Wanderbruder, in den Grundfesten erschüttert wird. "Mandala" löste bei seinem ersten Erscheinen 1978 in Korea großes Aufsehen aus. Denn es diskutierte nicht nur die Qualen der Entsagung und die Selbstzerfleischung eines spirituellen Schiffbruchs, sondern griff ganz konkret auch die Institutionen eines Glaubens an, der immer materieller und zynischer geworden war. In Seoul begegnen den Protagonisten ihre Glaubensbrüder mit Tortenschachteln in den Händen, die sie zu reichen Gönnern tragen. In einem städtischen Zen-Kloster schauen sich die Bewohner johlend einen amerikanischen Ringkampf im Fernsehen an und schicken die Besucher davon, weil man für Wandermönche keinen Platz mehr hat. Jisan reagiert auf den trostlosen Zustand seiner Konfessionsgemeinschaft durch Exzesse: Lästerungen, wahllose Liebesaffären und permanente Trunkenheit. Dennoch fasziniert er den glaubensstrengen Erzähler durch seine asketische Schönheit und die philosophische Brisanz seiner uferlosen Reden.
Als eine Religion, die den Körper mit der Seele erlösen will, statt seinen Willen abzutöten, ist das Christentum in Jisans Monologen immer gegenwärtig. Mit lutherischer Verve argumentiert er für die Rückkehr des Sinns in die Rituale und für eine elementare Geistlichkeit, die ganz der tabulosen Selbsterfahrung entspränge. Desillusioniert von einer saturierten Zen-Meister-Kaste, die in Rätseln spricht und ihre Predigten im weithin unverständlichen Sino-Koreanisch abhält, begehren Kims Helden gegen die Gottverlassenheit auf und sehnen sich nach einer im Buddhismus nicht vorgesehenen Diesseitsfülle.
Als weltliches Phänomen ist der Triebverzicht im zukunftsbesessenen Korea heute vielleicht noch gegenwärtiger als vor dreißig Jahren. So mag es sich erklären, daß der Autor kürzlich eine Überarbeitung seines Romans publizierte, in der sein Erzähler darauf verzichtet, seinerseits Jisans Läuterungsweg durch das Dickicht sinnlicher Erfahrung einzuschlagen. Die Prostituierte, mit der er im letzten Kapitel eine Nacht verbringt, schläft auf der Stelle ein - und er rennt zum Bahnhof, "so schnell ich nur konnte".
Indem sich der Verlag für diese neuere Version des Textes entschied, hat er dem Buch einen guten Teil seiner Plausibilität genommen, aber nichts von seiner Verve und seinem Dostojewskischem Kasteiungsfeuer. Kim Seong-Dong ist selber Wandermönch gewesen und berichtet aus einer Welt, die man für längst vergangen halten mochte. Denn während Sekten und religiöse Institutionen für viele ein einträgliches Geschäft geworden sind, erinnert der Autor an meditierende Mönche, die in den Meditationszentren und Einsiedlerklausen der koreanischen Berge weiterhin nach Erleuchtung suchen oder sich bei Schnee und Eis in dünner Kutte auf die Wanderschaft begeben. Die Bedeutung der genußsüchtigen Jisan-Figur wird erst auf dieser Folie ganz deutlich, denn die Rede ist auch von Mönchen, die ihrer Devotion einen Finger opfern oder zur Verteidigung des Priesterzölibats gar Harakiri begehen. "Wie könnte man jedoch sein flüchtiges Leben vergeuden, ohne zu erfahren, wozu man fähig ist?" begründet Jisan seinen zugleich sehr modernen und tief im Buddhismus verwurzelten Extremismus, der zur Not eine Atombombe werfen möchte, um Seoul von seiner Eitelkeit zu befreien.
Das südkoreanische Wirtschaftswunder hat solche Energien zu kanalisieren verstanden. Auf der Strecke bleiben das dem schamanischen Korea teure Glück der Gegenwart und die Selbstgenügsamkeit der Strohdachhütten. Ein Mißtrauen gegenüber den Träumen von irdischer Größe ist nur noch in den Zen-Paradoxen zu spüren, die Kim Seong-Dongs Protagonisten hin und her wälzen. Skepsis gegenüber allen Entsagungsreligionen verrät jene Trauer, die beide Männer Tag und Nacht begleitet. "Ich würde mich wenigstens nicht mehr ganz so einsam fühlen", sagt Jisan von den Frauen, "wenn sie keine Brüste hätten."
INGEBORG HARMS
Kim Seong-Dong: "Mandala". Roman. Aus dem Koreanischen übersetzt von Song Moon-Ey, Nina Berger und Jürgen Abel. Pendragon Verlag, Bielefeld 2005. 288 S., geb., 18,50 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
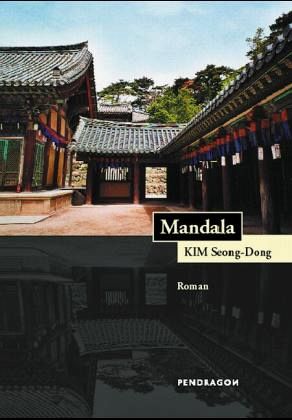




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 26.08.2005
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 26.08.2005