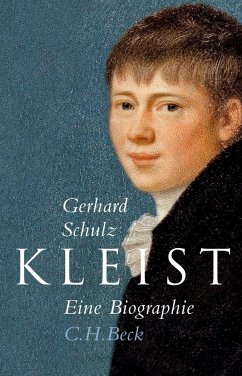Die große Kleist-Biographie von Gerhard Schulz zeichnet die Lebensgeschichte eines Dichters nach, der es schwer mit vielem, am schwersten aber mit sich selbst hatte. In den politisch bewegten Zeiten der Napoleonischen Kriege suchte er ruhelos nach einer Bestimmung für sein Leben. Aber als er sie in der Literatur gefunden hatte, versagten ihm seine Zeitgenossen die Anerkennung dafür. So endete er sein Leben von eigener Hand.
Kleist, scheu wie er war, neigte dazu, seine Lebensspuren zu verwischen, und da sein Ruhm erst allmählich nach seinem Tode zunahm, haben auch andere sich lange Zeit nicht darum gekümmert. Wo hat er, der nach Liebe suchte, sie tatsächlich gefunden? Was trieb ihn auf immer neue Reisen? Diente er als Agent im Kampf gegen Napoleon? War Goethe für ihn jene übermächtige Gestalt, die er zu übertreffen suchte? Und schließlich: was hat sein Werk, um dessentwillen wir uns für ihn interessieren, mit diesem allen zu tun? Darauf antwortet dieses Buch, ohne sich den vielen Mutmaßungen und Legenden zu unterwerfen, mit denen Kleists Leben bis heute umstellt ist.
Entstanden ist eine lebendige und anschauliche Erzählung eines Lebensbogens, der von der Jugend in Preußen bis zum Ende des "pauvre Henri Kleist" in der Nähe von Potsdam reicht. Die Deutschen haben sich Zeit gelassen, Kleists Meisterschaft zu erkennen, aber das Verlangen danach hat dann glücklicherweise an Intensität zugenommen und dauert unvermindert bis auf den heutigen Tag an. Solchem Verlangen entgegenzukommen, dient diese Biographie.
Kleist, scheu wie er war, neigte dazu, seine Lebensspuren zu verwischen, und da sein Ruhm erst allmählich nach seinem Tode zunahm, haben auch andere sich lange Zeit nicht darum gekümmert. Wo hat er, der nach Liebe suchte, sie tatsächlich gefunden? Was trieb ihn auf immer neue Reisen? Diente er als Agent im Kampf gegen Napoleon? War Goethe für ihn jene übermächtige Gestalt, die er zu übertreffen suchte? Und schließlich: was hat sein Werk, um dessentwillen wir uns für ihn interessieren, mit diesem allen zu tun? Darauf antwortet dieses Buch, ohne sich den vielen Mutmaßungen und Legenden zu unterwerfen, mit denen Kleists Leben bis heute umstellt ist.
Entstanden ist eine lebendige und anschauliche Erzählung eines Lebensbogens, der von der Jugend in Preußen bis zum Ende des "pauvre Henri Kleist" in der Nähe von Potsdam reicht. Die Deutschen haben sich Zeit gelassen, Kleists Meisterschaft zu erkennen, aber das Verlangen danach hat dann glücklicherweise an Intensität zugenommen und dauert unvermindert bis auf den heutigen Tag an. Solchem Verlangen entgegenzukommen, dient diese Biographie.

Auf manche Fragen will Gerhard Schulz in seiner gründlichen Kleist-Biographie ausdrücklich keine Antwort geben
Kleist war ein Extremist. Vieles hat er sich vorgenommen, etwa ein Leben auf dem Bauernhof oder eine Karriere in den Führungskreisen des preußischen Beamtenapparats. Nur radikal mussten die Lebensziele sein. In der Mitte fühlte Kleist sich nicht wohl. Daher scheiterte er immer wieder kolossal und verzweifelte abgrundtief, verlor jedoch selten auf Dauer die Hoffnung. Sich selbst und anderen gegenüber hielt er stets am Versprechen fest, in Zukunft Besonderes und Außergewöhnliches zu leisten. Oft genug aber machte er die Beobachter ratlos. Manche Zeitgenossen sahen ihn als eine in sich gekehrte Person mit einem Hang zur Melancholie, zum Träumerischen und Ungeselligen. Andere hielten ihn für extrovertiert und bemerkten einen Willen zur Außenwirkung, der bis ins Gewaltsame reichte. Kleist selbst kommt sich wohl auch wegen dieser zerklüfteten Erscheinung bisweilen „unaussprechlich” vor.
Gerhard Schulz bringt das nach allen Seiten grell aufblitzende Bild in seiner Kleist-Biographie auf eine einfache Formel: „ein schwieriger Mensch”. Ein schwieriger Fall war Kleist für sein Umfeld, und ein schwieriger Fall geblieben ist er bis heute, zumal für seine Biographen. Denn auch wenn sich kaum ein interessanterer Gegenstand denken lässt: Es bestehen „Informationslücken nicht nur von Monaten, sondern von ganzen Jahren”, und die Quellen bieten wenig gesichertes Wissen. Das liegt nicht zuletzt an Kleists Hang, sehr kreativ mit den Fakten umzugehen. Er „war in seinen Briefen geradezu ein Meister der Suggestion und der versuchten Manipulation, nicht selten auch der Autosuggestion hinsichtlich bevorstehenden eigenen Glückes und Gelingens”.
Kleist-Biographen lösen dieses Problem gemeinhin, indem sie entweder spekulieren, das Werk ins Zentrum stellen oder auf dem dürren Gerüst der gesicherten Kenntnisse ausharren. Schulz kreuzt diese Pfade, misstraut aber den Wegweisern. Er hat ein abwägendes und vorsichtiges Buch geschrieben, das souverän mit den Quellen umgeht. Schulz ist ein kenntnisreicher Führer durch die Literaturlandschaften und ein zurückhaltender Interpret. Als Anwalt der Vergangenheit und vor allem der Kunst und des Künstlers bleibt er stets dezent und scheut jede Zudringlichkeit. Seine Stärke liegt in der warnenden Geste gegenüber überspannten Thesen. Mit klarer, bisweilen auch herablassender Haltung zieht er über die Verrätselungen der „beflissenen Forschung”, über „Literaturdetektive” und über die „versammelte Forscherschar” der Germanistik her. In deren Köpfen liege – mit den Worten des Dorfrichters Adam – „Wissenschaft und Irrtum / Geknetet, innig, wie ein Teig zusammen”. Schulz hingegen legt das Material vor und beharrt darauf, dass sich vieles schlichtweg nicht klären lässt. Warum Kleist etwa im Jahr 1800 nach Würzburg reist, bleibt weiterhin offen. Zur Wahl stehen nach wie vor ein Spionageauftrag, die Beseitigung einer Vorhautverengung, die Behandlung von Impotenz oder von Sprachhemmungen, nur dass diese Entschlüsselungen nach Schulz noch seltsamer wirken als zuvor.
Der Tod ist kein Theater
Als Alternative zu den vorliegenden Deutungen bietet Schulz einen roten Faden an, an dem er die Stationen von Kleists Entwicklung aufreiht: „Was immer Kleist mit seiner Reise für Absichten verfolgt, er wurde durch sie und noch ohne bewusste literarische Ambitionen zum Erzähler”. In den Briefen aus dieser Zeit erlebt der Leser die ersten Wehen bei der Geburt eines Autors, der sich durch die Umgebung anregen lässt und sich alle Freiheiten nimmt, um diese Anregungen in eine hinreißende Darstellung umzuformen – zur Not auch gegen alle Realitäten. „Ich denke einst diese Papiere für mich zu nützen”, erklärt Kleist seiner Braut. Danach wird Kleist allmählich dazu übergehen, sich die Menschen „selber zu schaffen. . ., wie sie ihm gefallen”. Was hier noch spielerisch wirken mag und als Ausweg aus den Nöten einer oft genug verständnislosen Welt erscheint, läuft auf ein tödliches Finale zu. Die „große Geste” des Todeswunschs, die Kleist literarisch und brieflich virtuos variiert, realisiert sich als Doppelselbstmord. „Der Tod ist kein Theater”, bemerkt Schulz zu Recht. Wenn der Selbstmörder „sein Leben wirklich zu inszenieren verstanden hätte, wäre es glücklicher verlaufen”.
So umfangreich, sorgfältig und kenntnisreich Schulz’ Darstellung ausfällt, so eigentümlich blass bleibt deren historische Dimension. Gerade das „Seelische”, auf das Schulz sich in besonderer Weise einlassen will, hat auch seine Geschichte. Die Liebe, die Freundschaft, die Ideen von Autorschaft und einem Werk, der Entwurf von Lebensplänen oder die Bewältigung von Krisen sollten für den Historiker ihre eigentümlichen Seiten zeigen. Aber für Schulz verbieten sich „Mutmaßungen . . . über die Gemütszustände einer fernen, vergangenen Zeit”, und zwar nicht nur in schlicht biographistischer, sondern offenbar auch in mentalitäts- oder diskursgeschichtlicher Hinsicht. Die Strukturmuster, die historisch typischen Aspekte der Biographie, die ein Leben als Ereignis in seiner Zeit verständlich machen, werden erwähnt, aber nicht recht ernst genommen.
Stattdessen interessiert sich Schulz sehr viel mehr für die „Natur des Menschen”, für die „immer neue alte Erfahrung jeder Generation zu allen Zeiten”, für das „zeitlos” Gültige und für dasjenige, was „über die Zeiten hinweg” als Erfahrungshaushalt erkennbar bleibt. Aus dieser Perspektive des Allzumenschlichen findet er vieles verständlicher und weniger geheimnisvoll, als es die Kleist-Forschung gern gesehen hätte. Nur: Sollte sich ein Biograph nicht von möglichst vielen Momenten seines Gegenstands überraschen und irritieren lassen, um eine spezifische Lebenskonstellation zu erschließen?
Diese Neigung zum Überzeitlichen hat auch für die „vielfältigen Aspekte der Werkinterpretation” Folgen. „Alle große Literatur”, so Schulz, berichte davon, dass „sich dann eben doch Lieben und Leiden, die Gefühle wie das Denken und Handeln der Menschen über die Zeiten hinweg sehr ähnlich geblieben” sind. Im Fall des Künstlers Kleist hält Schulz daher die Bezüge zwischen zeithistorischen Ereignissen und Werk für unfruchtbar. Allerdings kämpft Schulz damit lediglich gegen Windmühlen an: gegen die schlechte Option einer Abbildtheorie nämlich, die Literatur und historischen Kontext kurzschließt – methodisch hat die Germanistik mittlerweile jedoch sehr viel mehr zu bieten. Vor allem aber bleibt die Alternative, die Schulz anzubieten hat, nicht weniger problematisch, und zwar sprachlich wie gedanklich.
So heißt es etwa zur „Penthesilea”: „Aus dem in Gang gesetzten Geschehen ergeben sich Folgen, die nicht mehr dem Wunsch des Dichters wie dem seines Publikums unterworfen sind, sondern allein der zweigeteilten, als Weibliches und Männliches existierenden menschlichen Natur” – solche sprachliche Umständlichkeit, gewissermaßen das stilistische Gegenteil zu Kleists drastischer, schneller, dynamischer Sprache, prägt leider den Leseeindruck. Dass man nach der Amazonenfürstin Penthesilea, die am Ende Küsse und Bisse verwechselt und ihren Geliebten verzehrt, nirgends „in der Welt zu suchen habe außer in Kleist selbst”, ist zweifellos richtig. Warum aber lässt Schillers „Glocke” durch die Französische Revolution „Weiber zu Hyänen” werden? Wie verhält sich die mythische Kriegerin zu den zeitgenössischen spanischen Partisaninnen im Kampf gegen Napoleon? Wie passt die Amazone ins Konzept jener um 1800 so beliebten Zwitterwesen, denen sich Kleists Schwester durch Männerkleidung auf Reisen immerhin modisch angenähert hat? Und warum schließlich, wenn eine Figur wie Penthesilea Goethes Antikenbild tatsächlich „zutiefst widersprach”, nannte der Weimarer Dichterfürst Euripides’ „Bacchen” einmal „mein liebstes Stück” und übersetzte später daraus ausgerechnet jene Szene, in der Orpheus zerfleischt wird?
Offenbar ist hier mit einer Fülle von Beziehungen zu rechnen, die Literatur, Kultur, historische Geschlechterbilder, Politik und Biographisches verbinden. Die Quellen für Kleists Biographie sind bekannt. Daher hängt alles von der Deutung ab, die nicht schon deswegen haltlos wird, weil sie erst jene historische Distanz erzeugt, die dann die biographische Erklärung wieder überbrückt. „Geheimnisse pflegen den menschlichen Geist anzuregen, aber wo die Tatsachen fehlen, blühen die Spekulationen”, sagt Schulz. Das ist gewiss richtig. Allerdings liegt zwischen den ‚Tatsachen‘ und den ‚Spekulationen‘ ein weites Feld. Schulz macht „mehr von dem Geheimnis spürbar, das in allen großen Künstlerpersönlichkeiten wirksam ist”. Kleists Geheimnis besteht weiter. STEFFEN MARTUS
GERHARD SCHULZ: Kleist. Eine Biographie. Verlag C. H. Beck, München 2007. 607 Seiten, 26,90 Euro.
Auch in der Kleist-Forschung liegen – mit den Worten des Dorfrichters Adam zu sprechen – „Wissenschaft und Irrtum / Geknetet, innig, wie ein Teig zusammen”. Szene aus dem Fernsehspielfilm „Der zerbrochene Krug” von Dieter Dorn und Gernot Roll mit Rolf Boysen als Adam. Foto: SV-Bilderdienst
Zeichnung Heinrich von Kleists von unbekannter Hand Blanc Kunstverlag
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Eine Dienstleistung der DIZ München GmbH

Bringt das Leid der Dichter das Glück der Buchmesse?
Wem auf Erden nicht zu helfen ist, der wird auch auf der Buchmesse nicht glücklich. Wenn wir uns Heinrich von Kleist nur für eine Sekunde in einer der Messehallen vorstellen, fällt uns sofort jener berühmte Satz ein, den Kleist an seinen Schwager schrieb: "Ich bitte Gott um den Tod und dich um Geld." Kürzer und drastischer ist das Künstlerdrama der zwischen Erlösungssehnsucht und Verarmungsangst, zwischen Transzendenz und schnödem Diesseits hin und her geworfenen Dichterseele nicht auf den Punkt zu bringen. Gleich drei Biographien versuchen in diesem Bücherherbst das Phänomen Kleist zu erhellen. Knapp und solide tut dies Herbert Kraft ("Kleist". Leben und Werk, Aschendorff Verlag), während Jens Bisky mit Leidenschaft und feuilletonistischem Schwung Kleist zum "größten politischen Dichter der Deutschen" ausruft und nachzeichnet, welch heikle Konstellationen die Ideale der Aufklärung und der Französischen Revolution in Kleists Leben und Werk eingingen ("Kleist". Rowohlt Berlin). Mehr dem Leben als dem Werk gilt das Interesse von Gerhard Schulz ("Kleist". Eine Biographie, C. H. Beck), der manches Rätsel auf dem Lebensweg des Dichters, etwa die nebulöse Würzburg-Reise, wie einen Luftballon behandelt: Leichthändig lässt er die Luft heraus. Bei aller kalten Logik im Lebensdetail wahrt Schulz aber den Respekt vor dem Rätselhaften der Gesamtexistenz.
Wenn Kleist es überhaupt auf einer Buchmesse aushalten könnte, dann also auf dieser. Allerdings müsste er ertragen, dass es noch weitere Dichterbiographien gibt: Helmuth Kiesel ("Ernst Jünger. Die Biographie", Siedler-Verlag) hat sich ebenso wie Heimo Schwilk ("Ernst Jünger", Piper) einer Jahrhundertfigur gewidmet, Holger Hof schildert Gottfried Benns "Leben in Bildern und Texten" (Klett-Cotta), und Thomas Karlaufs vielbeachtete Biographie eines charismatischen Charakters ("Stefan George", Blessing) setzt in der George-Forschung neue Maßstäbe. Die wichtigste Neuausgabe eines Klassikers gilt Stendhal: Elisabeth Edl hat "Die Kartause von Parma" (Hanser) glanzvoll neu übersetzt.
Dass man kein Dichter sein muss, um am Leben zu scheitern, beschreibt eindrucksvoll Katja Lange-Müller. Sie hat mit "Böse Schafe" (Kiepenheuer & Witsch) eine bitterzarte Liebesgeschichte geschrieben, von der schnoddrigsten Sentimentalität, mit geradezu selbstmörderischer Furchtlosigkeit vor Klischees und von großer Glaubwürdigkeit und Würde. Der Roman spielt im Berliner Sozialhilfe- und Fixermilieu der Vorwendezeit, und selten erschien das alte West-Berlin so klein, kaputt und reizlos wie hier. Umso erstaunlicher, welche Kraft Katja Lange-Müller in diese Liebesgeschichte zu legen vermag, von der bis zum Schluss nicht deutlich wird, ob es sich nicht doch nur um die mit Zähnen und Klauen verteidigte kleine Illusion eines großen Herzens handelt.
Derart realistische Schilderungen sozialer Milieus sind selten geworden in der deutschen Gegenwartsliteratur. Vor allem die Arbeitswelt jenseits schicker Werbeagenturen und polierter Redaktionsräume in den Hochglanzmagazinen kommt kaum noch vor. Das Romanpersonal der Gegenwart führt hauptberuflich ein Privatleben, der Job ist allenfalls Nebenbeschäftigung, gerade noch geeignet, die Figur in einem bestimmten Milieu zu verorten. Annette Pehnt stößt jetzt mit einer beklemmenden Charakterstudie von großer Virtuosität in diese Lücke. Ihr Roman "Mobbing" schildert mit der Intensität des Kammerspiels einen Fall, wie er sich im deutschen Büroalltag unzählige Male ereignet: Ein Angestellter kommt nicht mehr klar, nicht mit seiner Vorgesetzten, nicht mit seinen Kollegen. Er fühlt sich ausgebremst, geschnitten, kujoniert, erniedrigt, gedemütigt. Annette Pehnts entscheidender Kunstgriff liegt in der Wahl der Perspektive. Sie beschränkt sich allein auf die Ich-Erzählerin, die alles, was sie erfährt, von dem Opfer weiß. Und sie kann nichts relativieren oder in Frage stellen, ohne sich dem Verdacht auszusetzen, sie würde dem Ehemann das verweigern, was er gerade jetzt am nötigsten braucht: die unbedingte Loyalität seiner Frau.
Annette Pehnts Buch gehört zu den seltenen Fällen, in denen eine Familiengeschichte ganz in der Gegenwart angesiedelt ist. Oft geht der Blick in diesem Bücherherbst zurück in die Vergangenheit. Michael Lentz leiht den deutschen Emigranten an der amerikanischen Westküste seine Stimme ("Pazifik Exil", S. Fischer), Erich Hackl spürt dem Schicksal Gisela Tenenbaums nach, die 1977 in der argentinischen Militärdiktatur spurlos verschwand ("Als ob ein Engel", Diogenes), und auch Julia Franck nimmt eine reale Begebenheit zum Anlass ihres neuen Buches: Der Vater der Autorin wurde 1945 als Kind von der eigenen Mutter verlassen. Im Zentrum ihres Romans "Die Mittagsfrau" (S. Fischer) steht aber nicht das unglückliche Kind, sondern die Mutter. Über etwa vier Jahrzehnte hinweg schildert die siebenunddreißigjährige Autorin das Schicksal ihrer Hauptfigur, um spürbar werden zu lassen, wie es zu einer solchen unerhörten Handlung kommen konnte. Helenes Gefühle sind ausgelöscht, und Julia Franck erkundet behutsam, mit viel Geduld und großer erzählerischer Sorgfalt, wie es zu dieser Auslöschung kam.
Das große Geschichtspanorama hat Julia Franck, anders als der schon mit dem Titel ("Abendland", Hanser) weit ausgreifende Michael Köhlmeier, nicht im Sinn. Köhlmeier erweist sich als glänzender Erzähler, dem es jedoch leider erheblich an Ökonomie gebricht. Dass große Bücher Schwächen und Mängel aufweisen dürfen und dennoch große Bücher bleiben können, weiß jeder Leser. Und wer es nicht weiß, dem ist auf Erden und auf dieser Buchmesse leicht zu helfen. Er lese nur "Day" (Wagenbach), einen Roman über einen englischen Soldaten im Zweiten Weltkrieg, geschrieben von der schottischen Autorin A. L. Kennedy, die 1965 das Licht der Welt erblickt hat, zweiundzwanzig Jahre nachdem Männer wie Alfred Day Städte wie Hamburg bombardiert und ein Loch in den Himmel gebrannt haben, das sich nie wieder schließen sollte.
HUBERT SPIEGEL
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Sehr viel Raum gibt Rezensent Hans-Jürgen Schings in einer Sammelbesprechung, die er einer einer wiederaufgelegten und drei neu erschienenen Kleist-Biografien widmet, der Arbeit von Gerhard Schulz. An dieser Lebensbeschreibung gefällt ihm, dass sie sowohl allzu große Nähe zum Objekt meide, als auch jegliche existenzialistischen Interpretationen hinter sich lasse. Vielmehr führe der Autor auf urbane und überlegene Weise die schwierige und schwer zu interpretierende Quellenlage, also "das Rätsel Kleist", recht unbeeindruckt zurück auf das Moment der "Selbstkonstruktion" eines schwierigen Menschen ('Ein schwieriger Mensch' heißt das erste Kapitel bei Schulz). Am Ende bedauert der Rezensent zwar die Zurückhaltung des Autors bei der Analyse der Werke Kleists, findet aber ansonsten diesen neuen Versuch einer Kleist-Biographie höchst gelungen.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH