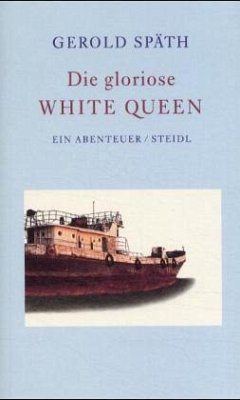Produktdetails
- Verlag: Steidl
- Seitenzahl: 137
- Abmessung: 220mm
- Gewicht: 300g
- ISBN-13: 9783882437812
- ISBN-10: 3882437812
- Artikelnr.: 09817742

Wie Gerold Späth einen
Seemannsknoten schürzt
Wozu nimmt eine kleine Gesellschaft in einer Nussschale – Skipper, Schiffskoch, Maschinist – noch eine Landratte mit an Bord? Bloß weil sie lesen kann? Und warum heuert dieser Neuling namens James Keller auf der White Queen an, einem völlig heruntergewirtschafteten Raddampfer? Nur weil er sonst nirgends Arbeit findet? Und was bewegt Mascha, das schönste Mädchen der Welt, ihm auf die „Galeere” nachzuspringen, da sie noch kaum ein Wort miteinander gewechselt haben? Und wo soll’s hingehen mit diesem verkommenen Müll- und Kehrichtschiff, dieser schwimmenden Rostlaube aus der Gründerzeit? Rauf in die Sümpfe am oberen Flusslauf, um James an die Kannibalen zu verfüttern? Und weshalb möchte der Kapitän, dieser Kaloschengoschier, die Reise via Big Bay zum Katarakt hinauf haarklein dokumentiert haben, wenn er doch paranoid ist und Protokolle fürchtet wie der Teufel das Weihwasser?
Tscha-tscha-tscha machen die Schaufelräder, doch zum Tanz bleibt keine Zeit: Alle naselang braucht die Maschine (die Domäne von Mister Summer) eine „Rutsche”, weil Seine Admiralität das Geld für die Kohle verspielt haben. Eine Rutsche ist eine Slider stinkenden Abfalls, und die hält nie lange vor. So schuftet also James Keller-Gallagher (James wie Jim wie Shem the Penman und Gallagher wie Heninghan und Flanagan oder Finnegan) in der Hitze, damit der Salondampfer nicht an Fahrt verliert. Und muss zwischendurch Kapitän Roald Mandersson Rede und Antwort stehen, Mascha bedienen und sich in der Kombüse (der Domäne des chinesischen Kuli Tipu) ruinöse Schachereien gefallen lassen.
Statt Komfort, Ruhe, Freundlichkeit also Schufterei bis zum Abwinken. Zum Hauptgeschäft, dem Logbuch, kommt er indes nicht: „Und kühl beflügelt gibt der Schreiberling freimütig zu, bis anhin noch nicht viel, eigentlich gar nichts, genau genommen keine einzige Zeile, da dauernd Slide um Slide und so weiter und drum sozusagen nie richtig Zeit, wirklich schlicht nicht.” Ein verfluchter Beschiss, das alles, jeder unzufrieden und an der Grenze zur Meuterei: Maschinist Sumner ist sauer, weil der Kapitän der White Queen immer tiefer in den Ruin fährt, Tipu, weil die diversen Irrsinnsverträge, die er dem scheint’s so unbedarften James (alias Shem oder Shaun usw.) aufnötigt, platzen wie ungedeckte Schecks, und Madame Mascha schließlich, weil sie zusehen muss, wie ihr „Stahlstößel” unter der Mühsal des Jobs zur „schlappen Gurke” degeneriert.
Die White Queen ist ein Lebenszeit-Diebstahlsschiff: Sie schippert auf einem „ewigtrüben Spiegel”, flussauf und flussab, „nichts zu sehen und ringsum noch mal nichts”, während die Wochen und Monate wie Minuten und Sekunden verfliegen. Dreimal öffnet Gerold Späth seinen wundersamen Erzählfächer, um uns zu zeigen, wie ein Leben im ereignislosen Raum verlaufen kann: Die „Kurze Vita des genialen Linsenschleifers Bloomfeldt” besteht aus Wiederholungen mit geringfügigen Variationen; der Knabe, der einem weißbärtigen Waldmenschen ewig und drei Tage aus alten Schwarten vorlesen muss, ist für immer im Dschungel gefangen; und der feiste Mechaniker, der die Liebe und eine Schar Kinder kommen und gehen sah, hat schon seit „langen rostigen Jahren” keine Perspektive mehr. Doch dieser Mechaniker ist „Vorgeschichte” nur zu unserer Geschichte: Auch er war einmal ein junger Kerl mit einer schönen Frau, auch er träumt schwer vom stampfenden tscha-tscha-tscha des Raddampfers, auch er heißt Keller und hat, Potzblitz, eine junge, schlanke, wunderschöne Tochter.
Alles Schwindel
Wer da die Nachtigall nicht trapsen hört, der ist für die Literatur verloren. Eine Literatur, die aus der Literatur kommt und in sie zurückführt, die Maskenspiel ist, Mythos und Märchen – Sisyphos, der Froschkönig und „Zwerg Rumpelstilz” werden bemüht. Zugleich aber liest sich Gerold Späth diesmal wie der mittlere Joyce (um nicht „der späte” zu sagen), komisch, bizarr, wortverliebt – Seggenstrünk, Schlawickel, Hundsfurz –, jedoch unangestrengter, beiläufiger, schlanker auch, wie eine Kombination quasi von Avantgarde und Genremalerei, wobei „Avantgarde” die moderne Registertechnik meint, mit der Späth arbeitet, das erzählte Erzählen und das virtuose Spiel mit einem zyklischen Geschichtsmodell, und „Genre” die Geburt des Ereignisses aus der Tradition, aus dem Sujet bedeutet.
Wir sagen nicht „Moby Dick” oder „Lord Jim”, denn wir wissen es nicht genau. Das Textbegehren jedenfalls, das vom Kapitän an den Bordsekretär ergeht, die Forderung nach einem präzisen Fahrtbericht, „buchstabengenau” bis zum „letzten Punkt!”, ist auch eine Forderung des Erzählers an sich selbst, ein Verlangen höchster Autorität sozusagen. Und diese Autorität steht weit über der des Kapitäns, der ohnehin laufend zur lächerlichen Figur herunterstilisiert wird. Kapitän Manderssons ist zwar auch der erste Kritiker unseres Erzählers und wird die erste Version seines zu farbig geratenen Berichts in Fetzen reißen, aber er wird nicht das letzte Wort haben in dieser Geschichte, in der es darum geht, dem „Schwindelsystem” an Bord der White Queen ein Ende zu bereiten und stattdessen ein Schwindelsystem höherer Ordnung zu etablieren. Denn „wir brauchen eine erstklassige Hand”. LUTZ HAGESTEDT
GEROLD SPÄTH: Die gloriose „White Queen”. Ein Abenteuer. Steidl Verlag, Göttingen 2001. 140 Seiten, 32 Mark.
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.diz-muenchen.de

Mein Dampfer fährt auch ohne Urwald: Gerold Späths Seestück
Wenn es sich bei Gerold Späths Erzählung "Die gloriose White Queen", wie der Untertitel verrät, um eine richtige Abenteuergeschichte handeln soll, wäre es unfair gegenüber dem künftigen Leser, Verlauf und Ausgang allzu genau zu referieren. Daher versuchen wir es möglichst grobmaschig: Der Ich-Erzähler hängt abgebrannt irgendwo in den Tropen herum, sucht Arbeit und verdingt sich schließlich auf einem schrottreifen Raddampfer. Zuvor hat er sich noch stehenden Fußes in ein schönes Mädchen verliebt, die er aber ihrer inständigen Bitte zum Trotz zurückläßt. Doch gelingt es der Schönen, in letzter Sekunde an Bord zu springen. Das Schiff wird von einem launischen Tyrannen kommandiert, ihm dienen ein nur selten an Deck kommender Heizer mit hoher Stimme und ein kleinwüchsiges und intrigantes Männchen, das hauptsächlich als Koch fungiert. Der Ich-Erzähler muß dem Heizer regelmäßig Abfall herunterschaufeln, mit dem der Dampfer angetrieben wird.
Der Erzähler gehört aber zu einer qualifizierten Minderheit an Bord: Er kann schreiben und lesen. Also soll er für den Kapitän auch noch eine die Fahrt preisende Chronik schreiben. Nach einigen Tagen beichtet er ihm, bei einem gemeinsamen Besäufnis leichtsinnig geworden, noch keine Zeile verfaßt zu haben. Dies führt dazu, daß er am nächsten Tag arretiert wird und eine verlogene Geschichte schreibt, die viel schöner und abenteuerlicher ist als die tatsächliche Fahrt, die gekennzeichnet ist von Gestank, schwerer monotoner Arbeit bei sengender Hitze, trübem und stehendem Wasser, und vor allem: von völliger Sinn- und Ziellosigkeit.
Dies darf man als eine Parabel auf die Rolle des Schriftstellers in einer Diktatur lesen. Mehr noch geht es Späth wohl allgemein um jene weisen Philosophen, die als einzige begreifen, daß der vermeintliche Fortschritt sich aus dem Gedankenmüll vergangener Utopien speist. Dafür ist das ziellos fahrende, müllbetriebene Narrenschiff eine glänzende Metapher.
Solche Erkenntnis wird aber erst einmal durch Späths Sprache verdunkelt. In der Tradition Döblins paßt sich sein Sprachstil den Figuren an. Das Milieu beispielsweise seiner Schweizer Mitbürger in früheren Werken erforderte für ihn eine andere Sprache als dasjenige nah am Äquator gestrandeter Seeleute. Doch treibt er es zu weit und wird einfach nur noch vulgär. Offenbar will er die ganze nautische Epik der letzten Jahrhunderte parodieren. Dies wäre ihm gelungen - um den Preis einer schnellen Ermattung des Lesers, der sich nämlich mitunter nachgerade die Ohren zuhalten möchte vor soviel seemännischen Flüchen, Stereotypen und running gags.
"Er wirft die Arme übers Geländer", heißt es über den Kapitän, "klaftert sie über der glitzernden Schleimscheiße, brüllt Arra!" Gleich am Anfang wird zum recht billigen Amüsement ein Stotterer vorgeführt: "Hahast du etwas Bebesonderes vor in Sasan Cerbo? Einen Job suchen, was sonst! Bin blank wie Aaron Wanderstab nach vierzig Jahren Wüste. Sonst suchst dudu da ninichts? Weiber, klar! Und du, Johnny Quittenkern? Na, dadann mamach's gut. Jaja, dudu auch." Derart tropischen Männerdialogen meinte man spätestens seit dem siebzehnten Lebensjahr glücklich entkommen zu sein.
Die Fähigkeit des situativ bedingten Sprachwechsels trieb Späth diesmal allzusehr in die Rolle eines naßforsch Seemannsgarn spinnenden Autors. Er stieg, abstrus genug, hinter die Maske eines Schweizer Seebären. Aber auch diese Mimikry vermag nicht zu verdecken, daß sich hinter ihr gelegentlich ein sensibler Beobachter menschlicher Narreteien versteckt. Doch wirkt die Sprache furchtbar angestrengt und hohl. Und die Personen sind episch kaum lebensfähig, weil sie fast nur Klischees bedienen. Daher möchten wir Gerold Späth für die Zukunft wünschen, daß er zu einem glaubwürdigeren Umgang mit seinem Personal sowie zu einer etwas sensibleren Sprache zurückfindet und weniger bramarbasiert.
MARTIN THOEMMES.
Gerold Späth: "Die gloriose White Queen". Ein Abenteuer. Steidl Verlag, Göttingen 2001. 137 S., geb., 16,50 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Martin Thoemmes will, da die Erzählung als Abenteuergeschichte daher kommt, nicht zu viel vom Plot verraten, in dem der Ich-Erzähler auf einem alten Raddampfer landet und nun eine " die Fahrt preisende Chronik" verfassen soll. Aber der Rezensent hat schnell erkannt, dass es sich bei dem Text um eine "Parabel" handelt, in der zum einen das Schicksal des Schriftstellers in einer Diktatur dargestellt wird, zum anderen aber darüber philosophiert wird, dass der "vermeintliche Fortschritt sich aus dem Gedankenmüll vergangener Utopien speist". Alles in allem hat der Autor mit dem "müllbeladenen Narrenschiff" eine "glänzende Metapher" gewählt - würde er sie nur nicht durch seine Sprache verschleiern, so Thoemmes bedauernd. Die ist dem Rezensenten nämlich viel zu "vulgär". Er gesteht, sich angesichts des deftigen Seemannsgarns mitunter die "Ohren zuhalten" zu wollen. Außerdem sind ihm die Figuren zu klischeehaft, und er wünscht sich für zukünftige Bücher des Autors mehr Glaubwürdigkeit der Protagonisten und eine weniger "nassforsche" Sprache.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH