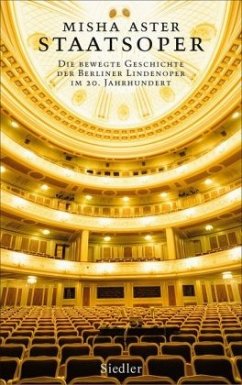Ein deutsches Opernhaus - Von der Weimarer Republik bis zur Wiedervereinigung
Am 3. Oktober 2017 kehrt die Berliner Staatsoper nach einer siebenjährigen Zwangspause wieder an ihren ureigenen Ort zurück - ein Ereignis von internationaler Bedeutung. Misha Aster, Autor des viel beachteten und verfilmten Buchs "Das Reichsorchester", erzählt die Geschichte der Staatsoper Unter den Linden vom Kaiserreich bis in unsere Tage und lässt damit ein farbenreiches Bild des stürmischen 20. Jahrhunderts entstehen, in dem die Musik immer wieder vor den Karren der wechselnden politischen Systeme gespannt wurde.
Am 3. Oktober 2017 kehrt die Berliner Staatsoper nach einer siebenjährigen Zwangspause wieder an ihren ureigenen Ort zurück - ein Ereignis von internationaler Bedeutung. Misha Aster, Autor des viel beachteten und verfilmten Buchs "Das Reichsorchester", erzählt die Geschichte der Staatsoper Unter den Linden vom Kaiserreich bis in unsere Tage und lässt damit ein farbenreiches Bild des stürmischen 20. Jahrhunderts entstehen, in dem die Musik immer wieder vor den Karren der wechselnden politischen Systeme gespannt wurde.

Nach Jahren der Sanierung kehrt die Berliner Staatsoper ins Haus Unter den Linden zurück. Misha Aster
erzählt in einem großen Buch, wie die verschiedenen politischen Systeme im 20. Jahrhundert dieses Opernhaus für sich nutzten
VON WOLFGANG SCHREIBER
Oper und Politik sind untrennbar. Kein Opernhaus im 20. Jahrhundert wurde so heftig von politischen Krisen und Kriegen geschüttelt wie die Berliner Staatsoper „Unter den Linden“. Der kanadische Historiker Misha Aster hat schon die Berliner Philharmoniker als das „Reichsorchester“ der Nationalsozialisten identifiziert, er macht jetzt plausibel, wie weit es „mit dem bekanntlich sehr alten Phänomen der Instrumentalisierung von Kultur durch Politik“, so Daniel Barenboim im Vorwort, kommen konnte. Ob im Kaiserreich oder der Weimarer Republik, im Nazireich oder dem Realsozialismus der DDR, die Mächtigen wollten in der vom Alten Fritz 1742 erbauten Berliner Oper nie nur den schönen Stimmen lauschen. Das „Kraftwerk der Gefühle“ verleitete sie dazu, sich der Oper zweifach zu bemächtigen: für Macht und Luxus. Der Buchtitel deutet auf die Doppelfunktion: Staatsoper.
Die Geschichte dieser Staatsoper lese sich, beginnt Aster, „wie eine Chronik des deutschen 20. Jahrhunderts“, mit den Zutaten „Tradition und Schmerz, Tragödie und Mut, große Erfolge und tiefes Scheitern – Begleitung und Taktschlag für die unermüdliche Suche des Landes nach seiner Identität“. Eine Staatsoper als Terrain nationaler Selbstfindung? Immerhin sucht der Autor auch nach Ironie – mit passenden Opernzitaten für Kapitelüberschriften: „Wir arme Leut’“ spielt an auf die Weimarer Republik und die an der Staatsoper 1925 gespielte Uraufführung von Alban Bergs „Wozzeck“. Oder: „Stürmisch bricht sich Bahn des Volkes Kraft“, in Mussorgskijs „Boris Godunow“, steht über dem letzten der drei Nachkriegs- und DDR-Kapitel. Alte und neue Turbulenzen rütteln immerzu an Kunst und Politik.
Das 20. Jahrhundert hatte mit einem Paukenschlag begonnen. Von 1908 an war der Komponist und Dirigent Richard Strauss Generalmusikdirektor der „Königlichen Schauspiele“ zu Berlin. Und da der berühmte und geschäftstüchtige Musiker aus München seine dezidierten Repertoire-Wünsche und hochgeschraubten Honorarforderungen auch noch mit dem Wunsch nach Reduzierung seiner Berliner Tätigkeiten verknüpfte, meldete sich der Generalintendant, der ihm 1918 brieflich mit einer einzigen Frage praktisch kündigte: „Sind wir es, die den Richard Strauss brauchen, der bei seinen sporadischen Anwesenheiten hier (...) seine Honorare tunlichst rasch herunter zu dirigiere suchte?“ Strauss flirtete da schon mit der Wiener Staatsoper. Wochen später war der Erste Weltkrieg zu Ende, das deutsche Kaisertum gestürzt und das Opernhaus mit dem Namen „Preußische Staatsoper“ versehen. Deutschnational ging es mit den „Meistersingern von Nürnberg“ in die neue Epoche.
Es begann die stürmische Epoche der Weimarer Republik, es erhob sich die Fürsprache des linken preußischen Musikadministrators Leo Kestenberg, es triumphierte für wenige Jahre das von ihm ins Leben gerufene, von der Staatsoper bespielte Experiment Kroll-Oper. Die künstlerischen Errungenschaften dort kamen einer revolutionären Neudefinition der Oper gleich – durch den modernen Regie- und Bilderstil von Bauhauskünstlern wie Laszló Moholy Nagy oder Oskar Schlemmer, musikalisch im Zeichen einer Neuen Sachlichkeit, der kantigen Anti-Romantik des genialen Dirigenten Otto Klemperer.
Leider ist der künstlerische und gesellschaftliche Höhepunkt der Staatsoper in der Weimarer Republik, die Uraufführung von Alban Bergs Jahrhundertwerk „Wozzeck“ am 14. Dezember 1925, bei Aster nur eine Episode. Die Stimmungsmache von Politik und Presse gegen die atonale Oper und die Abneigung des umstrittenen Intendanten Max von Schillings gegen den Dirigenten Erich Kleiber werden nur gestreift. Wenig erfährt man über Substanz, dramaturgische Tiefe und historische Bedeutung der Oper.
Die jähe Schließung der künstlerisch brillanten Kroll-Oper 1931 ist Resultat politischer Intrigen in der zerrütteten Parteienlandschaft um die aufsteigenden Nazis. Schon vor Hitlers „Machtergreifung“ gab es eine NSDAP-Zelle in jener Staatsoper, die dann, gegen so ohnmächtige Querköpfe wie Furtwängler, Kleiber oder Klemperer, ins NS-Reich hineingezwängt wurde. Heinz Tietjen war die graue Eminenz auf der Berliner Musikszene, ein machthungriger Regisseur, der sich in Bayreuth mit Winifred Wagner verbündete. Tietjen zog rasant seine Fäden, um zwischen den eifersüchtig sich belauernden Protagonisten Hitler, Göring, Goebbels in dieser „Oper im Gleichschritt“ das Spiel politischer Interessen auch noch mit künstlerischer Qualität zu versöhnen. Und das junge „Wunder“ Karajan wurde als Waffe gegen den unbequemen Furtwängler in Stellung gebracht.
Nach dem Weltkrieg entbrannten sofort Kämpfe der neuen Mächtigen und ihrer Paladine um das – plötzlich in „Ostberlin“ gelegene – Opernhaus. Das zweite Engagement des großen Erich Kleiber, des Generalmusikdirektors von 1923 bis 1935, scheiterte kläglich. Der lautere Künstler, aus dem argentinischen Exil zurückgekehrt, wollte und sollte der Staatsoper wieder dienen. Doch er mochte „in keine Politik hineingezogen werden. Ich will nur Musik machen. Wenn man mir mit Politik kommt, schmeiße ich alles hin“, schrieb Kleiber, dessen Künstlerruhm auch den DDR-Oberen Wilhelm Pieck und Walter Ulbricht attraktiv erschien, im Brief an den Intendanten Max Burghardt. Kleiber geriet in die Mühle des Kalten Krieges zwischen Ost und West: Die (West-)Berliner Philharmoniker etwa mussten ihn, vom Senat gedrängt, wieder ausladen, weil er an der (Ost-)Berliner Staatsoper dirigierte.
Nur ein Detail verursachte Kleibers definitiven Abgang. Als die alte lateinische Inschrift an der Front von Richard Paulicks Rekonstruktion der Rokoko-Staatsoper plötzlich entfernt wurde, dort statt der goldenen Lettern FRIDERICUS REX APOLLONI ET MUSIS nur noch „Deutsche Staatsoper“ prangte, empfand Kleiber dies als „ein trauriges, aber sicheres Symptom, dass – wie im Jahr 1934 – Politik und Propaganda vor der Tür dieses ‚Tempels‘ nicht haltmachen werden“. Nationalpreisträger Franz Konwitschny dirigierte die „Meistersinger“ zur Eröffnung am 5. Oktober 1955.
„Die symbiotische Verbindung zwischen Staat und Opernhaus“ prägte die kommenden Jahrzehnte Unter den Linden im Ost-West-Konflikt, mit Mauerbau und der Ideologie des SED-Staates – übrigens mit künstlerischem Gewicht, auch dank des die Kunst-Politik-Gratwanderung klug balancierenden Intendanten Hans Pischner. Künstlerische Hochleistungen entstanden durch Größen wie den Dirigenten Otmar Suitner oder die Regisseurin Ruth Berghaus sowie erstrangige Gesangsstars. Im Oktober 1989 verfasste die Staatskapelle einen offenen Brief an Kurt Hager, den Chefideologen Erich Honeckers, um Reformen der Zustände im Lande zu fordern: Man stelle sich „einen Sozialismus vor, in dem die Fruchtbarkeit des Pluralismus der Meinungen und Ideen zum Tragen kommt“. Danach fiel die Mauer.
Die Oper der „Wendezeit“ kann rasch erzählt werden, denn die Politik quält oder verführt die Institution nicht mehr, nahm sie höchstens strukturell und ökonomisch in die Pflicht. Die Anfangsjahre der neuen Ära enthielten vielerlei „Ängste, Kontroversen und Spannungen“. Umso rückhaltloser bewundert der Autor Daniel Barenboim, den Generalmusikdirektor seit 1992, bis heute Kopf und Herz des Opernhauses. Misha Aster hat die verschlungenen Wege der Berliner „Staatsoper“ mit dem emotionalen Elan des findigen, die historischen Quellen virtuos ausschöpfenden Geschichtsschreibers erzählt. Das klingt schon an in der euphorischen Widmung des Buchs, womit er seine „Eltern in grenzenloser Liebe“ hochleben lässt.
Strauss fiel mit seinen dezidierten
Repertoire-Wünschen und
hochgeschraubten Honoraren auf
Rückhaltlos bewundert der Autor
Daniel Barenboim, der seit 1992
Generalmusikdirektor ist
Staatsopernbesuch: Zuschauer in der Oper Unter den Linden im Oktober 2017.
Foto: Imago
Misha Aster: Staatsoper. Die bewegte Geschichte der Lindenoper im 20. Jahrhundert. Übersetzt von Martin Richter. Siedler Verlag, München 2017. 544 Seiten, 28 Euro. E-Book 22,99 Euro.
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de

Unter den Linden: Die Deutsche Staatsoper zeigt heute ihre erste große Premiere im erneuerten Haus. Misha Aster folgt ihrer Geschichte durch das zwanzigste Jahrhundert.
Im Buch des kanadischen Autors Misha Aster über die Berliner Staatsoper im zwanzigsten Jahrhundert gibt es erfahrungsschwere Sätze. "Wenn die Geschichte der Staatsoper etwas lehrt", lesen wir, "dann, dass die Politik ebenso unbeständig ist wie die Kunst und das Schicksal nicht vorhersehbar." Aber das Buch ist mehr als eine Sentenzensammlung. Misha Aster, der als Operndramaturg und -regisseur, aber auch als Firmen- und Stiftungsberater tätig ist, legt eine Darstellung vor von Richard Strauss' versuchter Machtergreifung an der Lindenoper im Jahre 1918 bis zu Barenboims gelungener anno 1991. Für sie hat er alle möglichen Archive konsultiert, aber auch zahlreiche Bücher und Briefwechsel.
Aster macht interessante Funde. Etwa die tolle Geschichte, dass Boleslaw Barlog vom Kultursenator Tiburtius bei der Eröffnung des Schillertheaters im September 1951 nicht nur auferlegt wurde, seinen Intendantenkollegen aus dem östlichen Teil der Stadt - das waren Ernst Legal, Walter Felsenstein, Wolfgang Langhoff und Fritz Wisten - keine Ehrenkarten zu geben, sondern sie, falls sie Kaufkarten erwerben würden, aus dem Saal zu verweisen. Als Erich Kleiber als Dirigent 1951 zu seiner alten Staatskapelle mit der erklärten Absicht zurückkehrte, im wiederaufgebauten Haus Unter den Linden erneut an ihrer Spitze zu stehen, nötigte Tiburtius die Philharmoniker, ein mit Kleiber vereinbartes Dirigat aufzukündigen.
Zu den Peripetien eines unter Aufsicht der Besatzungsmächte eingefrorenen Bürgerkriegs zählte auch die unvermittelte Absage Erich Kleibers im Frühjahr 1955, ein Haus musikalisch zu übernehmen, dessen Wiederaufbau in einer an den alten Knobelsdorff-Bau angelehnten Gestalt er im Juni 1951 mit dem DDR-Präsidenten Wilhelm Pieck durchgesetzt hatte. Als man hinter Kleibers Rücken die historische Inschrift "Fridericus Rex Apollini et Musis" durch "Deutsche Staatsoper" ersetzt hatte, war der Dirigent nicht mehr zu bewegen, an das Haus zu kommen. Er erlag ein Jahr später einem Herzinfarkt.
Aster beleuchtet die Hintergründe dieses Vorfalls kaum, trägt aber manches Aufklärende zur Geschichte Kleibers bei. Sie beginnt schon mit dessen Eintritt in die Lindenoper im Jahre 1923, zu einer Zeit, da zwei Referenten des sozialdemokratisch regierten preußischen Innenministeriums, Leo Kestenberg und Ludwig Seelig, darangegangen waren, die bis 1918 aus dem Etat des Königshauses finanzierte Hofoper in eine Staatsoper mit sozial wie künstlerisch progressivem Programm umzuwandeln. Sie fanden in Kleiber den idealen musikalischen Exponenten ihrer kulturpolitischen Absichten. Denn natürlich, ob Monarchie (eine solche war auf ihre Weise auch die DDR) oder Republik, eine Staatsoper unterliegt immer kulturpolitischen Anforderungen ihrer Geldgeber, und die Frage ist, wie es dem jeweiligen Intendanten gelingt, ihnen Kunstereignisse abzugewinnen.
In der Weimarer Republik gelang dies mit Kleiber an der Lindenoper ebenso wie mit Otto Klemperer an der sogenannten Krolloper, die auf Wegen, die Aster akribisch nachzeichnet, zum zweiten unabhängig geleiteten Haus der Staatsoper wurde und zum Eldorado eines innovativen Ensembletheaters, bevor sie 1930, wie Aster nachweist, nicht etwa durch Obstruktion des Intendanten, sondern einzig am schwindenden Interesse des Publikums scheiterte.
Einen frühen Höhepunkt hatte Kleibers Engagement für eine Oper neuen Typs in der Uraufführung von Alban Bergs "Wozzeck" im Dezember 1925 gefunden; dies ist die einzige Aufführung, die Aster, der das Werk selbst inszeniert hat, nicht nur erwähnt, sondern beschreibt. Sein Buch gibt keine Aufführungs-, sondern eine Direktions-, auch Intrigengeschichte des Hauses.
Die durch Hans Pischner, den Intendanten der Jahre 1963 bis 1984, abgesicherte Arbeit von Ruth Berghaus an der Staatsoper erscheint bei Aster summarisch als "Antwort der Staatsoper auf Felsenstein", ein Wirken, das immerhin von 1965 bis 1991 reichte. Das Problem des 1978 geborenen Autors ist: Er hat nichts davon gesehen und gehört. Er berichtet eingehend über den politischen Gegenwind, auf den im Februar 1951 die Uraufführung von Bertolt Brechts und Paul Dessaus "Die Verurteilung des Lukullus" bei der SED-Führung gestoßen war. Aber statt Brechts Bericht über die Umarbeitung des Werkes zu Rate zu ziehen, das sich ein halbes Jahr später in einer zweiten Fassung dauerhaft durchsetzte, gibt er einen Notizzettel Wilhelm Piecks von einer Unterredung mit den beiden Autoren zum Besten.
Aster greift mal hierhin, mal dorthin in dem großen Aktenkoffer, mal ist das ergiebig, ein andermal überflüssig; und im dritten Fall unterlässt er den zweiten Griff, so wenn ihm entgeht, dass der Protest der SED-Gruppe der Staatsoper gegen das Programmheft der Berghausschen "Elektra" von 1966 mit dem Illustrator dieses Heftes zusammenhing. Das war zugleich der Mann, der Berghaus' erfolgreichster Inszenierung, dem "Barbier von Sevilla", die Bühnengestalt gab und der heute im erneuerten Haus als Regisseur und Bühnenbildner von "Hänsel und Gretel" wiederum in Erscheinung tritt: Achim Freyer.
Aster weiß nichts von den Kämpfen, die der Uraufführung von Paul Dessaus "Puntila" vorausgingen; er erklärt Theo Adam, den Sänger der Titelrolle dieser Uraufführung, ebenso wie Peter Schreier zu Widersachern der Regisseurin, die beide Sänger in exemplarischen Rollen erfolgreich einsetzte. Es geht in diesem Fall wie auch bei anderen Einschätzungen des Autor: Was er sagt, ist oft weder ganz richtig noch richtig falsch. Wenn ein deutscher Dramaturg die Geschichte der Canadian Opera Company schriebe, wäre das Ergebnis vermutlich ähnlich. Zudem hätten Asters englischer Text und seine Übersetzung auch der gründlichen Überarbeitung durch ein Lektorat bedurft.
Aster gibt keinerlei Interesse an der Architektur des Hauses zu erkennen, dessen Verwaltungsstrukturen er eine so umfassende Aufmerksamkeit widmet. Was es mit Paulicks Innenarchitektur auf sich hatte, die eine raffinierte, geradezu geniale Synthese aus struktureller Modernisierung und Dekor-Zitaten aus dem Sanssouci Knobelsdorffs vollzog, entgeht ihm so vollständig, dass er über Kleibers Mitwirkung an dem Wiederaufbaukonzept vermeint: "Tatsächlich führte die ständige persönliche Einmischung des Dirigenten zu einer grundlegenden Veränderung der alten Akustik wegen des Einbaus eines vierten Rangs unter der Decke." Umgekehrt wird ein Schuh daraus: Paulick ließ nicht nur die Logen der früheren Rangstruktur weg, sondern auch den an der Decke klebenden vierten Rang, dessen Sichtverhältnisse miserabel waren.
Dennoch hat Aster ein interessantes Buch geschrieben. Zwar ermüdet es, dem Briefwechsel des preußischen Generalmusikdirektors Richard Strauss mit alten und neuen Staatsgewalten zu folgen. Aber es ist fesselnd, darüber zu lesen, wie es der Initiative des Orchesterdirektors der Staatskapelle, dem Geiger Lothar Friedrich, gelang, nach dem Rücktritt Otmar Suitners als Chef der Staatskapelle Barenboim ins Spiel zu bringen, der gerade in Paris an der Direktion der Bastille-Oper gescheitert war. Es war Richard von Weizsäcker, der Barenboim den Weg zur direktorialen Vollmacht ebnete und damit Pläne durchkreuzte, die Lindenoper zum kleinen Haus der Charlottenburger Deutschen Oper herabzustufen. Es war, wie man unlängst erfuhr, auch Weizsäcker, der im Jahre 2008 Daniel Barenboim durch einen Anruf davon überzeugte, von der Vernichtung der Paulickschen Innenarchitektur Abstand zu nehmen, die der Dirigent unter akustischen Aspekten verworfen hatte.
Was für Asters Buch jenseits vieler Defizite und Kurzschlüsse einnimmt, ist sein Gefühl für die zentrale Rolle des Hauses in der deutschen Operngeschichte und ebenso, dass er die Lage der Staatsoper in den Bedrängnissen des Kalten Krieges mit allem Realismus beleuchtet. Im Blick auf Tietjen gelingt ihm etappenweise die Beschreibung eines Intendantengenies, an dessen Berliner Wirken von 1925 bis 1957 sein Buch einen roten Faden hat - niemand kommt häufiger darin vor.
Wie Tietjen, ein unprätentiöser, ja unauffälliger Mann, im Zusammenwirken mit der sozialdemokratischen Kulturverwaltung in den zwanziger Jahren zum erfolgreichen Direktor aller preußischen Staatstheater von Berlin bis Wiesbaden und Kassel wird und, ohne jemals in die NSDAP einzutreten, diese Position nach Hitlers Staatsstreich mit Hilfe Winifred Wagners aufrechterhalten kann und wie er, durch den sowjetischen Stadtkommandanten im Mai 1945 abermals zum Berliner Opernchef berufen, durch Ernst Legal ersetzt wird und drei Jahre später im Bund mit dem aus dem Exil zurückgekehrten Leo Blech die West-Berliner Städtische Oper übernimmt - all dies stellt sich als ein Opernroman eigener Art dar.
Dass der Staatsoper in dem Cembalisten Hans Pischner zu DDR-Zeiten ein anderes Intendantengenie beschieden war, das, von Stasi-Observanten umlagert, das Haus einer vitalen Moderne öffnete, ist Aster nur am Rande aufgegangen. Sein Buch ist ein Anfang, eine mit Fleiß bereitete, von gutem Willen geleitete Untersuchung, in der für künftige Autoren mannigfache Anregungen bereitliegen.
FRIEDRICH DIECKMANN
Misha Aster: "Staatsoper". Die bewegte Geschichte der Berliner Lindenoper im 20. Jahrhundert.
Aus dem Englischen von Martin Richter. Siedler Verlag, München 2017. 544 S., Abb., geb., 28,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
"Misha Aster hat die verschlungenen Wege der Berliner "Staatsoper" mit dem emotionalen Elan des findigen, die historischen Quellen virtuos ausschöpfenden Geschichtsschreibers erzählt."" Süddeutsche Zeitung