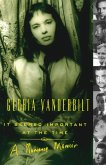Wer kennt die Opern Albéric Magnards? Oder Cherubinis "Medea"? Dvoráks "Dimitrij"? Gemessen an der Zahl der Werke, deren Aufführung sich lohnen würde, ist das Repertoire der Opernhäuser schmal. Jens Malte Fischer, bekannt geworden als Biograph Gustav Mahlers, ist auch mit den Stiefkindern der Spielpläne vertraut. In seinen Essays stellt er einige von ihnen vor und findet gute Gründe, sich näher mit ihnen zu beschäftigen.
Dieses Buch ist ein großes Plädoyer für die Kunst der Oper. Es führt die ungeheure Vielfalt ihrer Ausdrucksformen vor Augen und demonstriert ihre politische und gesellschaftliche Aktualität. Pflichtlektüre für alle, die die Musik - und speziell die Oper - lieben.
Dieses Buch ist ein großes Plädoyer für die Kunst der Oper. Es führt die ungeheure Vielfalt ihrer Ausdrucksformen vor Augen und demonstriert ihre politische und gesellschaftliche Aktualität. Pflichtlektüre für alle, die die Musik - und speziell die Oper - lieben.

Jens Malte Fischer über das „Wunderwerk der Oper”
Wer über Oper schreibt, sollte wissen, was eine Hemiole ist, und wie absolutistische Herrschaft funktionierte. Er hat sich mit deutscher Philosophie des 19. Jahrhunderts auszukennen, und mit der Schrittfolge beim Menuett. Die Stimmlage der Ehefrau Rossinis möge ihm geläufig sein, sowie der Zustand der französischen Staatsfinanzen im Ancien Régime. Die gelehrte Welt ist nicht üppig gesegnet mit Individuen, die solches in ihrem Kopf zusammenbringen.
Aus diesem Grunde sind unzulängliche Bücher über die Kunstform Oper eher die Regel. Zu den raren Exemplaren unter den Schreibenden, die über das nötige musikalische, literarische, dramaturgische, philosophische, ökonomische, politische, historische Wissen entweder verfügen oder nötigenfalls auf die Idee kommen, es sich zu verschaffen, zählt Jens Malte Fischer.
Wer solche Mühen der Erkenntnis auf sich nimmt, muss einen Grund haben, und zwar vermutlich einen besseren als den einer Professur an der Münchner Universität. Fischer glaubt, einen solchen starken Grund gefunden zu haben. Er hält die Oper für die „Kunstform, die am weitesten von Vulgarität entfernt ist”. Die Freunde von Sonett und Streichquartett mögen es ihm verzeihen. Nicht dass ihre Vorliebe schlechten Geschmack verrieten, ist Fischers Pointe. Aber das Transzendieren der prosaischen Rede im ausschweifenden Gesang der Oper und der durch keinen Realismus oder Naturalismus zu bändigende Ehrgeiz, die Kräfte aller Künste auf ein Ziel zu spannen, entzünden für Fischer einen utopischen Funken, der ihm einige Superlative wert ist.
Wie sehr der Opernbetrieb tätig ist, diesen Funken zu ersticken, ist Fischer nicht entgangen. Doch seine geschichtsphilosophische Idee der Oper, die er Adorno entlehnt, ließ er sich nicht nehmen. Und er hat sich erlaubt, sie eben nicht zum wiederholten Male am letzten Finale des „Figaro” zu exemplifizieren, an „Fidelio” oder „Tristan”.
Erkenne die Machart
Diese Abstinenz mag zunächst eher befremden als erfreuen. Was ist das für ein Opernbuch, wird sich mancher fragen, der es zur Hand nimmt, in dem Mozart nur ganz am Rande vorkommt, der französische Wagnerianer Albéric Magnard hingegen auf mehr als vierzig Seiten gewürdigt wird? Die Antwort lautet: Es ist ein Opernbuch, das zu Entdeckungen Anlass geben will und gibt. Dass dazu inhaltlich recht Disparates aus Programmbüchern und Sammelbänden zwischen zwei Buchdeckel gebracht wurde, macht gar nichts; im Gegenteil, es erhellt den disparaten Charakter der Gattung.
So steht nun der Walkürenritt in der NS-Wochenschau neben Cavallis „Giasone”, „Surabaya-Johnny” neben Cherubinis musikalischer Tragödie, und die Contenance der Feldmarschallin neben der Altersversorgung an deutschen Staatstheatern. Und genau das ist, neben vielem anderen, Oper.
Fischer nennt das Kunstgebilde Oper ein „Wunderwerk”. Hieße das Buch „Vom Wunder der Oper”, sein Titel wäre Kitsch. „Vom Wunderwerk der Oper” ist etwas ganz anderes. „Werk” legt den Akzent darauf, wie es zustande gebracht wurde. Kenntnis der Machart wirkt, hier wie sonst, zuverlässig gegen Kitsch.
Soll man einzelnes loben, wo alles derart gelang? Mir gefiel besonders der Aufsatz über Magnard, weil er unbezwingliche Neugier auf einen so gut wie Unbekannten macht. Im Vergleich zwischen dem frühen Strauss und dem frühen Pfitzner vergisst Fischer schließlich jenen über diesem ganz, zumal in musikalischer Hinsicht, und findet eindringlichste Worte für den ersten Akt des „Armen Heinrich”.
Das Glanzstück aber steht am Schluss des Bandes. Die wahre und endgültige Geschichte vom Rosenkavalier, authentisch erfunden von Jens Malte Fischer. Die Spitze gegen den akademischen Spezialisten im fiktiven Vorwort derselben sitzt, und sie steht diesem Autor zu. ANDREAS DORSCHEL
JENS MALTE FISCHER: Vom Wunderwerk der Oper. Zsolnay, Wien 2007. 301 Seiten, 24,90 Euro.
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Eine Dienstleistung der DIZ München GmbH

Jens Malte Fischer schreibt fundiert über unbekannte Opern - und krakeelt trotzdem wie auf dem Boulevard / Von Eleonore Büning
Die Oper lebt, sie wird gefeiert. Wer will da so kleinlich sein und nach Fakten fragen? Sogar Magazine, die die Kulturberichterstattung schon fast eingestellt hatten, bejubeln plötzlich "Vierhundert Jahre Oper" auf bunter Bildstrecke und widmen der elitären E-Musik-Gattung eine prachtvolle CD-Edition. Man kann Geburtstage natürlich nicht oft genug feiern. Auch wird der frisch erblühende Opernkult der musikalischen Bildung im Land am Ende nur förderlich sein. Trotzdem muss, damit Letztere keine halbe Sache bleibt, darauf bestanden werden, dass die erste Oper der Musikgeschichte nicht vor vier-, sondern vor vierhundertneun Jahren über die Bühne gegangen ist. Sie heißt nicht "Orfeo", sondern "La Dafne". Das kann sich auch jeder, der kein Musiklexikon zur Hand hat, leicht ergoogeln.
Der Komponist von "La Dafne" war Jacopo Peri, genannt "Il Zazzerino". Das Stück wurde, als erstes durchkomponiertes Werk im neuen Stil des "recitar cantando", zur Karnevalszeit 1598 in Florenz uraufgeführt, wovon leider nur noch fragmentarisch überlieferte Kopien zeugen, einzusehen in der Konservatoriumsbibliothek in Brüssel. Jens Malte Fischer bedauert es ein bisschen in seinem neuen Buch mit dem viel, wenn nicht alles versprechenden Titel "Vom Wunderwerk der Oper", dass die antiken Stoffe, mit denen die Gattung Oper um 1600 in ihre Kinderschuhe stieg, nicht gleich die großen, euripideischen Tragödien waren. Die frühe Oper begnügte sich mit dem Bukolischen: "Dass Orpheus die Ideal-Imago des singenden Einzelmenschen auf der Opernbühne war, bedarf keiner weiteren Erläuterung. Schon schwerer erklärbar ist, dass die epochemachende Aufführung des ,Oedipo Tiranno' 1585 in Vicenza mit den Chören des Venezianers Andrea Gabrieli nicht ihre unmittelbaren Folgen für die Entstehung der Oper hatte." Jede Fußnote kennt der bestens beschlagene Autor, er leuchtet in jeden Seitenweg.
Schon die zweite Oper Peris galt dann dem Orpheus-Mythos ("Euridice", 1600), und hier sind alle Unterlagen noch vorhanden, es liegt sogar eine respektable neuere CD-Einspielung vor. Weitere florentinische Opern folgten, bis schließlich im Jahr 1607 in Mantua der "Orfeo" von Claudio Monteverdi herauskam. Dass dies also gewiss nicht älteste, aber, seit sich infolge des Barockopern-Revivals der Kanon aufgeführter Werke mächtig nach rückwärts erweiterte, auf alle Fälle bekanntere Stück nun das Stichjahr abgibt für den allgemeinen Opernjubiläumsboulevardbummel, zeigt nur, dass eine auf Quote und Superlativ geeichte Medienkultur am Ende auch nicht anders arbeitet als der alte Vogel Strauß: Was der nicht sieht, das gibt es nicht und hat es nie gegeben. Das Sympathische an dem Opernbüchlein Fischers ist dagegen, dass es sich weder um Quoten noch Superlative kümmert, fast tippfehlerfrei gesetzt ist und von korrekten historischen Fakten nur so strotzt. Inhaltlich folgt Fischer dem Prinzip eines alten Kinderspiels, das genauso funktioniert, wie es heißt: "Ich sehe was, was du nicht siehst."
Der Münchner Autor, zuletzt mit einer eigenwilligen Mahler-Monographie hervorgetreten, hat es sich diesmal leichtgemacht und alte Aufsätze recycelt. Von den dreizehn versammelten Essays sind zehn schon anderswo abgedruckt worden, drei davon stammen aus Programmbüchern der Bayerischen Staatsoper. Zwei befassen sich mit Wagner-Rezeption, einer mit dem ersten Akt von Verdis "Boccanegra", ein anderer spinnt die Story vom "Rosenkavalier" weiter, einer Idee folgend, die schon Hugo von Hofmannsthal für den Rosenkavalier-Film von 1925 entworfen hatte. Ansonsten nimmt Fischer vor allem Raritäten ins Visier, die aus der Bühnenpraxis herausgefallen sind: ein Blick ins Unterholz, in den ungenutzten, den unglamourösen Fundus des laufenden Opernbetriebs. Gewiss hat dieses stolze Minderheitenprogramm auch Appellcharakter. Es geht um Neuheiten wie Wolfgang Rihms "Eroberung von Mexiko" (1992) und um versunkene Schätze wie Francesco Cavallis "Giasone" (1649) oder um die "Bérénice" (1909) des französischen Wagnerianers Albéric Magnards. Vor allem aber geht es um von der Musikgeschichte Untergepflügtes: etwa um die Historienoper "Dimitrij" (1882) von Antonín Dvorák und dessen Nähe zu Meyerbeer oder um Hans Pfitzners "Armen Heinrich" (1895), an dem Fischer besonders der "frühe Jugendstil" imponiert, das "Üppig-Sprießende" des ersten Aktes, den er für "den Höhepunkt der deutschen nachwagnerschen Oper um 1900" hält. Für fast jedes Stück bricht Fischer eine Lanze, wobei der pluralis majestatis sowie eine gewisse professorale Attitüde vom Katheder herab offenbar unvermeidbar sind. Und selbst, wo er Sujet oder Libretto ganz missraten findet wie im Falle Kurt Weills ("Geben wir es zu: ,Happy End' ist kein gutes Stück"), fallen ihm immer noch ein paar Argumente ein zur Rettung einiger Musiknummern.
Erstmals im Druck veröffentlicht ist außer der Würdigung des jungen Pfitzners auch ein faktenreicher Aufsatz über die antisemitischen Anfeindungen, die Giacomo Meyerbeers Karriere begleiteten, wohl Abfallprodukt der höchst verdienten Dokumentation über Richard Wagners Broschüre über "Das Judentum in der Musik", die Fischer vor sieben Jahren schrieb. Bereits aus dem Spektrum der Themen lässt sich der moralisch-politische Furor erahnen, mit dem sich der Autor, der von Haus aus, wie übrigens viele der besten Musikschriftsteller heutzutage, Theater- und Literaturwissenschaftler ist, seinen Gegenständen hingibt. Es kommt aber vor, dass das Moralisieren überhandnimmt, dass der hohe Tonfall plötzlich säuerlich wird und zu verschraubter Sonntagsrede absackt, etwa so: "In einer Zeit, in der versunken geglaubte nationale Leidenschaften wieder ihr Haupt erheben, haben wir Anlass, Dvorák Respekt zu zollen dafür, dass er es sich versagte, wohlfeile Emotionen zu nähren."
Man könnte daraus schließen, dass Fischer seinen "Dimitrij"-Aufsatz im Jahr der letzten Fußball-Weltmeisterschaft geschrieben hat. Es war aber das Jahr 1992, drei Jahre nach Wiedervereinigung. Erstveröffentlicht sind auch Fischers Überlegungen zur politischen Unzuverlässigkeit Antonin Artauds. Dessen Entwurf eines anarchisch-kollektiven Rauschtheaters ist dem bekennenden Aufklärer zutiefst suspekt: zu viel Sinnenreize in Artauds "Eroberung von Mexiko", zu gewaltig die Blutfontäne am Schluss, gar zu greifbar die Gefahr der Aufhebung gesicherter Ordnung. Fischer geht zwar nicht so weit, auch Wolfgang Rihms so wunderbar sinnenfreudige, gewalttätig-zärtliche und zugleich moralisch-menschheitsbessernde Veroperung dieses Stoffes im Kern anzufechten. Doch er unterstellt Rihm, dass er den "Theatervisionär Artaud" leider übersehen haben müsse. Letztlich seien Artauds Auffassungen musikfeindlich, sein Voodoo-Zauber laufe auf eine "Dekomposition" hinaus, "endend im musikalischen Kompost", ja: "Ein konsequent zu Ende gedachter Artaud müsste den Verzicht auf komponierte Musik verlangen." Nicht nur in diesem Kontext gibt es auch wohlfeile Polemiken zu lesen, etwa den Seitenhieb gegen "das aktuelle dumpfe Zerstreuungskino", das die Sinne seines Publikums nur noch abstumpfe. Ein passionierter Kinogänger ist Fischer wohl eher nicht.
Vollends borniert sind die mit der Wurst nach der Speckseite geworfenen Allerweltsnörgeleien im Vorwort, das keine zusammenfassende These zum Repertoirebetrieb aufstellt, sondern nach Trend und Quote schielt sowie nach dem Kopfnicken pausenplaudernder Operngänger. Auch der dreist irreführende Titel des Buches mag auf demselben Mist gewachsen sein. Was hat wohl ein "Wunderwerk" mit dem Vorschlag zu tun, dass die Berliner sich gefälligst künftig mit "zwei, irgendwann vielleicht auch mit einem" Opernhaus "zu begnügen" hätten? Fischer zieht ebenso kräftig vom Leder gegen die "Verfälschung der Werkidee" durch die Opernregisseure oder gegen die "Grenzen des guten Geschmacks", die er in den VIP-Lounges von Opernsponsoren touchiert sieht.
Den Orchestermusikern und Choristen wirft Fischer vor, dass sie "bei durchaus komfortablen Arbeitszeiten" mit ihren "Spitzengehältern" die Fortexistenz der Gattung Oper gefährden. Nun ist ein Profimusiker allerdings keine Nachtigall und kein Troubadour, er lebt nicht von Luft und Liebe. Dass eine komplexe Hochschulausbildung hinter jedem Hornisten, jedem einzelnen zweiten Geiger und auch jedem Opernchorsänger steht; dass andererseits die Oper, das unmögliche Kunstwerk, mit Hobbymusikern und Laienchören nicht zu machen ist, das sollte sich herumgesprochen haben - auch bis in die stille Studierstube eines Akademikers.
Jens Malte Fischer: "Vom Wunderwerk der Oper". Paul Zolnay Verlag, Wien 2007. 299 S., geb., 24,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
In den höchsten Tönen lobt Andreas Dorschel dieses Buch über das "Wunderwerk der Oper" von Jens Malte Fischer. Scheinen ihm die meisten Bücher über diese Kunstform eher unbefriedigend, betrachtet er Fischers Werk als rundum gelungen. So attestiert er dem Autor nicht nur das für ein derartiges Buch nötige umfassende literarische, dramaturgische, philosophische, ökonomische, politische, historische Wissen des Autors. Er hält ihm auch zu Gute, Wege jenseits der ausgetretenen Pfade zu gehen und so zahlreiche neue Einsichten zu fördern. Auch Fischers Ansatz, die Oper als Kunstform zu betrachten, die alle Künste integriert und sich am weitesten vom Vulgären entfernt, kann er nur unterschreiben. Besonders gefallen haben ihn der Aufsatz über Magnard sowie die von Fischer authentisch erfundene wahre Geschichte vom Rosenkavalier.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH