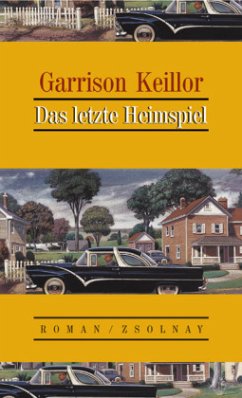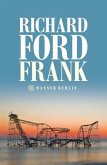Die Doo Dads singen "My Girl" im Radio, und der 14jährige Gary verbringt den Sommer 1956 vorwiegend mit wenig bildungsfördernder Lektüre und dem heimlichen Küssen seiner Kusine. Doch als der gute Onkel Sugar ihm eine Schreibmaschine schenkt, kommt die Erkenntnis: Gary will Starjournalist des "New Yorker" werden - bis dahin übt er sich als Reporter der örtlichen Baseballspiele und Verfasser von skurrilen, gruseligen Geschichten.
Ironisch und mit liebevollem Blick zurück auf die eigenen Teenagertage erzählt Garrison Keillor vom Erwachsenwerden im Minnesota der fünfziger Jahre - und lässt den Leser dabei tief in die uramerikanische Seele blicken.
Ironisch und mit liebevollem Blick zurück auf die eigenen Teenagertage erzählt Garrison Keillor vom Erwachsenwerden im Minnesota der fünfziger Jahre - und lässt den Leser dabei tief in die uramerikanische Seele blicken.

Was ein junger Mann tut, der wie ein Froschlurch aussieht und von Mädchen träumt: Garrison Keillor redet
Der Erzähler hat es nicht leicht in Garrison Keillors Roman „Das letzte Heimspiel”: „Mütterlicherseits stamme ich von blassen Buchhaltern mit dicken Brillen und weichen Händen und von rosawangigen Methodisten ab, die äußerst behutsam, bedenkenschwer und bußfertig in kleinen verputzten Häusern in Süd-Minneapolis um die 38. Street und die 42. Avenue lebten und einmal im Jahr einen Schrankkoffer vollpackten und mit dem Schnellzug der Great-Northern-Eisenbahn zu ihrer Sommerhütte am Lake Wobegon fuhren, bis zur Taille in den See wateten, im seichten Wasser herumpaddelten und sich wegen der Wespen und der Gefahren von Botulismus, Schwarzen Witwen, Schildkrötenschlangen, Blitzen und entlaufenen Irren betrübten und dankbar in die Stadt und zu ihrer alltäglichen Routine zurückkehrten.” Väterlicherseits sparen wir uns aus Platzgründen. Nur so viel: Der vierzehnjährige Gary, der eigenen Angaben zufolge aussieht wie ein Froschlurch, der in einen Jungen verwandelt wurde, „aber nicht vollständig”, wächst in einer Welt auf, in der der amerikanische Aussiedlertraum von religiöser Freiheit zum Alptraum der zweiten Generation wird. Die Eltern sind grässlich fromm, die Nachbarn spießig, und was Sex angeht: tote Hose. So liest er halt heimlich die „Highschool-Orgien” („sie prallten gegeneinander wie Dampframmen”) und mäht ansonsten fleißig den Rasen, der zum Symbol amerikanischen Dorflebens in den Fünfzigerjahren wird: nach außen hin heile Welt, jeder Anflug von Rebellion ausgejätet wie Unkraut.
Dank der offensichtlichen Rasenmetaphorik ist gleich klar, was es bedeutet, wenn Gary sich zum ersten Mal der zerfurchten, wild wachsenden, von Männerschweiß getränkten Wiese eines Baseballfelds gegenüber sieht: Hier tobt das Leben, Verzweiflung, Kampf, Triumph, der Stadionsprecher säuft und kifft, und in der Fankurve stehen Mädchen mit kurzen Röcken. Der Besuch des Stadions wird zum Initiationsritus in die Erwachsenenwelt, in der Form einer Wolke aus Rauch, Bier und Hamburgerfett, die ihn „wie ein Riesenrülpser” anweht, schlägt ihm der Hauch der weiten Welt entgegen - kein Wunder, dass er schließlich zu Hause bleibt, weiter Rasen mäht und die Welt vor allem in Gedanken erforscht.
Es ist nicht die Handlung, die Keillors Buch ausmacht, sondern der flotte, flapsige Tonfall, den die Übersetzung im Übrigen sehr gut trifft. Nur leider entpuppt sich Keillors Roman als ebenso seicht wie das Leben seines Protagonisten. Man folgt Garys abstrusen Gedankengängen lange aus Lust an den witzigen Formulierungen, doch mit der Dauer der Lektüre steigt die Skepsis, ob denn noch etwas passiere. Nach und nach weicht diese Skepsis der Enttäuschung: Hier hat ein Autor nichts zu sagen. „Das letzte Heimspiel” ist ein Bildungsroman als Witzesammlung und der Erzähler nicht nur ein manischer Rasen- sondern auch Phrasenmäher.
RALF HERTEL
GARRISON KEILLOR: Das letzte Heimspiel. Aus dem Amerikanischen von Angelika Kaps. Zsolnay Verlag, Wien 2003. 328 Seiten, 19, 90 Euro.
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Eine Dienstleistung der DIZ München GmbH

Lehrjahre des Gefühls sind keine Herrenjahre: Wie Marcus Braun und Garrison Keillor in der Provinz das Erzählen entdecken / Von Richard Kämmerlings
Manchmal kann es von Vorteil sein, zuerst auswärts anzutreten. Denn auf eigenem Platz ist man ohnehin überlegen, und hier zu beginnen kann leicht zu gefährlicher Selbstüberschätzung verführen. Jüngere Autoren, die mit autobiographischen Texten anfangen, können später in Schwierigkeiten kommen, wenn ihnen der Stoff der eigenen Herkunft ausgeht. Wie es aber beim Sport heim- und auswärtsstarke Mannschaften gibt, so könnte man auch Schriftsteller in diese zwei Grundkategorien einteilen. Auf der einen Seite etwa: Proust, Grass, Thomas Bernhard, Claude Simon, Arnold Stadler; auf der anderen: Musil, Kafka (der überall in der Fremde war), Pynchon, Umberto Eco, Raoul Schrott. Dazwischen Thomas Mann (zuerst heim- und später auswärtsstark) oder Canetti (umgekehrt).
Wenn die deutsche Gegenwartsliteratur in den letzten Jahren die Provinz wiederentdeckt hat, dann liegt das weniger an einer Abkehr von den Metropolen, einem Überdruß am Berlin-Hype, an Kölner Szene und Münchner Chic. Sondern an einem neuerwachten Interesse an der Herkunft, die schon rein statistisch selten im Zentrum liegt. Daß wir alle aus der Provinz kommen, ist die These eines Sachbuchs von Kolja Mensing mit dem Titel "Wie komme ich hier raus?", das im vergangenen Jahr erschien. Wobei die Frage natürlich falsch gestellt war: Eigentlich will man wissen, warum man immer wieder zurückkehrt - nach Kronach und Kempen, nach Bramsche und Borna. Und natürlich auch, warum man immer wieder davon lesen will. Erfahrungen und Wissen kann man überall und in allen Lebensaltern anhäufen. Im Leben und in der Literatur aber bleibt die Provinz stets die Erziehungsanstalt der Herzen.
Bei Frédéric Moreau war es noch anders. Als der Held in Gustave Flauberts "Éducation sentimentale" aus der Provinz nach Paris kam, begann für den ambitionierten jungen Mann eine Lehrzeit, die so nur in der Metropole möglich war. Weder die angebetete Madame Arnoux noch die Kurtisane Rosanette hätte er anderswo treffen können. Leon, die Hauptfigur in "Hochzeitsvorbereitungen", dem neuen Roman von Marcus Braun, gelangt aus seinem kleinen Heimatort an der Mosel zwar erst einmal nur nach Willich. Doch wenn die Provinz überall ist, ist auch der Notausgang an jedem Ort gleich nah. Am Niederrhein absolviert er gemeinsam mit seinem Jugendfreund Kranach den Zivildienstlehrgang, bevor er in einem Mainzer Krankenhaus auf der "Zentralsterilisation" anzutreten hat. Schon das Willicher Schwesternwohnheim wird für Leon, dessen Freundin gerade das Studium begonnen hat, zum Ort der ersten Untreue und damit des Erwachsenwerdens - mit der dafür notwendigen "moralischen Flexibilität". Mainz schließlich ist der reinste Moloch.
In diesem Roman geschieht äußerlich wenig: Leon verliebt sich in eine Krankenschwester, landet aber bei der viel älteren Birgit im Bett, die sich dafür gleich in ihn verliebt. Leon glaubt zu betrügen und wird in Wahrheit selbst betrogen, will seine Freundin wegen einer anderen verlassen und diese wiederum wegen seiner Freundin, doch beides bringt er nicht übers Herz oder über die Hose, wie man's nimmt. So oder so ähnlich hat das jeder erlebt, doch nicht was, sondern wie Braun das erzählt, macht das Besondere aus. Seine kurzen, präzisen Hauptsätze wirken so, als hätte er es sich zum Prinzip gemacht, mindestens jeden zweiten wegzulassen und alles nicht absolut Notwendige mit dem Rotstift auszujäten: "Lea und ich schenken uns Rosen. Stehen auf Partys in Ecken rum, verschwinden in den Garten. Ihre Mutter wundert sich, daß Lea plötzlich Röcke trägt. Sie wundert sich ehrlich, sie kommt nicht drauf. Wir machen Abitur. Sprechen tagelang nicht miteinander. Lassen uns nichts sagen." "Siebzehn verweht" heißt das Kapitel, und schon beginnt der Rest des Lebens, das irgendwann an den Punkt führt, wo man sich über einen Briefkasten voller Mahnungen freut: "Mahnungen sind Rechnungen, die man schon kennt."
Solche aphoristischen Erkenntnisfunken stieben immer wieder aus den Lücken, ohne das Erzählen abstrakt oder unsinnlich zu machen. Im Gegenteil: "Was weiß man über seine Mutter? Dazu muß man sich alte Photos anschauen, der zuversichtliche Blick einer Dreißigjährigen, die einen Schwimmflügel aufbläst. Wenn man das nächste Mal hinschaut, ist sie fast fünfzig." Die Mutter aber ist es auch, die Leon einst Flauberts "Erziehung des Herzens" schenkte. Mit einer herausgerissenen Abbildung aus dem Biologiebuch wird dann der daraus abgeschriebene Satz illustriert: "Frauenherzen sind wie jene Geheimschränkchen, voll ineinandergeschachtelter Schubläden; man zerrt an ihnen, man splittert sich die Nägel ab, und dann sieht man ganz hinten eine welke Blume oder Staub." Das finde er wohl komisch, sagt da die Mutter.
Wie stets in der Provinz herrscht im Buch kein Mangel an unvergeßlichen Figuren. Etwa die unbekannte Süße aus dem "Black Current", einem Tanzschuppen am Rheinufer, die Leon mangels exakterer Angaben erst einmal Ursula nennt: "Es ist nie einfach, eine Frau anzusprechen. Jedenfalls nicht mal in meiner Dorfdisko mit Heimrecht. Vielleicht ist es gerade dort am schwierigsten." Leon schafft es dann doch, dieses "Gegenteil von einem Reh" (so Kranach trocken) kennenzulernen, und verwickelt sich dann in die Drei- oder besser Vielecksgeschichte, die mit einer nächtlichen Verfolgungsjagd auf leeren Landstraßen fast die Grenze zum Thriller streift, aber dann doch einfach Psycho bleibt, ein Mikrokosmos menschlicher Macken und Zacken, kleiner Leidenschaften und großer Leiden.
Wenn erzählerische Leichtigkeit die seltene Kunst ist, im winzigen, beiläufigen Detail das Wesentliche zu sagen, dann beherrscht Braun sie schon ziemlich perfekt. Einer ihrer Altmeister ist der mit seiner Radioshow "A Prairie Home Companion" berühmt gewordene Garrison Keillor, dem wir einen der unvergeßlichen Provinzorte auf dem Globus der Imagination verdanken: Sein Lake Wobegon in Minnesota liegt in der ehrwürdigen Nachbarschaft von Sherwood Andersons Winesburg, Ohio, oder John Updikes Brewer in Pennsylvania, der Heimat Rabbits. In seinem Roman "Das letzte Heimspiel" kehrt Keillor noch einmal für einen Sommer des Jahres 1956 an die Türschwelle des Erwachsenwerdens zurück. Zwischen deutschen Katholiken und norwegischen Lutheranern nimmt die Familie des Erzählers als Angehörige der "Heiligen Brüder" eine Sonderstellung ein, die im Abstand von allen Ungläubigen, also dem Rest der Welt besteht, "was für meine Leute kein großes Problem ist, weil wir von Natur aus fernhalterisch sind und kein Talent zum freundschaftlichen Plausch mit Fremden haben. Loslösung ist genau das richtige Prinzip für uns."
Im ständigen Kampf mit seiner erwachten (und nicht mehr zum Schlafen zu bewegenden) Sexualität, auf Entdeckungsreise beim anderen Geschlecht und in wachsender Distanz zu seiner bigotten Familie bildet sich der vierzehnjährige Gary zum Schrecken seiner neurotischen Lehrer eine Identität als Autor von Witzchen, Scherzgedichten und obszönen Geschichten: die Geburt des Schriftstellers aus der Geistlosigkeit der Pubertät. Mit der unangepaßten, drei Jahre älteren Kusine Kate macht Gary seine ersten erotischen Erfahrungen; als Aushilfsreporter bei den Spielen der heimischen Baseballmannschaft entdeckt er sein Talent für Sprache und nebenbei auch das für die Freundschaft. Dem Sommer wird ein Abschied für immer folgen, nicht von einem Ort, sondern vom Kind in sich.
Einem Kompendium über die Kunst der Kurzgeschichte entnimmt Gary den Tip, eine Figur zu entwerfen, die der Leser gern bei sich zu Hause empfangen würde - "und dann diese Figur kräftig mit einem spitzen Stock zu piesacken". Das könnte als denkbar knappste Poetik über beiden Büchern stehen, die mehr als nur gut gemachte Unterhaltung bieten, indem sie den Witz als Form der Erkenntnis ernst nehmen. Humor und Ironie schaffen immer Distanz - die Bedingung jeder Reflexion.
Wer nach dem 11. September oder dem Zusammenbruch der New Economy oder einer längeren Schlechtwetterperiode bereits postwendend statt Pop eine neue Ernsthaftigkeit in die Gegenwartsliteratur einziehen sah, der überschätzte nicht nur die Reaktionsschnelligkeit des Mediums, sondern erlag auch einem Kategorienfehler. Der Erfahrungsraum der Literatur reicht viel tiefer in die Herkunft zurück, zu der die neue Provinzliteratur der letzten Jahre auch ein ambivalenteres Verhältnis hat als die klassische (Anti-)Heimatliteratur aus Österreich oder der Schweiz. "Stadt Land Fluß" von Christoph Peters war ein frühes Beispiel, es folgten Autoren wie David Wagner, Tobias Hülswitt oder Andreas Maier - kaum zufällig ausschließlich Westdeutsche. Autoren aus dem Osten, der als Ganzes Inbegriff verödeter Provinz war und wieder zu werden droht, richten den Blick auf Berlin oder gleich auf New York.
Wer wie der Germanist Moritz Baßler Pop-Literatur als Archiv einer generationenspezifischen Erfahrungswelt definiert - wofür übrigens gerade Keillors Bücher mit ihrer Konservierung eines vergangenen Medienzeitalters, von "Radio Days" und Rock'n'Roll, ein gutes Beispiel sind -, wird sich vor ihrer Verabschiedung aus rein spaßkonjunkturellen Gründen hüten. Eher dürfte der Hang zum Außergewöhnlichen, Aristokratischen, Weltläufig-Urbanen vorbei sein, der nicht nur in einem merkwürdigen Adelskult zum Ausdruck kam, sondern auch in der dandyhaften Attitüde manches Starautors, der sich in Geschmacksfragen mit seinen Lesern nicht gemein machen wollte. Zwei Erfolgsgattungen der letzten Jahre laufen dieser Exklusivität erkennbar entgegen: die Autobiographien und die Generationenbücher - als deren Synthese man die Romane von Braun und Keillor durchaus lesen könnte. Denn indem Lebensgeschichten die Umstände zeigen, die ein Individuum formten, demokratisieren sie es in gewisser Weise. Mit den gleichen Ingredienzen der Erziehung hätte aus manchem etwas (anderes) werden können. Die Generationenbücher - von Florian Illies bis Jana Hensel - schlagen den umgekehrten Weg ein, indem sie von Prägungen ausgehen, denen jeder Angehörige eines Jahrgangs oder einer Erfahrungsgemeinschaft ausgesetzt war. Der nostalgische Aha-Effekt bei Namen, Marken und Fernsehsendungen ist dabei die Oberfläche für eine viel tiefer gehende Spiegelung, jedes Schmunzeln nur Symptom dieser im Grunde schmerzhaften Freilegung überwucherter Wurzeln.
Auch im Provinzroman läßt sich gut erkennen, wie sich das Kollektive der Erfahrung und ihre humoristische Form bedingen. Was geteilt wird, ist mitteilbar. Der Zivildienst kann bei Braun zum Inbegriff einer Schwellenerfahrung werden, weil er für Millionen Jugendlicher ein wahrer Schnellkurs des Lebens war. Anders als das Studium, das im Schutzraum des eigenen Milieus und Alters ablief, waren hier Begegnungen mit Alter, Krankheit und Tod unvermeidlich. Doch nicht nur beim Leser zählt das wiedererkennbar Exemplarische. Auch bei der poetischen Produktivität ist der Heimvorteil ausschlaggebend.
Der Autor Larry McMurthy ("The Last Picture Show") hat gerade in der "New York Review of Books" den jüngsten Roman Keillors, "Love me", mit dem Hinweis kritisiert, daß der hier schließlich vollzogene Auszug aus Lake Wobegon dem Erzählen auch die Glaubwürdigkeit geraubt habe. Statt Humor regiere nun eine Routine des Witzes, die kein Medium höherer Erkenntnis mehr sei, sondern auf Dauer nur nervtötender Selbstzweck. Auch im "Letzten Heimspiel" merkt man die Routine des Radio-Comedian, der die Banalität der Kleinstadt-Kabale mit irrwitziger Drastik frisiert. Vor allem den Kontrast zwischen frömmelnder Karosserie und geilem Getriebe nutzt Keillor weidlich aus: "Denn Männer haben nicht mehr Selbstbeherrschung als ein Hund in einer Wurstfabrik." Der deutsche Titel von "Lake Wobegon Summer 1956" deutet schon den erzählerischen Neubeginn an, der naturgemäß schwieriger ist: Es folgt das erste Auswärtsspiel.
Bei Marcus Braun mag die Entwicklung umgekehrt verlaufen. Seine ersten Romane fanden zwiespältige Aufnahme: Sein Talent wurde zwar anerkannt, das Überambitionierte und Konstruierte stießen dagegen auf Ablehnung. Die nicht primär literarisch vermittelte Welt des Heranwachsenden, die Horizont jeder Bewegung bleibt, ermöglicht dagegen in der Selbstverständlichkeit der Erfahrung die leichte Form. "Hochzeitsvorbereitungen" ist eine Metapher für ein Ankommen, das nie gelingen wird: Denn immer wird jemand einen letzten Einwand machen. Wer schließlich doch heiratet, geht nicht mehr fort und wird nie darüber schreiben.
Bei Keillor dagegen steht am Ende, typisch amerikanisch, ein echtes Happy-End, oder besser: eine Läuterung unter umgekehrten Vorzeichen. Die Ära des Rock'n'Roll ist angebrochen und bringt die Verhältnisse in Lake Wobegon ebenso zum Tanzen wie die Moralvorstellungen. Hochzeitsvorbereitungen finden hier tatsächlich statt; die uneheliche Schwangerschaft der angehimmelten Kusine bedeutet für Gary den endgültigen Abschied von der Unbeschwertheit der Jugend. Der Bräutigam ist der Baseballstar, der die eigentlich grottenschlechte Truppe zuletzt von Sieg zu Sieg führte. Gary dagegen läuft nachts splitternackt über das Infield, ein symbolischer Akt der Befreiung, ein reinigendes Abschiedsritual. Nur wer alles gegeben hat, darf Heimspiele auch einmal verlieren.
Marcus Braun: "Hochzeitsvorbereitungen". Roman. Berlin Verlag, Berlin 2003. 234 S., geb., 18,- [Euro].
Garrison Keillor: "Das letzte Heimspiel". Roman. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Angelika Kaps. Paul Zsolnay Verlag, Wien 2003. 328 S., geb., 19,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
"Zu den Qualitäten dieser Pubertätsgeschichte aus der amerikanischen Provinz zählt Rezensent Richard Kämmerlings, dass Autor Garrison Keillor darin Witz als Form der Erkenntnis ernst nimmt. Im Roman sieht Kämmerlings dessen pubertierenden Helden im ständigen Kampf mit seiner erwachten Sexualität, auf Entdeckungsreisen beim anderen Geschlecht und in wachsender Distanz zu seiner bigotten Familie sich eine Identität als Autor von Witzen, Scherzgeschichten und obszönen Geschichten bilden. So entsteht, zum Schrecken der Lehrer des Helden und zum Glück des Rezensenten die für nötig befundene Distanz, in der Kämmerlings Reflexion möglich werden sieht. So ganz scheint der Roman seine Möglichkeiten jedoch nicht auszuschöpfen, denn der Rezensent bemerkt mitunter hinter dem Literaten die "Routine des Radio-Comedian", der Keillor Kämmerlings zufolge auch sehr erfolgreich ist, und der "die Banalität der Kleinstadt-Kabale mit irrwitziger Drastik frisiert". Hier nutze Keillor vor allem den Kontrast "zwischen frömmelnder Karosserie und geilem Getriebe" weidlich aus.
© Perlentaucher Medien GmbH"
© Perlentaucher Medien GmbH"
"Keillor ist ein melancholischer Humorist, einer, bei dem man schon lacht, wenn er nur 'Lutheraner' sagt. Oder schreibt. Denn die an sich deprimierenden Fifties-Zustände werden aus der Perspektive eines Heranwachsenden mit gesundem Verstand, also subversiv geschildert. Das Schöne und Aktuelle an den selbstreflexiven Passagen des Buches ist, dass es Verständnis für die religiösen Wurzeln Amerikas zeigt, zugleich aber die hoffnungslosen Verirrungen ihrer selbstsicheren Vertreter bloßstellt - und das noch dazu mit sichtlichem Vergnügen."
Michael Freund, Der Standard, 16.08.03
Michael Freund, Der Standard, 16.08.03