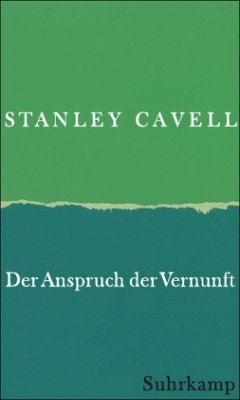Stanley Cavells monumentales Buch Der Anspruch der Vernunft, das nun in deutscher Übersetzung erscheint, gehört zu den großen philosophischen Büchern des 20. Jahrhunderts. Seit seiner Erstpublikation 1979 hat es eine ganze Generation von Philosophen beeinflußt und gilt längst als moderner Klassiker. Ungewöhnlich breit angelegt, komplex in der Argumentation, eigenwillig, ja exzentrisch im Stil, eröffnet uns Cavell in seinem Opus magnum Zugänge zu epistemologischen, metaphysischen, ethischen und ästhetischen Fragen, die bis heute nichts an Originalität eingebüßt haben.
Leuchtend roter Faden, der das ganze Buch durchzieht, ist Cavells Wittgenstein-Lektüre. Konträr zum philosophischen Mainstream liest Cavell Wittgensteins Forderung, "die Wörter von ihrer metaphysischen wieder auf ihre alltägliche Verwendung zurückzuführen", nicht einfach als Hinweis auf eine Gebrauchstheorie der Bedeutung, sondern macht sie für eine raffinierte Umdeutung des Skeptizismus fruchtbar. Denn der Zweifel,tief eingelassen in das menschliche Denken, ist der Dorn im Fleisch der Philosophie. Er ist es, der zwischen uns und der Welt steht, der uns der Welt entfremdet und dazu führt, daß wir sie immer wieder verlieren. Die Macht der Skepsis durch das philosophische Streben nach letzten Wahrheiten brechen zu wollen ist für Cavell ein sinnloses, ja kontraproduktives Unterfangen. Vielmehr muß der skeptisch-metaphysischen Versuchung widerstanden und die Welt auf geradezu romantische Weise ständig zurückerobert werden: indem wir sie in unseren Sprachspielen immer wieder neu erschaffen. "
Leuchtend roter Faden, der das ganze Buch durchzieht, ist Cavells Wittgenstein-Lektüre. Konträr zum philosophischen Mainstream liest Cavell Wittgensteins Forderung, "die Wörter von ihrer metaphysischen wieder auf ihre alltägliche Verwendung zurückzuführen", nicht einfach als Hinweis auf eine Gebrauchstheorie der Bedeutung, sondern macht sie für eine raffinierte Umdeutung des Skeptizismus fruchtbar. Denn der Zweifel,tief eingelassen in das menschliche Denken, ist der Dorn im Fleisch der Philosophie. Er ist es, der zwischen uns und der Welt steht, der uns der Welt entfremdet und dazu führt, daß wir sie immer wieder verlieren. Die Macht der Skepsis durch das philosophische Streben nach letzten Wahrheiten brechen zu wollen ist für Cavell ein sinnloses, ja kontraproduktives Unterfangen. Vielmehr muß der skeptisch-metaphysischen Versuchung widerstanden und die Welt auf geradezu romantische Weise ständig zurückerobert werden: indem wir sie in unseren Sprachspielen immer wieder neu erschaffen. "

Stanley Cavells Erstling „Der Anspruch der Vernunft”
1977 hatte Stanley Cavell das Manuskript des „Anspruchs der Vernunft” an den Verleger geschickt. „Wenn ich damals”, schreibt er später in einer Aufsatzsammlung, „in einem Satz den Grund dafür hätte angeben müssen, warum es dieses Buch gibt, so hätte er vielleicht gelautet: ,Um zu helfen, die menschliche Stimme in die Philosophie zurückzuholen‘.”
Dieses Buch existiert aber nicht nur, um, angeregt von John Austin und Ludwig Wittgenstein, die Stimme der alltäglichen Rede wieder in der Philosophie erklingen zu lassen, es war zugleich die Überarbeitung einer philosophischen Dissertation, eine akademische Zweckschrift, die eine Karriere befördern sollte. Die Anfertigung zog sich lange hin, in der Überarbeitung entstand ein wüstes, nahezu monströses, unhandliches Buch, das heute keine Fakultät mehr als akademische Laufbahnschrift akzeptieren würde, so sehr lässt es in Selbsteinwänden und Exkursionen seine Entstehung sichtbar werden.
Doch durch diesen Stil wird eine Denkbewegung erkennbar, die den Leser von Beginn an unwiderstehlicher in ihren Bann zieht, als es ein Buch der Thesen und Begründungen vermöchte. Cavell, der inzwischen emeritierte Harvard-Professor für Ästhetik und Werttheorie, war schon in seiner Dissertation ein Philosoph jenseits der Akademie. Eben das macht ihn zum Philosophen im eminenten Sinne. Denn immer schon, seit Diogenes von Sinope sich über das definitorische Treiben in der Platonischen Akademie lustig machte, gab es Philosophie in und außerhalb der Akademie. Und seit Wittgenstein, Heidegger und Feyerabend gibt es Philosophen, die sich in der Akademie gegen die akademische Philosophie wehren.
Cavell ist einer von ihnen. Entsprechend treibt er in diesem Buch, obwohl es auf den späten Wittgenstein immer wieder zurückkommt, nicht die Forschungsfront der Wittgenstein- und Austinexegese voran. Nicht der „linguistic turn”, die Wende zur Sprache, ist für Cavell entscheidend, sondern die Wiederentdeckung des Alltäglichen in der stimmlich verstandenen Sprache. Denn Wittgensteins Spätphilosophie wurde Cavell zufolge als Behaviourismus, Operationalismus und Gebrauchstheorie der Bedeutung missverstanden. Vielmehr geht es in den „Philosophischen Untersuchungen” Wittgensteins, wie sie Cavell liest, darum, wie der Zweifel uns von Gewissheiten entfernt, die für unser Weltverhältnis konstitutiv sind. Die Skepsis kann dem Denken die Welthaltigkeit rauben und es in methodische und metaphysische Selbstverstrickungen treiben, die zu Zweifeln an und zu Beweisen der Außenwelt führen, und eben diesen Zweifeln und Beweisen ist der zweite Teil im „Anspruch der Vernunft” gewidmet.
Skepsis und Methodenansprüche können auch moralische Selbstverständlichkeiten ungerechtfertigt erscheinen lassen und zu endlosen Begründungsbemühungen der Moral führen, in denen das Denken die Schwierigkeiten wirklicher Menschen aus dem Blick zu verlieren droht. Schließlich kann einem gar die Realität der Mitmenschen fraglich werden, seit Descartes bei Regen aus dem Fenster schaute und sich fragte, woher er wisse, dass unter den Schirmen, die sich da bewegen, tatsächlich Menschen seien und nicht Maschinen. Nach welchen Kriterien sollen wir entscheiden, ob dort unten auch ein Innenleben stattfindet? Darum geht es im vierten Teil des Buches.
Alle drei Hauptteile bauen auf dem ersten Teil auf, in dem Cavell Wittgensteins Auseinandersetzung mit der Suche nach Kriterien rekonstruiert, die aus einer Überzeugung ein Wissen machen oder die Rechtfertigung dafür liefern, etwas in eine bestimmte Kategorie, beispielsweise die der Säugetiere oder der Fische, einzuordnen.
Aus der Skepsis sieht Clavell, vor allem bei René Descartes und David Hume, zum einen den Verlust des Alltäglichen hervorgehen, zum anderen jenen Antrieb des modernen Philosophierens, der dessen fehlgeleitete Tendenz befördert, immer wieder etwas Analoges zu den wissenschaftlichen Gewissheiten und Genauigkeiten hervorbringen zu wollen und so in einen intellektuellen Starrkrampf zu verfallen, dem der Zugang zur Welt verlorengeht. Das ist für Cavell das Thema der Wittgensteinschen „Philosophischen Untersuchungen”.
Hinweise wie etwa derjenige, der Cartesische Zweifel sei doch nur methodisch und Hume glaube erklärtermaßen an die Kausalität, sobald er die Studierstube verlasse und den Billardsalon betrete, ändern nichts an dieser Diagnose. Denn das alltägliche Gemenge aus Handlungen und Überzeugungen im Billardsalon ist in der modernen Philosophie ohne Relevanz. Es gelten nach allgemein akzeptierten Kriterien begründbare Überzeugungen. Doch eine Philosophie, die gegen ihre eigene Skepsis methodische Wissenschaft werden will, hört, so Cavell, auf, Philosophie zu sein, denn: „Philosophie zu schreiben, kommt für mich dem Entdecken einer Sprache gleich.”
Diese Sprache ist keine idiosynkratische Privatsprache. Es ist eine Sprache, die ein Individuum auf seine Weise spricht und in der es trotzdem manchmal für alle sprechen und „wir” sagen kann. Doch was bedeutet, „wir” zu sagen, in der theoretischen Erkenntnis oder der Moral? Wird hier eine Gemeinschaft in Anspruch genommen, von der wir wissen, mit der man Verträge geschlossen hat? Die These, vor Wittgenstein sei Erkenntnis ein Akt isolierter Individuen gewesen und durch ihn wäre die soziale Dimension des Sprachhandelns und der Erkenntnis entdeckt worden, stellt für Cavell eine Banalisierung dar.
Er bestreitet, dass Wittgenstein an die Stelle der Cartesischen Argumente gegen die Skepsis einen unbegründeten Appell an die Öffentlichkeit der Alltagssprache setze, an das „Wir” des Sprachspiels. Wer ihn so lese, verkenne Wittgensteins „Ringen in Verzweiflung und Hoffnung”, das Cavell als das eigentliche „Motiv philosophischer Schriftstellerei” sieht: das Verzweifeln über die skeptischen Anfechtungen des menschlichen Weltverhältnisses, das Verzweifeln auch über die metaphysischen „Auswege” aus dieser Skepsis und schließlich die Hoffnung, eine Art und Weise gefunden zu haben, in der sich über die Arbeit der Sprache sprechen sichtbar machen lässt, wie wir in ihr unsere Welt finden, ohne dabei auf dem Boden unbezweifelbarer Gewissheiten zu stehen.
Was wir von der Welt wissen
Skeptiker glauben, die Wissensansprüche, die unser Welt- und Sozialverhalten mit sich bringe, seien niemals einlösbar. Cavell aber will mit Wittgenstein zeigen, dass „unser Verhältnis zur Welt als ganzer oder zu den anderen im allgemeinen, gar nicht eines des Wissens ist”. Die Voraussetzungen der Skepsis sind falsch. Sie unterscheidet nicht zwischen der Tatsache, dass sich jemand auf die Welt bezieht und der, dass man von der Welt etwas wissen kann.
Vergleichbar wie mit Wittgenstein verfährt Cavell auch mit der Moralphilosophie. Wie Schopenhauer, Sidgwick und Stevenson will er den „gewöhnlichen Menschen” wieder zum Objekt der Aufmerksamkeit, „seine Mithilfe oder zumindest seine klarere Einsicht” zum Ziel der Reflexion machen. Damit stand Cavell 1979 im Widerspruch zur praktischen Philosophie, der es bis heute vor allem um die Bedeutung moralischer Begriffe und um den logischen Status moralischer Urteile und Argumente geht, und die deshalb die Beschäftigung mit dem gewöhnlichen Leben als empirischen Soziologismus oder erbauliche Popularphilosophie beiseite schiebt.
Wie den moralischen Skeptizismus versucht Cavell auch den moralphilosophischen Methodizismus und alle Erbaulichkeitsbanalisierungen zu vermeiden. Moral hat wie viele Spiele ihre eigene Ordnung, der durch eine allgemeine Vernunft, die außerhalb der moralischen Beziehungen steht, nicht beizukommen ist: „Probleme der Moral betreffen von uns zu befolgende und zu schaffende Werte, Verantwortlichkeiten, die wir zu akzeptieren haben und die wir überhaupt durch unser Verhalten und unsere Position eingegangen sind.” So wenig jemand ein geistiges Spiel wie Schach oder ein körperliches wie Eishockey nur durch allgemeines Gedächtnis-, Intelligenz-, Geschicklichkeits- oder Muskeltraining erlernen und beherrschen kann, ebenso wenig kann man Cavell zufolge durch „Vernunft allein” moralisches Verhalten zu Werten und Verantwortlichkeiten klären oder begründen.
Um die moralische Welt gewöhnlicher Menschen in der Philosophie wieder zur Geltung zu bringen, hat sich Cavell später, nach dem „Anspruch der Vernunft”, dem Film zugewandt, vor allem der Ehe-Komödie, in der menschliche Konflikte, Ideale und Enttäuschungen dargestellt werden. Seine Arbeiten zum Kino sind zuerst ins Deutsche übersetzt worden und haben ihn in den Kulturwissenschaften berühmt gemacht. Es ist erstaunlich, mit welcher Konsequenz er die Anliegen seines ersten Buches über ein ganzes Lebenswerk hinweg verfolgt hat.
Die Sprache, in der er das tut, ist ein äußerst kultiviertes Amerikanisch, dem Herman Melville und Wallace Stevens, Henry David Thoreau und Ralph Waldo Emerson, Walt Whitman und Henry James anzumerken sind. Seine Sätze mäandern oft über viele Zeilen. Christiana Goldman hat dieses Amerikanisch in ein sehr gut lesbares, schönes Deutsch übertragen. Ein Vorwort von Susan Neiman führt diejenigen, die mit diesem Buch ihren ersten Cavell in der Hand halten, in Leben und Werk dieses bedeutendsten unter den lebenden Philosophen der Vereinigten Staaten ein. MICHAEL HAMPE
STANLEY CAVELL: Der Anspruch der Vernunft. Wittgenstein, Skeptizismus, Moral und Tragödie. Aus dem Amerikanischen von Christiana Goldman. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2006. 795 Seiten, 49,80 Euro.
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Eine Dienstleistung der DIZ München GmbH

Das ist seine Welt: Stanley Cavells großangelegter Versuch zur Versöhnung von Philosophie und Literatur / Von Andreas Platthaus
Hier wird nicht weniger als ein Lebenswerk inspiziert: Wer das Problem des anderen entdecken will, der muß zur Literatur gehen, sagt der Philosoph Stanley Cavell, dem die Sprache die Sprache zu verschlagen droht.
Es empfiehlt sich, bereits das Inhaltsverzeichnis von "Der Anspruch der Vernunft" aufmerksam zu lesen. Denn es enthält eine bemerkenswerte Passage, einen Einschub, der eine Art Gebrauchsanweisung für die Lektüre darstellt. Diese in Klammern gesetzte Bemerkung steht vor den aufgelisteten Kapitelüberschriften des vierten und letzten Teils, und darin erklärt der Autor Stanley Cavell, daß es sich bei diesen Einträgen gar nicht mehr um Kapitelüberschriften handele: "Besser, man sieht in ihnen Straßenschilder." Für die bevorstehende Reise durch das Buch ist diese Extravaganz bedeutsam. Denn die Bemerkung macht klar, daß es sich bei "Der Anspruch der Vernunft" nicht um eine Studie handelt, sondern um einen Grand Tour, bei dem wir uns als Leser leicht verfahren können.
Angesichts unserer voraussichtlichen Reisedauer sind vom umsichtigen Cicerone auch regelmäßige Erholungsphasen vorgesehen. Die Gebrauchsanweisung mitten im Inhaltsverzeichnis führt dazu aus: "Abstände signalisieren angenehme Ruhepausen, damit der Kopf klar werden oder ein Gedanke sich schließen kann - und das könnte mit der Einführung oder dem Fallenlassen eines Gegenstandes zusammenhängen, muß es aber nicht."
Eine solche für ein philosophisches Werk eher ungewöhnliche Handreichung macht klar, daß hier anders philosophiert wird: mit leichter Hand bei schwerem Stoff. Im Text finden sich zahllose in Klammern gesetzte Einschübe wie der im Inhaltsverzeichnis. In diesen Parenthesen wird manchmal abgeschweift, bisweilen erläutert, immer aber höchst persönlich gesprochen; es sind die Teile des Buches, in denen Cavell am meisten bei sich ist.
Und es sind die Teile, in denen auch wir am nächsten beim Autor sind. Er läßt uns ganz nahe an sich heran, so nahe, daß es beinahe etwas Peinliches hat - als machten wir auf der Reise immer wieder im Eigenheim unseres Führers Station und würden dort in Privatgespräche verwickelt, obwohl wir doch eigentlich eine Überblickstour gebucht haben: Sprachphilosophie in achthundert Seiten. Doch für Cavell ist Sprache nicht nur gemäß seinem ständigen Bezugspunkt Wittgenstein ein theoretischer Begriff, sondern eine praktische Herausforderung an den Autor selbst. Eine Herausforderung allerdings, die selbst herausgefordert wird. Zu jenem abschließenden Großkapitel, vor dem schon im Inhaltsverzeichnis die Gebrauchsanweisung steht, heißt es dann im Text selbst: "Teil IV ermutigt seine Sprache, sich von der Philosophie überraschen zu lassen . . . Die philosophische Sprache steht daher unter einem Druck, der einem literarischen nicht unähnlich ist. (Nicht von jedem wird man erwarten dürfen, daß er dafür etwas übrig hat.)"
Da war wieder so eine Klammer, und so kurz ihr Inhalt diesmal auch ausgefallen ist, so zentral ist ihre Aussage. Man mag den Satz als Warnung lesen oder als Seufzer - Cavell weiß, daß er es seinen Lesern nicht einfach macht. Deshalb hat es auch beinahe drei Jahrzehnte gedauert, ehe sein "Anspruch der Vernunft", das bei weitem umfangreichste Werk des Philosophen, ins Deutsche übersetzt wurde. Wobei auch von den zahlreichen kürzeren Studien kaum etwas den Weg in unsere Sprache fand. Obwohl der Ruf Cavells immens ist, scheuten die Verlage das Risiko, und das hat vor allem mit der Komplexität und der Präzision seiner eigenen Sprache zu tun - und damit, daß seine wichtigsten Referenzen literarische Texte sind, vor allem Shakespeares Tragödien. Nicht nur, daß die subtilen Jagden auf diesem Terrain von etlichen Literaturwissenschaftlern als tolldreistes Wildern verachtet werden; sie pflegen auch eine Lektüre, die bis in die kleinsten Verästelungen des Textes geht, und dieses akribische Verfahren macht sie nahezu unübersetzbar.
Dennoch ist "Der Anspruch der Vernunft" gewiß das noch am leichtesten zu übertragende Buch von Cavell, weil hier die literarischen Referenzen (oder auch die an den amerikanischen Film als gleichfalls wichtige Quelle für Cavells Philosophieren) kaum in Erscheinung treten. Das soll die fulminante Leistung der Übersetzerin Christiana Goldmann nicht schmälern, die nicht einmal den heute gängigsten Anglizismen Raum in ihrem Text gewährt hat und somit Cavell in jene sprachliche Tradition stellt, die für ihn neben der englischsprachigen besonders wichtig ist: die deutsche, ausgehend eben von Wittgenstein. Es ist überhaupt nach der französischen von 1996 erst die zweite Übersetzung dieses philosophischen Solitärs. Und welche Leistung dabei trotz der Erleichterung, nicht auch noch in die Shakespeare-Philologie einsteigen zu müssen, immer noch zu bewältigen war, zeigt schon ein Blick auf den Originaltitel "The Claim of Reason". Der Begriff "Anspruch" ist gewiß das passendste deutsche Äquivalent zu "Claim", aber wo das englische Wort noch den Beiklang von Eroberung hat, ist der deutsche Begriff gerade im Kontext der Sprachphilosophie doppeldeutig, weil er in einer etymologisch-assoziativen Lektüre auch als "Anrede" gedeutet werden könnte.
Damit aber betriebe man schon ein Cavellsches Verfahren, das im Denken des Amerikaners erst nach dem "Anspruch der Vernunft" ausgeprägt wurde: Erst auf den letzten dreißig Seiten des Buchs gibt es - als würde die Schwelle zu seinem späteren Schaffen überschritten - eine Shakespeare-Erörterung mit einer fulminanten "Othello"-Interpretation, die Cavell dann auch aus dem Kontext seines Hauptwerks gelöst und 1987 in den Aufsatzband "Disowning Knowledge" aufgenommen hat, in dem er seine wichtigsten Arbeiten zu Shakespeare versammelte. Dem Vorwort zu diesem Sammelband kann man ablesen, als wie konsequent systematisch Cavell sein Denken versteht: "Der Anspruch der Vernunft" wird dort als das Vorspiel für die Tragödiendeutung in Anspruch genommen, als konsequenter literary turn nach dem linguistic turn. In der Tat, das Buch stellte 1979 einen Einschnitt in die zeitgenössische Philosophie dar.
Dabei beginnt es inhaltlich konventionell, was seinen Grund darin hat, daß weite Teile aus Material bestehen, das Cavell bereits Anfang der sechziger Jahre für seine Dissertation geschrieben hat und das erst zwanzig Jahre später mit der Ergänzung um jenen ominösen "Teil IV", der das philosophische Programm von "Der Anspruch der Vernunft" um den stilistischen Anspruch an das eigene Denken erweitert hat, veröffentlicht wurde. Trotzdem ist es nicht überholt.
Da liefert Cavell zunächst eine Interpretation der Wittgensteinschen Spätphilosophie, und zwar der oft ungeliebten "Philosophischen Untersuchungen". Was Cavell an der späten Ausprägung der Wittgensteinschen Sprachphilosophie begeistert hat, ist deren Anschaulichkeit durch den Rückgriff auf imaginäre Dialoge - stilistisch wie argumentativ das klare Vorbild für den "Anspruch der Vernunft". Cavell ist nicht bereit, selbst den kleinsten möglichen Einwand unberücksichtigt zu lassen. Sprache ist ihm vor allem Gespräch, und da das Thema des ganzen Buches die Anerkennung anderer Menschen ist, die Konfrontation mit "dem Fremdphysischen", wie Cavell mit einem eigentümlichen Begriff dieses Kernproblem aller westlichen Philosophie bezeichnet, muß man auch die Form als Programm begreifen. Daß am Ende des gewaltigen Werks keine Lösung steht, sondern im besten Fall Erkenntnis, versteht sich in der Philosophie von selbst.
Dennoch wird mancher enttäuscht sein, der im Inhalt des Buchs einen Kampf zwischen dem Skeptizismus der kontinentaleuropäischen Tradition und der ihm fundamental widerstreitenden Sprachphilosophie angelsächsischer Provenienz beobachten will. Ja, beide werden von Cavell gegeneinander ins Feld geführt. Aber ihre jeweiligen Sprecher sind Cavell und wieder Cavell - der Schiedsrichter ist zugleich auch Kombattant auf beiden Seiten. Der resultierende Dialog wird somit viel eher auf wittgensteinsche Art geführt denn auf sokratische. Sokrates pflegt seine Gesprächspartner zu überzeugen, Wittgenstein kann das gar nicht, weil er nur mit sich selbst spricht. Dadurch aber gibt es keine sophistischen Tricks, und kein Kombattant wird bei einem solchen Selbstgespräch auf der Wallstatt bleiben. Was Cavell zeigen will, ist, wie befruchtend der Zweifel als zentrales Prinzip des Skeptizismus ist. Dennoch tut er damit nicht die Existenzmöglichkeit alles dessen ab, was als außerhalb meiner selbst erscheint.
Nur so viel sei von diesem Achthundertseitenbuch referiert: daß Cavell einen Skeptizismus gegenüber Gegenständen und gegenüber Menschen unterscheidet, daß beinahe drei Viertel seines Buchs dazu dienen, Wittgenstein als Kronzeugen für die Möglichkeit der Versöhnung von Skeptizismus und analytischer Philosophie aufzubauen, und daß dabei auch noch faszinierende Ausführungen zu John L. Austin zu lesen sind, dessen legendäre Harvard-Vorlesung von 1955 zur Theorie der Sprechakte der damals neunundzwanzigjährige Cavell als Stipendiat verfolgt hat. Austin ist der zweite Denker neben Wittgenstein, dessen Werk Cavell für geeignet hält, eine Brücke zu schlagen über den Graben zwischen kontinentaleuropäischer und neuerer angelsächsischer Philosophie.
Cavell selbst ist der dritte dieser braven Brückenbauer. Am Beginn seiner abschließenden Überlegung rechtfertigt er den Bezug auf Shakespeare damit, daß er "genötigt" sei, "zur Literatur zu greifen, um das Problem des anderen zu entdecken, daß ich sehe, wie weitgehend unentdeckt das Problem für die Philosophie ist, für die im englischsprachigen Raum herrschende, mein Denken nolens volens geprägt habende Philosophie". Ein Punkt also für Kontinentaleuropa. Doch wenige Seiten später, nach einem Rekurs auf Descartes, denkt Cavell darüber nach, welche Kultur wir heute mit dem französischen Säulenheiligen des Skeptizismus noch teilen, und es folgt einer jener Klammereinschübe, die immer höchst Bedeutsames signalisieren, die Einschränkung: "wenn auch heute vielleicht nur noch in der Literatur". Der Ausgleich ist gefallen: Beide philosophische Linien brauchen die Ergänzung durch die Literatur, weil - um es zuzuspitzen - die eine halb blind und die andere veraltet ist.
"Selbstverständlich", räumt Cavell im Selbstgespräch ein, "rechne ich damit, daß das von mir Gesagte die Frage aufwirft, ob und wie wir um die Unterschiede zwischen dem Schreiben von Literatur und dem Schreiben von Philosophie wissen." Jener Anspruch des "Wissens" ist gleichfalls ein zentraler Punkt von Cavells theoretischem wie begrifflichem Bemühen, dessen genauere Erörterung hier zu weit führen würde. Doch was an dem zitierten Satz bedeutsam ist, das ist einerseits die ihm innewohnende Rechtfertigung für alles, was Cavell nach dem Abschluß von "Der Anspruch der Vernunft" gedacht und geschrieben hat, und andererseits das offensichtliche Paradox, daß gerade dieser Autor von den beschworenen Unterschieden nichts wissen will. Denn die philosophische Form, die er pflegt, ist gerade eine literarische.
Und so schließt das Buch denn auch mit einem emphatischen Bekenntnis zur Zukunft der Philosophie, die Cavell nur dann gewährleistet sieht, wenn sie nicht mehr "das Verlangen hat, die Poesie aus der Polis hinauszuwerfen". Natürlich kann solch ein Bekenntnis ihm nicht als Fazit dienen - es wäre ja eine nicht dialogisch, sondern apodiktisch gewonnene These. Deshalb hängt Cavell eine letzte Frage an: "Doch kann Philosophie zu Literatur werden und dabei zugleich wissend bei sich bleiben?" Der Leser, sofern er Rezensent und nicht Philosoph sein will, darf denn doch apodiktisch antworten: Ja. Ganz offensichtlich kann sie das.
Stanley Cavell: "Der Anspruch der Vernunft". Wittgenstein, Skeptizismus, Moral und Tragödie. Aus dem Amerikanischen von Christiana Goldmann. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2006. 795 S., geb., 49,80 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Mit seiner Dissertation würde Stanley Cavell heute wahrscheinlich keine akademischen Meriten mehr erringen, doch lässt sie mit ihren Widersprüchen und Gedankenexkursionen den Denkprozess des Philosophen deutlich hervortreten, was die Lektüre so fesselnd macht, schwärmt Michael Hampe. Cavell, heute emeritierter Harvard-Professor, geht es in seiner in den 70er Jahren entstandenen Arbeit um die "Wiederentdeckung des Alltäglichen" in der Philosophie und eine Abkehr von der in der Philosophie allgegenwärtigen "Skepsis", die selbst moralphilosophische Selbstverständlichkeiten in Zweifel ziehen, erklärt der Rezensent. Der Zweifel als Methode verhindere einen alltäglichen Zugang zur Wirklichkeit und verliere auch den gewöhnlichen Menschen mit seinen Handlungs- und Denkantrieben aus dem Blick, argumentiert der Autor, so Hampe weiter. Er hat einen Faible für Cavells ausholende, an Henry James oder Herman Melville erinnernde Sprache und entdeckt zu seiner Freude, dass sie von Christiana Goldmann flüssig und ansprechend ins Deutsche übersetzt worden ist. Für Neulinge auf dem Gebiet der Cavellschen Philosophie, findet der eingenommene Rezensent die Einführung von Susan Neiman sehr nützlich.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
" Der Anspruch der Vernunft gehört zu den ungewöhnlichsten Büchern, die die Philosophie des 20. Jahrhunderts hervorgebracht hat..." Frankfurter Rundschau, Literaturbeilage zur Frankfurter Buchmesse