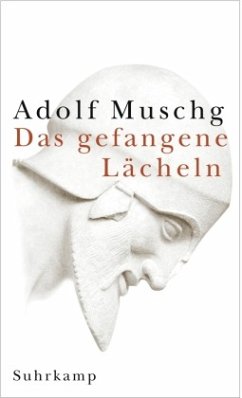"Kannst du dir vorstellen, daß ich nie einen Menschen geliebt habe?" Sein eigener Schrei ist es, der Josef, bis vor kurzem Herr einer Hotelkette, überrascht: Sein Enkel John stellt die Krippenfiguren im Spiel anders auf, als es die Weihnachtserzählung vorschreibt - und aus der Heiligen Familie wird eine Szene intimer Gewalt. Das Erschrecken darüber deckt eine Geschichte auf, die nicht vergangen ist. Hat Josef vor bald fünfzig Jahren die Frau, die er zu lieben glaubte, umgebracht?
Diese Geschichte kann er keinem Sechsjährigen erzählen. Also schreibt er dem Enkel einen langen Brief, den dieser in zwanzig Jahren einmal erhalten soll. Dann wird er lesen können, wie Josef auf sein Leben zurückblickt - nicht mit Stolz und Gefühlen des Glücks. Aufgewachsen in einem Klima von falscher Moral und Kälte, flüchtet er aus dem Elternhaus, um sich in der eigenen Generation eine neue Familie zu suchen. Was ihm in den Milieus der fünfziger und sechziger Jahre zustößt, mündet in jene schreckliche Tat, die Josef aus der Bahn wirft. Er flieht in die Ferne, bis nach Ägypten. Und dort begegnet ihm eine Frau, die sein Scheitern unverhofft beendet.
Adolf Muschg ist ein wunderbares Porträt eines Mannes gelungen, der sich von den großen Idealen, aber auch Nöten seiner Nächsten umstellt sieht und der, weil er das Zeug zum Revolutionär nicht hat, einen langen Weg der Befreiung gehen muß. Und das Lächeln, das Josef von seinem Vater geerbt hat? Es bleibt nicht gefangen. Dem Leser - der Leserin vielleicht noch eher - kann es in jedem Satz dieses Textes aufgehen: in dem, was er festhält, und in dem, was er offenläßt.
Diese Geschichte kann er keinem Sechsjährigen erzählen. Also schreibt er dem Enkel einen langen Brief, den dieser in zwanzig Jahren einmal erhalten soll. Dann wird er lesen können, wie Josef auf sein Leben zurückblickt - nicht mit Stolz und Gefühlen des Glücks. Aufgewachsen in einem Klima von falscher Moral und Kälte, flüchtet er aus dem Elternhaus, um sich in der eigenen Generation eine neue Familie zu suchen. Was ihm in den Milieus der fünfziger und sechziger Jahre zustößt, mündet in jene schreckliche Tat, die Josef aus der Bahn wirft. Er flieht in die Ferne, bis nach Ägypten. Und dort begegnet ihm eine Frau, die sein Scheitern unverhofft beendet.
Adolf Muschg ist ein wunderbares Porträt eines Mannes gelungen, der sich von den großen Idealen, aber auch Nöten seiner Nächsten umstellt sieht und der, weil er das Zeug zum Revolutionär nicht hat, einen langen Weg der Befreiung gehen muß. Und das Lächeln, das Josef von seinem Vater geerbt hat? Es bleibt nicht gefangen. Dem Leser - der Leserin vielleicht noch eher - kann es in jedem Satz dieses Textes aufgehen: in dem, was er festhält, und in dem, was er offenläßt.

Nachrichten aus der ungeheizten Hölle: Adolf Muschgs literarische Seelen- Rosskur „Das gefangene Lächeln”
Josef heißt man nicht ungestraft, schon gar nicht als literarische Figur. Der Josef aber, den Adolf Muschg für seine jüngste Erzählung erfunden hat, trägt gleich so viel auf den Schultern, dass es für ein mehrbändiges Romanwerk ausreichen würde. Sein voller Name lautet Josef Kaspar Kummer, ruft also neben der Personalunion von alttestamentlichem Joseph und Jesu Ziehvater nicht nur das Findelkind Hauser, sondern auch noch einen der Drei Könige sowie Kafkas unglückseligen Josef K. ins Gedächtnis und schlägt überdies ein Lebensmotto an, das wenig Frohsinn verheißt.
Ist der so Befrachtete schon nicht Zimmermann oder Bauhandwerker von Beruf, studiert er, nachdem er der Theologenlaufbahn entsagt hat, doch immerhin Architektur. Sein Versuch, sich mit einer Jurastudentin namens Maria zu paaren, verläuft keusch im Sande, während seine mehr als merkwürdige Beziehung zu der männermordenden Kommilitonin Magda ihn ein Leben lang beschäftigen wird.
Wie man einem Scheich entgeht
Weil er glaubt, diese Femme fatale mit Übergewicht, Basedow-Augen und grämlichem Mund – „schön war sie wohl nicht, doch apart” – im Affekt getötet zu haben, flieht er nach Ägypten, wo ihm zwar nicht die Gattin, dafür aber die Tochter seines Arbeitgebers nachstellt, was für ihn erfreulichere Konsequenzen hat als der Verführungsversuch der Frau Potiphar für seinen biblischen Vorgänger: Josef K. heiratet die schöne Zoë, die sich von ihm schwängern ließ, um der Zwangsehe mit einem Scheich zu entgehen, und übernimmt die Firma ihres Vaters. Am Ende hat er, der Schweizer Bürgersohn, es zum Seniorchef einer amerikanischen Hotelkette gebracht. Im Ruhestand fasst er den Entschluss, seinem sechsjährigen Enkel John seine Memoiren per Brief zu überantworten – mit der Auflage, dass die in abgeklärt-sachlichem Ton verfasste, aber keineswegs jugendfreie Lebensbeichte erst nach zwanzig Jahren entsiegelt und gelesen werden dürfe.
Eine abenteuerliche Geschichte, die durch allerlei kolportagehafte Elemente gar einen Hauch von Irrwitz erhält. So begegnet der Held in reifen Jahren der Jugendliebe seiner Mutter, einem freundlichen Herrn namens – Joseph, in dessen Augen er „die Wärme leuchten sah, die ihr gefehlt hatte”. Sie hat zu diesem Zeitpunkt längst ihrem Leben ein Ende gesetzt, mit einem Sprung „vom Dachstock des Millennium-Hotels”, nachdem sie in ihrer Witwenzeit noch einige Anstrengungen unternommen hatte, den „Kummer mit Kummer” zu vergessen. Ihr strenggläubiger, gefühlskalter Gatte, aus bäuerlicher Herkunft zum „Parteichristen” im Nationalparlament aufgestiegen, ist dem Sohn Josef auch als Vater in unguter Erinnerung geblieben. „Das gefangene Lächeln” im Titel der Erzählung ist jenes väterliche Lächeln, das er als Kind fürchtete: „Denn es war dem von tiefen Furchen geteilten Untergesicht aufgesetzt wie eine schmallippige Blüte mit fleischfressenden Zähnchen.”
Und schon haben wir den Schlüssel, der diese fast übermütig abstruse, mit schicksalsträchtigen Namen und mythologischen Mustern geradezu aufdringlich beladene Erzählkonstruktion öffnet und den Blick auf ihren kummervollen Kern lenkt. Wie so oft bei Muschg geht es auch diesmal um frühe seelische Entbehrungen und Verwundungen, die einen Lebenslauf prägen und zu schuldhaften Verstrickungen führen, auf einem Weg der Buße oder inneren Läuterung jedoch geheilt werden können. Das Thema „Literatur als Therapie?”, das der Autor in seinen Frankfurter Vorlesungen vor gut zwei Jahrzehnten auch theoretisch zu fassen versuchte, hat er hier in entwaffnend vordergründiger Weise neu bearbeitet: Der Briefschreiber Josef therapiert sich selbst durch seine Konfession und zieht den Leser, so er dafür empfänglich ist, in seine literarische Seelen-Rosskur hinein.
Ein schauderhaftes Obligatorium
Er muss dazu freilich Spuren jener Erfahrungen, die der Großvater dem Enkel zu vermitteln sucht, in der eigenen Biographie noch wiederfinden. Das Klima bigotter Moral und christlich verbrämter Neurosen, das in schweizerisch-pietistischer Variante die Jugend- und Studentenzeit des Erzählers prägt, wird kommenden Generationen so fremd sein, dass Nachrichten aus dieser ungeheizten Hölle ihnen wie exotische Gespenstergeschichten erscheinen dürften. Wohl deshalb lässt Josef es nicht beim Erzählen bewenden, sondern kommentiert vorsorglich, was bei einem Kind des Medienzeitalters ungläubiges Staunen hervorrufen könnte: „Kannst du dir vorstellen, dass es einmal eine Jugend gab, für die alles, was mit dem Geschlecht zusammenhing, nach schauderhaftem Obligatorium roch? Einer Prüfung, vor der man in Furcht und Zittern lebte, weil sie noch weniger leicht zu bestehen war als die der Heiligkeit?” Es gibt viele Stellen wie diese. Sie heben den Text in den Rang eines sittengeschichtlichen Dokuments und schwächen ihn zugleich in seiner Eigenschaft als Literatur – ein Dilemma, das Adolf Muschg in früheren Werken mit mehr Grazie bewältigt hat. Und es fragt sich, ob die Briefsituation, dieser zum Anekdotischen wie zum Pädagogischen gleichermaßen verführende Rahmen, dem Stoff zuträglich war.
Furchterregend ist jedenfalls das Frauenbild, das Josef, der Mann mit dem mehrstimmig sprechenden Namen, aus Elternhaus und Schule ins Leben trägt und das auch auf die ersten Lockerungsübungen im existentialistisch geprägten Studentenmilieu der fünfziger Jahre seinen dunklen Schatten wirft. In einer Welt, in der man „unter Zwölfjährigen ernsthaft diskutiert, ob Frauen auch Menschen seien”, mögen sich später schauerliche Szenen ereignen wie jene, in der Josef die untreue, schwangere Magda in rasender Eifersucht vergewaltigt und beinahe umbringt. Aber auch hier drängt sich die Frage auf, inwieweit eine Schilderung, die so offenkundig dem Katharsis-Bedürfnis des Schreibenden entspringt, die Gegenwartsliteratur bereichert: Es fehlt ihr, bei aller Psycho- Logik, etwas wie innere Notwendigkeit.
Vielleicht aber wird Muschg einer der letzten Schriftsteller sein, denen es noch ein Anliegen ist, den Mythos der Heiligen Familie zu zerstören, ihre Figuren umzustoßen und in neuen, entlarvenden Konstellationen zu arrangieren, so wie sein Enkel es in der Eingangsszene des Buches mit den tönernen Krippenfiguren seiner Urgroßmutter tut. Der Anblick des Joseph, der seinen Stab wie eine Rute erhebt und im Begriff ist, die an den Esel gelehnte Maria zu züchtigen, löst in seinem Namensvetter den Schock aus, der ihn zu dem Bekenntnisbrief animiert. Nicht auszuschließen ist, dass die Erzählung erst nach Ablauf der Frist, die der Großvater dem kleinen Jungen gesetzt hat, ihre wahren Adressaten findet – als Flaschenpost aus der entschwundenen Epoche, in der man den großen Lehren der Seelenkunde huldigte und hoffte, das „gefangene Lächeln” durch Selbsterforschung befreien zu können.
KRISTINA MAIDT–ZINKE
ADOLF MUSCHG: „Das gefangene Lächeln”. Erzählung. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2002. 256 Seiten, 18,90 Euro.
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.diz-muenchen.de

Nach dem Krippenumbau: Adolf Muschg schlingt ein Möbiusband um die Heilige Familie / Von Eberhard Rathgeb
Wir schlagen den neuen Muschg auf und denken an Hellinger. Denn Muschgs Erzählung beginnt mit einer Art von Familienaufstellung. Und Familienaufstellungen sind das Heimterrain Bert Hellingers, der viele Jahre in einem katholischen Missionsorden in Südafrika gewirkt hat und nun weltweit als Therapeut tätig ist. Bei den Familienaufstellungen geht es vor allem darum, daß Familienmitglieder ihre Positionen in der Familie nachstellen und daran erkennen, welche Konflikte in dieser Anordnung zum Ausdruck kommen. Auch in der Schweiz haben sich Menschen schon zu einer Arbeitsgemeinschaft Bert Hellinger zusammengestellt.
Was passiert bei Muschg? Ein Opa und ein Enkel sitzen vor der Weihnachtskrippe. Der Junge arrangiert die Heilige Familie neu. Joseph steht nun nicht mehr neben oder vor, sondern hinter Maria. Er stützt sich nun auch nicht mehr auf seinen Stock, sondern er schwingt unselig den Knüppel über der Maria nach der unbefleckten Empfängnis. Der Opa sieht das, stößt einen Schrei des Entsetzens aus. Der Schreck läßt nach, der Opa beruhigt sich. Er ist dem Enkel eine Erklärung für den Krippenvorfall schuldig, und so schreibt er dem Sechsjährigen einige Briefe. Die soll der Junge in zwanzig Jahren lesen.
Aus den Briefen an den Enkel erfahren wir: Der Opa wächst in einer Familie auf, die mit der Hand auf der Bibel lebt und aus Erfahrung mit dem Teufel rechnet. Das Böse wütet gerne in der Weibsnatur, die vom Mann eingedämmt werden muß. Die Sünde ist von dieser Welt, weil kein Leben ohne das Weib ist. Kann einer freimütig lachen, der in diese Zwangsvorstellungen hineinwächst? Wir erkennen, so Muschg, die Gefangenen eines rabiaten Christentums schon an ihrem verkrampften Lächeln. Damit erklärt sich der Titel der Erzählung.
Der Opa heißt Josef, und ihm ergeht es wie dem alten Joseph, dem Zimmermann. Er studiert Architektur, geht auf Reisen. Als er zurückkommt, ist seine unberührte Maria, die Magda heißt, schwanger. Der Opa in jungen Jahren findet sich mit dem Glauben an eine unbefleckte Empfängnis nicht ab. Er schlägt auf die Magda ein, bis sie kein einziges Wort mehr sagt. So still sind nur Tote. Darauf tritt er seine Flucht nach Ägypten an. Dort fällt der Ausgestoßene nicht in eine Löwengrube. Er rennt einer Tochter aus schwerreichem Haus in die Arme und wird ein Baulöwe mit einer Hotel-Kette um den Hals. Vierzig Jahre vergehen. Eines Tages liest der Opa eine Todesanzeige und erfährt daraus, daß seine Verlobte noch vierzig Jahre gelebt hat: Sie ist erst vor wenigen Tagen gestorben. Der Mörder ist kein Mörder (von außen gesehen, denn die Tote lebte) und ist wiederum doch ein Mörder (von innen gesehen, denn er fühlte sich wie ein Mörder).
Muschg erzählt eine gewitzte Geschichte. Nicht der Aufsteller Bert Hellinger spielt die entscheidende Rolle, sondern August Ferdinand Möbius. Muschg gibt uns einen Wink: Er macht den Opa zum Chef der Firma Moebius. Mit Möbius - 1790 bis 1868, seit 1820 Direktor der Sternwarte in Leipzig, seit 1840 Professor für Astronomie und Mechanik an der Universität Leipzig - verbindet uns heute noch das vertrackte Möbiusband.
Ein Möbiusband - das geheime Sinnbild der Erzählung Muschgs - kann jeder basteln: Man braucht dafür einen langen schmalen Papierstreifen. Den dreht man einmal um 180 Grad. Darauf klebt man die beiden Enden zusammen. Nun fährt man mit dem Finger an dem Band entlang. Und was geschieht? Man gelangt mit dem Finger auf die Rückseite des Punktes, von dem man ausgegangen ist - und zwar, das ist das Erstaunliche, ohne daß dabei der Finger über den Papierstreifenrand gekommen ist. Vorne und hinten, rechts und links spielen im Möbiusband keine Rolle mehr. Wenn man eine Schere nimmt und entlang seiner Mitte den Papierstreifen durchschneidet, dann erhält man nicht zwei voneinander getrennte Streifen, sondern zwei Bänder, die untrennbar miteinander verschlungen sind.
Das Leben - und insbesondere das Leben, das am Gängelband eines rabiat ausgelegten Christentums geführt wird - gleicht einem Möbiusband: Wer sein Leben lebt, kann sich also nicht an die Seite stellen und so tun, als könne er sich von außen betrachten und beurteilen. Man kann sich von seiner Familie lossagen. Doch man kann sich nicht von ihr losschneiden. Einmal geschlossen, bleiben Beziehungen haften. Finden ein Mann und eine Frau in dem Wahn zusammen, nur der Tod werde sie voneinander scheiden, dann bleiben sie miteinander verbunden, auch wenn sie sich trennen. Das möchte uns der alte Adolf Muschg sagen. Und er sagt es, indem er uns in klugen, knappen, festen Sätzen Opa Josefs Möbiusband-Geschichte erzählt. Wir sehen: Ein Krippenumbau macht aus Muschg noch keinen bekennenden Familienaufsteller.
Adolf Muschg: "Das gefangene Lächeln". Eine Erzählung. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2002. 156 S., geb., 19,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Dem Buch bescheidet Roman Bucheli "Szenen von ergreifender Intensität und anrührender Intimität". Wie Muschg seinen Helden Joseph den "Josephsweg" gehen lässt, ihn mit einem Schicksal beschwert, das sich erfüllen muss, und ihn sich in dies Schicksal fügen lässt, wobei sich eben an dieser Ergebenheit, wie Bucheli schreibt, Muschgs Gestaltungskraft entzündet: "Das holt - literarisch, sprachlich - das Beste aus ihm heraus" - das hat dem Rezensenten gefallen. Erinnert haben ihn die "heiter-entschiedenen Abschiedsgesten" im Buch an Frischs "Der Mensch erscheint im Holozän". Was Bucheli nicht daran hindert, die "freudlose Lebensgeschichte", die Muschg Joseph als Konfession für seinen Enkel aufschreiben lässt, ob ihrer gelegentlichen Ausuferungen zu bemängeln, wenn sie sich "mit Anekdotischem aus der Studienzeit" vermengen, "was nicht nur entbehrlich scheint, sondern der Erzählung ein unbekömmliches inneres Gefälle gibt".
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH