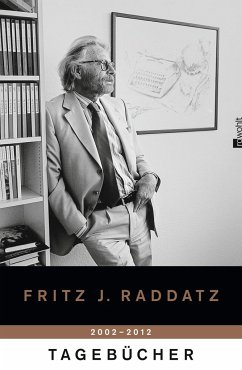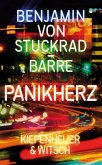«Auf, auf ... », ruft Fritz J. Raddatz sich selber zu, als er sich 2008 in einem Münchner Hotel für die größte Party des Jahres umzieht, «ich habe noch gar nicht die Krawatte gebunden - und bin schon enttäuscht.»
Der Ton einer schonungslosen Selbstbeobachtung, die gleichzeitig Beobachtung anderer ist, angeschlagen bereits in den 2010 erschienenen «Tagebüchern 1982-2001», setzt sich in diesem zweiten Band fort: noch klarer, schärfer, doch immer wieder, wie zum Ausgleich, auch mit einem Einschlag ins Komische, Übertreibende und rigoros Selbstironische. In der Form freier als zuvor, fügt Raddatz jetzt Monologe, kurze Telefon-Dramen, Essays und Porträt-Miniaturen in den Text ein.
Und neue Namen tauchen auf: nicht mehr nur Hochhuth, Enzensberger und Grass, sondern auch Joachim Fest, Katharina Thalbach, aus der Erinnerung Klaus Mann und etliche andere. Weiterhin geht es um ein Bild der guten Gesellschaft, um die Frage: «Wie leben die Deutschen?»; weiterhin um die entstehende Einheit von Ost und West, doch mittlerweile, und mit zunehmender Wut, auch um die amerikanische Politik: den Krieg im Irak, die Lügen der Administration, Guantanamo, für Raddatz die schmerzliche Revision einer Lebensüberzeugung vom zuvor geliebten Amerika.
Das Erscheinen des ersten Bandes dieser Tagebücher war ein literarisches Ereignis, man hat das Buch «den großen Gesellschaftsroman der Bundesrepublik» und «ein kaum erträgliches Kunstwerk» genannt. Hier ist Band 2: auf derselben Höhe, mit demselben Feuer.
Der Ton einer schonungslosen Selbstbeobachtung, die gleichzeitig Beobachtung anderer ist, angeschlagen bereits in den 2010 erschienenen «Tagebüchern 1982-2001», setzt sich in diesem zweiten Band fort: noch klarer, schärfer, doch immer wieder, wie zum Ausgleich, auch mit einem Einschlag ins Komische, Übertreibende und rigoros Selbstironische. In der Form freier als zuvor, fügt Raddatz jetzt Monologe, kurze Telefon-Dramen, Essays und Porträt-Miniaturen in den Text ein.
Und neue Namen tauchen auf: nicht mehr nur Hochhuth, Enzensberger und Grass, sondern auch Joachim Fest, Katharina Thalbach, aus der Erinnerung Klaus Mann und etliche andere. Weiterhin geht es um ein Bild der guten Gesellschaft, um die Frage: «Wie leben die Deutschen?»; weiterhin um die entstehende Einheit von Ost und West, doch mittlerweile, und mit zunehmender Wut, auch um die amerikanische Politik: den Krieg im Irak, die Lügen der Administration, Guantanamo, für Raddatz die schmerzliche Revision einer Lebensüberzeugung vom zuvor geliebten Amerika.
Das Erscheinen des ersten Bandes dieser Tagebücher war ein literarisches Ereignis, man hat das Buch «den großen Gesellschaftsroman der Bundesrepublik» und «ein kaum erträgliches Kunstwerk» genannt. Hier ist Band 2: auf derselben Höhe, mit demselben Feuer.
"Wann immer ich über Raddatz sprach und Raddatz über mich, da wußten wir: Gelangweilt haben wir uns nie." -- Marcel Reich-Ranicki
"Den Roman Raddatz liest man im Rausch, Hunderte Seiten in ein paar Tagen, so gierig, wie Raddatz gelebt hat." -- Rainald Goetz
"Ein erregbarer Erreger ist er. Sicher der beste in diesem Fach." -- Arno Widmann, Frankfurter Rundschau
"Ein rasendes Leben für die Literatur." -- Thomas Schmid, Die Welt
"Den Roman Raddatz liest man im Rausch, Hunderte Seiten in ein paar Tagen, so gierig, wie Raddatz gelebt hat." -- Rainald Goetz
"Ein erregbarer Erreger ist er. Sicher der beste in diesem Fach." -- Arno Widmann, Frankfurter Rundschau
"Ein rasendes Leben für die Literatur." -- Thomas Schmid, Die Welt
Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension
Voller Faszination, Begeisterung und Sympathie für Fritz J. Raddatz schreibt Arno Widmann eine Eloge auf dessen Tagebücher. In ihnen offenbart sich Raddatz ihm als "autopoetisches System", das sich jedoch von anderen weltverschlingenden, egomanischen Systemen in erheblicher Weise unterscheidet: Das System Raddatz ist nicht weltscheu, sondern immer auf Beutesuche, und es reflektiert. Wenn er sich selbst beobachtet, nimmt er sich sehr ernst, und zwar öffentlich, was dem Rezensenten ungeheuer imponiert. Mag sein, dass Raddatz "ichsüchtig und ichflüchtig" ist, aber er besitze die Courage, die Kraft und die Kunst, um beides zu zeigen. Und vor allem schont er sich trotz aller Eitelkeit nicht. Er beobachtet sein eigenes Altern und das seiner Freunde, Verfall und Prostata. Aber Raddatz wäre nicht er selbst, wenn er nicht auch tolle Geschichten erzählen würde. Besonders gut hat Widmann gefallen, wie er ein Interview von Franziska Augstein aufspießt, in dem ihre Mutter Maria Carlsson-Augstein erzählt, sie habe 1962 ihrem inhaftierten Mann selbstgekochte Suppe mit dem verbeulten VW ins Gefängnis gebracht. Raddatz erinnert sich dagegen daran, dass Multimillionär Rudolf Augstein ihr einen Maserati geschenkt hatte und sein Essen im Vier Jahreszeiten bestellte.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Nutzlosigkeit
Im neuen Tagebuchband verschriftet
Fritz J. Raddatz sein eigenes Verschwinden
VON FRITZ GÖTTLER
Ein Animal triste steckt hinter diesem Buch. Erschöpft und seine Erschöpfung beklagend, ein bisschen auch: genießend. Ein Katalog der immer gleichen Frustrationen, monoton aufgeblättert in verbitterter Empörung, in schroffer Fassungslosigkeit, einer Gebetsmühle gleich, selten wirklich komisch, oft ungeniert, unanständig, gemein. Die Traurigkeit dabei verstärkt durch die Leere nach dem Kraft-Akt des großen Memoirenbandes, „Unruhestifter“ von 2003, und des ersten Bandes der Tagebücher, 1982-2001. Eine postkoitale Melancholie, nach dem Schaffensorgasmus. Was nun tun mit der verbliebenen Produktivkraft, mit der intellektuellen Potenz?
Unruhe gestiftet hat Fritz J. Raddatz, Jahrgang 1931, die ganze zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts hindurch. Zwei innerdeutsche Grenzüberschreitungen: 1950 ging er, angewidert von der Adenauer-BRD, nach Ostberlin, wurde Lektor beim Verlag Volk und Welt, geriet mit den offiziellen Stellen in Konflikt, kehrte in die BRD zurück, war in den Sechzigern Cheflektor beim Rowohlt-Verlag, dann 1977 bis 1985 Feuilletonchef der Zeit , schrieb nebenbei große Arbeiten über Benn, Rilke, Marx, Herausgabe der Tucholsky-Ausgabe.
Der Überzeugungstäter dringt immer wieder durch in seinem Schreiben, zum Beispiel in der Abscheu vor den Amerikanern und ihrem Krieg im Irak, „unter rüpelhaftester Verletzung allen Völkerrechts vom Zaun gebrochen“: „Mein geliebtes, bewundertes Amerika nun ein Kontinent der Barbarei geworden. . .“ Das moralische Verdikt geht zusammen mit den sinnlichen Erinnerungen der Jugend an die „Lässigkeit, den anderen Gang, die Schlenker-Haltung der GIs, nicht nur das Kaugummi, die Schokolade, die Cigaretten in den an der Ecke aufgerissenen Päckchen und die ,Turnhemden‘ (unsereins kannte ja keine T-Shirts), in denen sie in ihren geheizten Clubs rumsaßen oder Boogie-Woogie tanzten (. . . ) Sie waren Zivilisten in Uniform, und unsereins war Zivilisten gewohnt, die selbst OHNE Uniform immer ,soldatisch‘ waren.“ Eine solche Sinnlichkeit, emotionale Moral gewissermaßen, ist selten bei Raddatz. Dabei spielen Begehren und Liebe eine Rolle in seinen Erinnerungsbüchern, die Treue und der Sex, unzählige One-Night-Stands, ein paar mit Frauen, sehr viele mit Männern. Alles offen dargelegt, nichts gezinkt, eine Rhetorik der Aufrichtigkeit, die gern mit Provokation arbeitet, leider nur selten mit Ironie.
Der „Unruhestifter“ war ein Stück starke Literatur, hatte Dynamik und Drive und ein genaues Gespür für den Fortgang des Denkens und Empfindens in Deutschland, Ost wie West. Die neuen Tagebücher sind das Buch zu diesem Buch, sie beginnen mit der Arbeit am „Unruhestifter“, den Bedenken und Selbstzweifeln angesichts der Möglichkeiten des Projekts, den eher schleppenden Verkaufszahlen, der positiven bis überschwänglichen Rezeption, dem PR-Rummel, der ums Buch und seinen Autor entfesselt wird.
Dokumentiert ist hier auch die Vanitas des deutschen Kulturbetriebs, die schon mit den Inszenierungen der Gruppe 47 einsetzte, verbissener als in anderen Ländern, Frankreich zum Beispiel, der großen Vorbildkulturnation, die nur noch ein – für den Autor – kümmerliches Dasein fristet. Eine Vanitas, die Raddatz einst aktiv mitgestaltet hat. Nun droht er – einer der traurig-komischen Momente des Buches – im Alter ihr Opfer zu werden. Ein Klagelied, ein Lamento. Das Nevermore von Poes Raben schallt durch das Buch hindurch. Der Autor, hineingezwungen in die Misanthropie, „summa cum laude in Hypochondrie promoviert“. In eine Mischung aus Schamgefühl und Verbitterung über den doppelten Insult, den des Alters und den des Literaturbetriebs. Gnadenlos hält er, zum Zeitzeugen degradiert, Gericht über die großen Figuren, je knapper, desto brutaler.
Ein „Endlos-Roman“ ist dieses Buch, das Raddatz „Verkommenheit des Literaturbetriebs“ betitelt und immer wieder mit allen Insignien eines Zuhälterbetriebs beschreibt. Es scheint kein Zufall zu sein, dass das Zentrum der bundesdeutschen Intellektualität bis über die Sechziger hinaus – der Spiegel , die Zeit – in Hamburg sich entwickelte mit seiner Bohème, seiner meernahen Dekadenz. Sein Refugium sucht der gestresste Autor Raddatz, zum Entspannen, zum konzentrierten Arbeiten, immer wieder in seinem Haus auf Sylt.
Ein Für-sich-Sein kennt er dort nicht, und es gibt beim Lesen auch nie das Gefühl von Indiskretion und Indezenz, das man sonst bei Autobiografien verspürt. Das schonungslose Abrechnen, das Seite für Seite vorgenommen wird, liest sich wie ein Haushaltsbuch, die eigene Nutzlosigkeit wird nahezu numerisch durchgerechnet. Die ständigen „has-been“-Visionen, die Perspektivlosigkeit des Ausgesonderten, der – physische – Schmerz, nicht mehr gefragt zu werden, nicht mehr gefragt zu sein. Und plötzlich schreibt er also für die Welt und die Welt am Sonntag , besucht Joachim Fest in seiner Villa, „gebildet und vertratscht“, was eine angenehme Mischung ist.
Was bleibt, ist Frust über die ausbleibenden großen und großzügigen Aufträge, das Warten auf Honorarangebote und das Feilschen darum. Die Auswirkungen der großen Wende im Kultur-, besonders im Printbetrieb der Internetjahre werden von Raddatz minutiös beschrieben, ohne dass die Ursache je thematisiert würde. Es sind lächerliche Spielchen, mit denen er nun malträtiert wird, großspurige Anfragen, auf die dann schnell großes Schweigen folgt, nicht gehaltene Versprechen. Auf das permanente „Wir haben kein Geld“ mag er gar nicht mehr mit seinem Witz „Kein Geld hab ich selber“ antworten. Verzweifelt bringt er seinen Hurensatz an, „Ich bin teuer“, und dann lässt er sich doch zu kläglichen Bedingungen verpflichten. Zehn Jahre voller Vorträge, Rezensionen, Buchvorstellungen, Aufsätzen für befreundete Autoren, Interviews, Talkshows, Hilfe bei Projekten anderer, schließlich auch Ausstellungen. Raddatz fühlt sich ausgebeutet, ausgeschlossen, ausgepowert. Aber der Aktivismus rettet ihn über die große Leere hinweg, mit seiner Dialektik des Beharrens auf seiner Würde und der Bereitschaft, sich jede Würdelosigkeit gefallen zu lassen. „Ich bin eine Art Trotzki, dessen Anwesenheit wegretuschiert wurde.“
Kleinlichkeit prägt den Stil des Buches, die Generosität, die Raddatz so gern seinen Freunden und Kollegen gewährte und für die er nur wenig zurückbekam, versagt er dem Leser. Eine Generosität, die dem deutschen intellektuellen Diskurs seit den Sechzigern immer stärker abhandenkam und die in Zeiten der globalen Kommunikation völlig nutzlos geworden ist.
„Aus einer Mischung von Altersverdrossenheit, Müdigkeit und Wissen, dass wir alle nicht mehr der ,Nabel der Welt‘ sind, überreagieren wir, alte Stars, die so tun, als würden sie von Angeboten belästigend überhäuft à la ,Ich gehe schon gar nicht mehr ans Telefon‘. Aber wir merken nicht, daß wir gar kein Telefon mehr HABEN.“ Eine Gloria Swanson der Literatur, meint er selber – Norma Desmond in ihrem Haus am Sunset Boulevard. Wann ist Fritz J. Raddatz „ready for his close-up“?
So jämmerlich wie der Körper des Kulturbetriebs ist auch der Körper des alten Literaten. Überall Abnutzung und Verfall, bei den Freunden, mit denen er im Kontakt ist, Grass und Hochhuth, Kempowski und Paul Wunderlich. Haarausfall, Falten, tränende Augen, Krebs, Demenzanwandlungen. Das ist hart für einen, der sich zum Hedonismus bekannte, zur Eleganz und zur Noblesse im Auftreten, im Wohnen, Kunstsammeln, Schreiben.
Mit Fritz J. Raddatz ist wie mit keinem anderen die Arbeit des Intellektuellen eine Stilfrage geworden. Und bei allem Stress im Tagesgeschäft eines Kulturbetriebs, der immer stärker ins Sensationalistische hinüberglitt, hat er stets Respekt und Anerkennung, Dank, Anstand reklamiert – „Ist das noch ein begriffener Begriff?“. Und eine geziemende Bewirtung. Wie oft hat er – das kommt zu den ganzen Altersmalaisen dazu – Nächte mit einem Brummschädel verbracht, weil der Wein bei Veranstaltungen so schlecht war.
Es war ein schamloser Inzuchtverein, der im vorigen Jahrhundert die intellektuelle Debatte bestimmte. Eine vertrackte, auch peinliche Mechanik der Selbstbestätigung – und der gegenseitigen Belauerung. Alle paar Seiten gibt es Telefonate, Begegnungen, Abendessen mit den alten Größen, die sich ihre eigene Wichtigkeit bestätigen. Raddatz fängt an, über die Zweitrangigkeit seines Business zu reflektieren. Schaffen, erkennt er, tun immer die anderen, der Kritiker bleibt Arrangeur.
Ein verfehlter Traum steckt in diesem Buch, von Raddatz verfehlt und von der deutschen Kultur nach dem Krieg. Der Traum vom Flaneur, vom Dandy, wie ihn Walter Benjamin – von Raddatz nicht übermäßig geschätzt – skizziert. Man braucht Lässigkeit, um von seiner Zeit und ihren Träumen zu erzählen, eine Fähigkeit, „mit einem Griff das Futter der Zeit nach außen zu kehren“. Mit Träumeerzählen, das gibt Raddatz offen zu, hat er wirklich Schwierigkeiten.
Aufrichtig sind seine Notate,
oft ungeniert, bitter und gemein,
aber leider nur selten ironisch
Der Traum vom intellektuellen
Dandy, den er zu leben versuchte,
fehlt heute im Kulturbetrieb
Fritz J. Raddatz:
Tagebücher 2002-2012. Rowohlt Verlag, Reinbek 2014. 720 Seiten. 24,95 Euro, E-Book 21,99 Euro.
Fritz J. Raddatz, damals Cheflektor bei Rowohlt, beim sogenannten Spiegel -Gespräch 1966.
Foto: Ullstein Bild
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de
Wann immer ich über Raddatz sprach und Raddatz über mich, da wußten wir: Gelangweilt haben wir uns nie. Marcel Reich-Ranicki