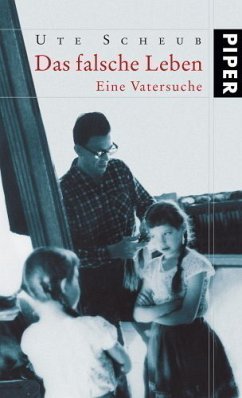Persönlich, anrührend, manchmal geradezu beklemmend zeichnet Ute Scheub das falsche Leben des Mannes, der ihr Vater war – und liefert das Porträt einer ganzen Generation von deutschen Vätern.
Ein Mann steht vor zweitausend Menschen auf, ruft »Ich grüße meine Kameraden von der SS!«, setzt eine Flasche Zyankali an die Lippen und trinkt – Stuttgart, Evangelischer Kirchentag 1969. »Der Tod trat auf dem Weg ins Robert-Bosch-Krankenhaus ein«, notiert Günter Grass, der diesen Manfred Augst in »Aus dem Tagebuch einer Schnecke« porträtiert hat. 35 Jahre später stößt Manfred Augsts Tochter auf die Abschiedsbriefe, die Manuskripte und die Feldpostbriefe ihres Vaters. Eine erschütternde Spurensuche beginnt, bei der Ute Scheub mehr findet als nur ein einzelnes Schicksal. Wie viele jener Männergeneration, die Nachkriegsdeutschland geprägt hat, konnte Manfred Augst nicht über seine Erlebnisse im Krieg reden, schon gar nicht mit seinen Kindern, denen er nur ein ferner, liebloser Vater sein konnte. »Er ist – buchstäblich – an seinem Schweigen erstickt.«
Ein Mann steht vor zweitausend Menschen auf, ruft »Ich grüße meine Kameraden von der SS!«, setzt eine Flasche Zyankali an die Lippen und trinkt – Stuttgart, Evangelischer Kirchentag 1969. »Der Tod trat auf dem Weg ins Robert-Bosch-Krankenhaus ein«, notiert Günter Grass, der diesen Manfred Augst in »Aus dem Tagebuch einer Schnecke« porträtiert hat. 35 Jahre später stößt Manfred Augsts Tochter auf die Abschiedsbriefe, die Manuskripte und die Feldpostbriefe ihres Vaters. Eine erschütternde Spurensuche beginnt, bei der Ute Scheub mehr findet als nur ein einzelnes Schicksal. Wie viele jener Männergeneration, die Nachkriegsdeutschland geprägt hat, konnte Manfred Augst nicht über seine Erlebnisse im Krieg reden, schon gar nicht mit seinen Kindern, denen er nur ein ferner, liebloser Vater sein konnte. »Er ist – buchstäblich – an seinem Schweigen erstickt.«

Ute Scheub sortiert die Hinterlassenschaften ihres Nazi-Vaters
Eine skurrile Szene: Auf dem Tübinger Bergfriedhof vergräbt eine Frau ein Papier. Es handelt sich um einen Brief zwecks Aufnahme moralischer „Entschuldungsverhandlungen”. „Lies das gefälligst!”, ruft die Frau, nachdem sie das Kuvert versenkt hat. Der Adressat ist ihr toter Vater, Manfred Augst. Tochter Ute hat ihm soeben schriftlich mitgeteilt, dass sich weigert, weiterhin „seine Schuld zu tragen”.
Welche Verbrechen Augst begangen hat, weiß Ute Scheub bis heute nicht. Sicher ist: Er war ein eingefleischter Nazi, ein schrecklicher Vater, ein herzloser Ehemann. Einerseits. Andererseits gefiel er sich als „Christ und Pazifist”, nachdem der Untergang des Dritten Reiches auch seinen eigenen Berufswunsch - „menschlicher Zuchtwart” - pulverisiert hatte. Für die 1956 geborene Tochter ist er ein ganz normaler deutscher Spießer. Von seinen Nachbarn unterscheidet er sich nur durch die Weigerung, „den geläuterten Demokraten zu spielen”. Und durch seinen Selbstmord.
Dreißig Jahre hat Ute Scheub, Journalistin und Mitbegründerin der taz, diesen Vater in sich begraben. Dann stolperte sie auf dem elterlichen Dachboden über einen Karton mit Manuskripten und vierzehn Abschiedsbriefen. Vor ihr entrollte sich nicht nur „Das falsche Leben” des gefühlsverkrüppelten Vaters, sondern auch der Faden ihres eigenen, insgeheim an ihn geketteten Schicksals.
Wirre Rede auf dem Kirchentag
Minutiös hatte Manfred Augst damals, im Sommer 1969, sein Ende geplant. Auf dem Stuttgarter Kirchentag hielt er eine wirre Rede, leerte danach ein Zyankali-Fläschchen und skandierte: „Ich grüße meine Kameraden von der SS.” Dann fiel er tot um. Günter Grass, Augenzeuge des Vorfalls, hat Augst 1972 porträtiert („Aus dem Tagebuch einer Schnecke”) und ihm dabei das Pseudonym verpasst, das auch die Tochter schützend beibehält: Angst und Augen fließen hier ineinander - die Angst der Kinder vor dem tyrannischen Familienoberhaupt und die Augen aller, die über Jahrzehnte hin verschlossen sind.
Der Zufallsfund auf dem Dachboden erhellt den blinden Fleck in der Familien-Charta. Mit jedem Zettel, den Ute Scheub aus dem Staub zieht, gewinnt der Vater an Kontur: ein geprügeltes Kind, das dem Herrenmenschen-Wahn der Nazis verfällt; ein Karrierist, der beim berüchtigten Hans F.K. Günther Rassenhygiene studiert, der SS beitritt und ins Wachbataillon „Hermann Göring” aufsteigt; ein Obergefreiter, der sich von Polen bis Afrika für Volk und Führer ins Zeug legt; ein Enttäuschter schließlich, der „vom Hitler- zum Jesusjünger” mutiert und dennoch ein teutonischer NS-Anhänger bleibt.
Den Kindern freilich, die nach dem Krieg geboren werden, kann er damit nicht kommen. Also entschließt er sich, zu schweigen. Manfred Augst verbunkert sich in seinem Inneren - ein depressiver, „monomanischer Vater”, der in Erwägung zieht, die ganze Familie auszulöschen. „Die Welt will mich nicht,” davon ist er überzeugt. Sonst hätte sie ihn kaum mit Karriereknick und Ehehölle bestraft. Er muss sich, wie die Tochter erkennt, überall und stets als Opfer begreifen, „um sich nicht als Täter sehen zu müssen.” Die Quittung fällt deutlich aus: „Dafür hasste ich ihn.”
Von den Mitscherlichs über Klaus Theweleit bis Tilmann Moser haben Wissenschaftler immer wieder jene Mischung aus Verdrängung, Verlogenheit und Verpanzerung analysiert, die Nachkriegsdeutschland prägte. Die Umkehr des Täter-Opfer-Verhältnisses, die Ute Scheub hautnah erlebt hat, zeitigt bis heute Folgen. Sie bürdete den Nachgeborenen traumatische „Gefühlserbschaften” (Scheub) auf und schrieb sich als Negativ-Matrix in ihre Biographien ein. Die bedingungslose Abkehr vom Vater hat Ute Scheub selbst durchexerziert: Seinem rechten Weltbild hielt sie ein linkes entgegen, seiner patriarchalen Aufgeblasenheit ihr feministisches Credo. Dass er „ein miserabler Vater” war, kann sie ihm verzeihen. Dass er niemals „auch nur ein einziges Wort des Mitgefühls” für die NS-Opfer fand, nicht. Wie man diese Ambivalenz fruchtbar machen kann, zeigt Ute Scheubs Buch auf beeindruckende Weise.
DORION WEICKMANN
UTE SCHEUB: Das falsche Leben. Eine Vatersuche. Piper Verlag, München 2006. 289 Seiten, 18,90 Euro.
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Eine Dienstleistung der DIZ München GmbH

Er grüßte seine SS-Kameraden und tötete sich vor Tausenden. Grass hat über ihn geschrieben. Und jetzt auch seine Tochter
Was für eine merkwürdige Nebenfigur war dieser Manfred Augst. Dieser sonderbare, lästige, wirr redende Herr, der sich im Jahr 1969 immer wieder in die Aufzeichnungen des Schriftstellers und Wahlkämpfers Günter Grass hineindrängte, die dieser 1972 unter dem Titel "Aus dem Tagebuch einer Schnecke" als Buch veröffentlichte. Grass berichtet darin von seiner Wahlkampftour für Willy Brandt, von deutscher Geschichte und Politik und von seiner Familiengeschichte. Und von einem erschütternden Ereignis:
Es war am 19. Juli, es war wahnsinnig heiß in Deutschland, und Günter Grass machte halt auf dem Evangelischen Kirchentag in Stuttgart. Zehntausende waren gekommen. Grass schreibt: "Das neue Theologiebedürfnis weitete alle Poren. Frühchristlich lief viel ziellose Jugend barfuß. Die Sprüche der kleinen und großen Propheten trugen sich auf und ab." Grass las in Halle 1 vor der Arbeitsgruppe "Der Einzelne und die Anderen" vor 2000 Zuhörern. Er las aus seinem damals noch unveröffentlichten Buch "örtlich betäubt" die Stelle, wo der Schüler Scherbaum beschließt, aus Protest gegen den Vietnam-Krieg seinen Dackel auf dem Kurfürstendamm zu verbrennen. Der Dackel stirbt am Ende nicht. Es ist eine Groteske wider den ritualisierten Protest. Ein halbes Jahr zuvor hatte sich Jan Palach auf dem Prager Wenzelsplatz, aus Protest gegen die sowjetische Invasion, öffentlich verbrannt. Grass warnte, eine Diskussion begann, wie viele Diskussionen vorher, und floß so dahin. Dann trat Augst ans Mikrofon, zwei Fläschchen in der Hand. Augst redete wirr, er klagte die Kirche an, weil sie ihm die Partnerschaft versagt habe, er sprach von alter Kriegskameradschaft und fehlenden Werten, er verlor sich in Merkwürdigkeiten, bedauerte, daß er der freien Rede nicht mächtig sei, las aus vorbereiteten Zettelchen vor und steuerte plötzlich auf einen letzten Satz zu: "Ich werde jetzt provokativ und grüße meine Kameraden der SS!" Buhen und Zischen unter den Zuhörern, Nervosität auf dem Podium, Grass schreibt mit, und nur wenigen fällt auf, wie Augst eines der mitgebrachten Fläschchen öffnet und austrinkt. "Das war Zyankali, mein Fräulein", sagt er zu einer neben ihm stehenden Frau, dann bricht er zusammen. Hilfe kommt zu spät. Auf dem Weg ins Krankenhaus ist Manfred Augst gestorben.
Grass will den sonderbaren Selbstmörder als Fußnote seines Buches beiseite schieben. Doch Augst drängt sich immer wieder in die Geschichte hinein. Wer war dieser Mann? Wer oder was war schuld an diesem Selbstmord als Fanal? Schließlich besucht er Augsts Familie. Er kommt zum Kaffee und bleibt zum Abendbrot. Frau Augst, drei Söhne, eine Tochter. Grass sitzt auf dem verwaisten Platz von Manfred Augst. Auch Grass hat zu Hause drei Söhne und eine Tochter. Für einen Abend sind die Familien vertauscht. Günter Grass ist Augst. Der SS-Mann mit dem großen Abgang.
Die Tochter ist die kleinste. Sie ist dreizehn Jahre alt, sitzt mit am Tisch und schweigt. Bewundert den Schriftsteller und ihre Brüder, die so gelassen mit ihm zu plaudern verstehen. Grass erwähnt sie später nur in einem Satz. Das war am 16. Dezember 1969, "als Willy schon Kanzler war".
Fünfunddreißig Jahre später sucht die kleine Tochter von damals auf dem alten Dachboden nach ihrer alten Lieblingsvase aus grünem Glas und findet alte Zettel, Aufzeichnungen ihres Vaters und zehn Abschiedsbriefe, die er über die Jahre geschrieben hatte: "Jetzt könnt Ihr wahrscheinlich im Haus bleiben", steht da, "wenigstens noch länger. Der Bausparvertrag ist auch gesichert, so kann ich diesen Schritt verantworten." Die Tochter liest und liest, die Briefe des peinlichen Vaters, des Schreckensvaters, des Nazivaters, den sie in ihrem Leben nicht ein einziges Mal lachen sah, der die Familie terrorisierte, seine Frau, die Söhne und der mit seinem öffentlichen Selbstmord die Familie zur bedauerten Kuriosität ihrer Heimatstadt Tübingen machte, zum Gespött.
Die Tochter ist die Journalistin Ute Scheub, die vor mehr als fünfundzwanzig Jahren die linksalternative "taz" mitbegründete, für die sie auch heute noch schreibt. Ute Scheub hat jetzt die Geschichte ihres Vaters geschrieben. Der Mann, den Grass Manfred Augst nannte, ein Pseudonym, das Scheub beibehält. Es ist eine Suche. Sie versucht zu verstehen, wie schon Grass es versucht hatte. Sie rekonstruiert das Leben eines Täters, der schon früh Mitglied der NSDAP geworden war, dann bei der SA, der SS, immer eifrig, übereifrig oft. "Er war ein hundertfünfzigprozentiger Nazi", schreibt Scheub, "ein ideologischer Dogmatiker, und ironischerweise beförderte ihn gerade diese Eigenschaft manchmal an den Rand der ,Bewegung'. Einmal, so erzählte später sein jüngerer Bruder, habe er einen ganzen SA-Zug aufgehalten, weil dieser das Lied ,Es zittern die morschen Knochen' falsch gesungen habe." Er studierte Rassenlehre beim berüchtigten Professor Hans F. K. Günther, dem sogenannten "Rasse-Günther", gehörte zum "Wachbataillon General Göring", kämpfte im Krieg an allen Fronten, und als am 3. Mai 1945 an seinem Kampfplatz die Kämpfe eingestellt werden, irrt er noch durchs Land, um an irgendeiner anderen Stelle weiterzukämpfen. Für Deutschland. Bis es endlich auch für Manfred Augst nichts mehr zu kämpfen gibt.
Seine Tochter erzählt das heute alles ruhig, fragend, manchmal erschüttert, manchmal kühl und staunend. Sie erzählt es als die exemplarische Geschichte der schweigenden Generation der Väter. Und wie dieses Schweigen eine Familie terrorisierte und alles Familienleben schließlich tötete. Sie erzählt, wie ihre Mutter ihr die Todesnachricht überbrachte und sie sich zwingen mußte, einige Tränen zu vergießen. Bis ihr Bruder ihr sagte, sie solle endlich damit aufhören. Jeder könne sehen, daß sie schauspielere. Von dem Begräbnis berichtet Scheub, das ist vielleicht der unheimlichste Moment des Buches, vom Begräbnis ihres eigenen Vaters, bei dem sie die ganze Zeit mit dem Lachen kämpfte. Ein unbändiger Wunsch zu lachen erschütterte das Mädchen beim Anblick des Sarges ihres eigenen Vaters. Was für ein unglaublicher Moment. Wieviel sagt er über die zerstörende Wirkung des Schweigens.
Die große Kunst von Scheubs Buch ist, daß sie beides erzählt. Die persönliche Geschichte, den lebenslangen Kampf gegen den Vaterschatten, das Verdrängen zunächst, das unbedingte Andersseinwollen dann. Das Leben als eine Negativfolie des Vaters. Alles exakt und unbedingt gegenteilig machen zu wollen und damit in eine neue fatale Abhängigkeit zu geraten. Und dann sich langsam freizureden, freizuschreiben, freizuarbeiten. Mit der Gründung einer radikal anderen Zeitung. Mit ihrer täglichen Arbeit. Und damit erzählt Scheub auch die Geschichte ihrer Generation, der Täterkinder. "Jetzt, da die meisten Täter tot sind, fällt der Tabubruch leichter, Familiengeheimnisse preiszugeben."
Und am Ende steht sogar eine Art Versöhnung: "Laß ihn doch in Frieden ruhen", sagt sie zu sich. Und Günter Grass hatte schon damals am Ende seines Buches bedauert: "Jetzt zu spät, Augst das Du antragen."
VOLKER WEIDERMANN
Ute Scheub: "Das falsche Leben - Eine Vatersuche". Piper 2006, 18,90 Euro
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension
Es ist eine schreckliche Geschichte, die Ute Scheub von ihrem Vater, dem Apotheker Manfred Augst, zu erzählen hat: In jungen Jahren war er ein überzeugter Nazi, SS-Mann und Wehrmachtssoldat. Eine große Karriere war ihm nicht beschieden, vielleicht, weil er selbst den Nazis als ideologisch zu verbohrt erschien, wie Rezensentin Elke Buhr berichtet: Als "Rassenkundler" hatte er sich sogar dafür beworben, "Zuchtwart" beim Reichsernährungsministerium zu werden, ein Posten, den es gar nicht gab. Seine Entnazifizierung klappte auch nur auf dem Papier, Scheub schildert ihn als durch und durch harten, lieblosen und verstockten Mann. Als Scheub dreizehn Jahre alt war, setzt er seinem Leben mit einem Fanal ein Ende: Auf dem Stuttgarter Kirchentag 1969 grüßte er öffentlich die "Kameraden von der SS" und schluckte Zyankali. In vielen Details beschreibt Scheub ihre Erkundungen nach dem faschistischen Vater, sie reibt sich an ihm und hadert. Und manchmal ist es der Rezensentin fast schon ein wenig zu viel geworden. So genau wollte sie es nicht immer wissen. Aber wenn sich Scheub der "Kontinuität der braunen Seilschaften" widmet, dann ist Buhr wieder ganz bei der Sache.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH