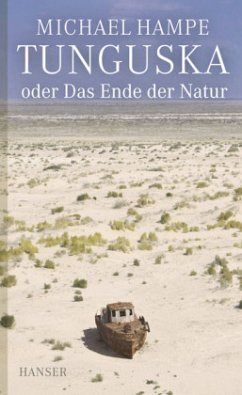Was meinen wir eigentlich, wenn wir von der Natur reden? Vier Männer - ein Physiker, ein Philosoph, ein Biologe und ein Mathematiker - verwickeln sich in ein Gespräch über das mysteriöse Tunguska-Ereignis, das in Sibirien ein riesiges Waldgebiet verwüstete. Die Frage, wie das Rätsel zu lösen sein könnte, führt in eine Grundsatzdiskussion, was die Natur überhaupt sei. Ist sie gut oder böse? Ist der Mensch ein Teil von ihr? Oder ist sie nur eine Idee in unseren Köpfen? Der Philosoph Michael Hampe inszeniert ein fiktives Gespräch über die Idee der Natur, von der wir sicher zu wissen glauben, was sie bedeutet. Ein großes Denk- und Lesevergnügen!

Vier Männer auf einem Containerschiff: Michael Hampe will den philosophischen Dialog neu beleben – was auch dringend nötig wäre
Der Dialog als Form der philosophischen Darstellung hat seine Tücken: Reden können zwar mehrere, aufschreiben wird es dennoch immer nur einer von ihnen. Wie Sokrates seine Gespräche zu führen pflegte, wissen wir nicht, denn er hinterließ keine Zeile. Das übernahm sein Schüler Platon und machte ihn zum Mundstück seiner selbst. Nach dem einleitenden Geplänkel lässt er seinen Meister das Wort fast ganz an sich reißen, während die anderen sich mit Einzeilern begnügen müssen: „Aber gewiss doch, o Sokrates“, „Wie auch nicht, o Sokrates“. Es ist schwierig, der Figur des anderen in der Schriftform wahres Leben einzuhauchen, speziell in jener lebendigsten widerborstigen Gestalt, die im Alltag ständig vorkommt und im philosophischen Dialog so gut wie nie: als dem Gegenüber, das seine Autonomie wahrt, indem es sich weigert, auf das Gesagte tatsächlich einzugehen. Philosophische Dialogiker reden erstaunlicherweise nie aneinander vorbei.
Der Züricher Philosophie-Professor Michael Hampe nimmt sich sein Muster denn auch nicht am platonischen Sokrates, sondern an den Totengesprächen Lukians, eines ziemlich spöttischen Griechen aus dem zweiten Jahrhundert nach Christus. Die vier Gesprächspartner seines Buchs wissen gar nicht recht, was sie zusammengebracht hat, auf diesem Containerschiff, das durch eine Art lichtes Nichts schippert, über ein Meer voll leuchtenden Nebels. Eine Atombombenexplosion scheint stattgefunden zu haben; sie wundern sich, dass sie noch existieren, und reiben sich sozusagen das Leben aus den Augen, um ihre hadeshafte neue Existenzform zu begreifen.
Auch so, im Nirwana des Voraussetzungslosen, entrinnt der Autor nicht den Fährnissen der Gattung. Lauter Spezialisten finden sich an: Tscherenkow, russischer Physiker und Nobelpreisträger, Vertreter eines Extrem-Positivismus; Blackfoot, Primatenforscher; Bordmann, Mathematiker; und Feierabent, Philosoph. Bordmann und Blackfoot werden als meinende Subjekte gar nicht recht deutlich, Tscherenkow muss dem offenkundigen Irrtum Ausdruck und Gestalt verleihen. Wer ganz einfach recht hat, wie es scheint, ist Paul Feierabent (nur durch zwei Buchstaben und im Klang überhaupt nicht getrennt vom Philosophen Paul Feyerabend). Sobald dieser seinen Standpunkt darlegt, darf zwar Tscherenkow ein mephistophelisches „So, so“ oder ein aufbrausendes „Alles Gefasel!“ einwerfen; aber ein echtes dramaturgisches Geschehen, bei dem jeder in dem, was er zu sagen hat, kenntlich bliebe und darum auf seine Weise recht behielte, kriegt Hampe nur schwer hin.
Und als ob dieses Ungleichgewicht noch nicht ausreicht, bettet der Autor seinen vierfach zerteilten Dialog in einen essayistischen Rahmen. Strukturiert wird das Ganze durch Ausführungen zu den vier Elementen Wasser, Erde, Feuer, Luft, daran schließen sich ein Kapitel „Quinta Essentia“, ein ausführlicher „Naturphilosophischer Versuch“ und ein Nachwort. Auch den Dialogen werden Zwischentitel angesonnen. So treten Gesprächspartner an, die, noch ehe sie den Mund auftun, an Händen und Füßen gefesselt sind. Das ist nicht nur unfair, es stört massiv die Ökonomie des Buchs. Was immer die Beteiligten zu sagen haben, es wird ausgehebelt durch die abschließende Stellungnahme, und man müsste, um den Gehalt des Buchs zu erschließen, nicht die schweifenden 220 Seiten lesen, sondern bloß die achtzig, wo Tacheles geredet wird. Welchen Wert besitzt ein seitenlanger Disput, wenn der Autor hinterher beiläufig anmerkt: „In diesem Streit, in dem mir so ziemlich alles falsch vorkommt (. . . )“ Mir. Diese undialektische Instanz weist sich nicht weiter aus, besitzt aber unumschränkte Vollmacht. Das sollte der Leser sich nicht gefallen lassen.
Dieser Einwand gegen die Form ist erforderlich, bevor man den Inhalt ins Auge fassen kann. Es geht um „Das Ende der Natur“, wie der Untertitel rätselhaft verkündet. Tscherenkow erzählt den Augenzeugenbericht seines Großonkels nach, der, wenngleich aus großer Entfernung, jenes Ereignis miterlebt hat, das im Jahr 1908 nahe dem sibirischen Fluss Tunguska zur Vernichtung mehrerer tausend Quadratkilometer Wald geführt hat. Was war passiert? Die naturwissenschaftliche Erklärung, hier habe ein Meteor oder Komet eingeschlagen, scheint sich aufzudrängen. Doch fand sich dafür keinerlei Evidenz vor Ort, weshalb sie genauso viel für sich hatte wie andere auch, etwa eine Landung der Aliens oder dass dem genialen Nikola Tesla ein Großexperiment misslungen sein könnte.
Was aber hat es mit einer Natur auf sich, die Raum für solche Singularitäten besitzt? Sind ihr Kern wirklich Gesetze und kleinste Teilchen, die nach diesen Gesetzen interagieren? Interaktion greift stets in kleinere Dimensionen hinunter als das, wozwischen sie statthat; und so stürzt die moderne Naturwissenschaft immer weiter in den Abgrund des bodenlos Kleinen. Die String-Theorie dürfte da nicht das letzte Wort bleiben.
Und darf man von der Natur sagen, sie habe ihre Geschichte? Geschichte gibt es nur, wo eins aus dem anderen entspringt und die Dinge sich notwendig und wesenhaft verwandeln. Unsinn, sagt der Positivist, bei allen Vorgängen handle es sich um Fluktuationen eines bedeutungslos variierenden Grundbestands. Aber gerade der Positivist muss den Urknall postulieren, der die komplette Historisierung eines sich seither stetig entfaltenden Universums impliziert. Vielleicht sind auch die scheinbar gesetzesmäßig bedingten und sich wiederholenden Vorgänge in Wahrheit Singularitäten, und wir steigen nur nicht weit genug in ihre Feinstruktur hinab, um zu erkennen, dass sprunghaft und unvermittelt Ding nach Ding kommt – ähnlich wie ein Spielfilm nur scheinbar eine runde gleitende Bewegung wiedergibt, in Wirklichkeit aber eine überaus rasche Abfolge starrer Frames darstellt. Oder besagt die Quantentheorie etwas anderes? Dennoch gibt es diesen Film als Film, und wer ihn bloß in seine Frames zerlegt, der ist nicht etwa zu dessen tiefster Wahrheit vorgedrungen, sondern hat ihn in jeder wichtigen Hinsicht verpasst.
Die Bedeutung dieses Buchs besteht darin, dass es solche Überlegungen aus der Physik auf den Bereich der Ethik überträgt und damit das rückgängig zu machen versucht, was Hampe als die unselige sokratische Spaltung ansieht. Sokrates hatte sich von den Vorsokratikern (die es erst durch ihn wurden) abgewandt und erklärt, ihn interessiere nicht die Natur, denn Hügel und Bäume hätten ihn nichts zu lehren, wohl aber die Verfassung der athenischen Bürgerschaft. Von nun an, so Hampe bzw. sein Alter Ego Feierabent, seien Naturwissenschaft und Ethik, natürlicher und politisch-sozialer Mensch auseinandergerissen gewesen, verteilt auf zwei Disziplinen, die sich nicht einmal zum Streit zusammenfanden.
Das Buch arbeitet sich daran ab, die Einsicht vom diskontinuierlichen Verhältnis des kosmisch Kleinen zum kosmisch Großen weiterzuführen in den Bezirk des Sozialen, wo vor allem dem Gestus des „Wir alle als Einzelne“ zu Leibe gerückt wird. So etwa hat der Einzelne, der Fleisch essen will, anders als eine überzogene Verantwortungsethik es will, keineswegs direkt für die Schlachthöfe einzustehen; und er wird durch den persönlichen Verzicht auf den Fleischgenuss deren Praxis nicht beeinflussen.
Unter normalen Umständen wird, wie es nicht ohne Ironie heißt, der einzelne Kiesel, der es anders will, nicht den Gang des Erdrutschs abändern. Es muss die Balance der Kräfte zuvor eine insgeheim labile geworden sein, damit das Einzelne darin hervortreten und etwas ausrichten kann. Dies möchte man auch dem Buch wünschen. Es ist ein herausragender Wegweiser für etwas, das es selbst mitnichten einlöst. Darin, was ihm missglückt oder minder glückt, macht es fühlbar, was überhaupt fehlt. Philosophie ist einmal, wie sich heute noch in dem dunkel gewordenen Begriff der Philosophischen Fakultät andeutet, die Lehre von schlechthin allem gewesen, was über das Fachidiotentum hinausging und Menschen zu interessieren vermochte, weil es sie als Menschen betraf. Insbesondere gehörten ihnen noch lang die naturwissenschaftlichen Sparten an, die sich seither in stolzer Verbohrtheit davon abgeschnitten haben. Und schließlich wurden auch die Philosophen, aus deren Haus sich Fach um Fach verabschiedet hatte, selbst zu Fachidioten wie Zahnmediziner oder Scheidungsjuristen.
Hampe strebt danach, die Philosophie wieder zur Königin der Wissenschaften zu machen, die dem Menschen dadurch, dass sie ihm sagt, was er ist und wo er sich befindet, den Sinn dafür öffnet, was er zu tun hat. Wie das geschehen könnte, das weiß Hampe auch nicht so genau, da tastet er herum und begeht Fehlgriffe. Aber er macht deutlich, was mangelt: eine präzise, verbindliche Ganzheitlichkeit des Denkens – während es heute scheint, als könne man nur entweder ganzheitlich oder aber präzise sein.
Hampe hat recht: Man muss den Dialog suchen. Diese Redensart bezeichnet heute meist einen Punkt, wo alle es sich gemütlich machen, als ob der Dialog als gesuchter zugleich auch schon der gefundene wäre. Hampe hat ihn höchstens teilweise gefunden; doch damit ein Defizit demonstriert. Man sagt über den Dialog nicht das Schlechteste, wenn man festhält, dass er eine fahrlässige Gattung sei, die ihre Sternminuten hat; um derentwillen sollte man bereit sein, einiges an Schlamperei in Kauf zu nehmen.
Ein Beispiel für eine Sternminute?
„Bordmann: Aber das menschliche Leben ist auch für den Rest der Natur ungesund.
Tscherenkow: So wie das Leben der Robben und Pinguine für die Heringe ungesund ist.
Bordmann: Nochmals: Wir sind keine Mammuts. Keine Robben und Pinguine, wir sind m e h r, wir können uns steuern und entscheiden.
Tscherenkow: In welchem Sinn sind wir deshalb ‚mehr‘?“
Gute Frage!
BURKHARD MÜLLER
MICHAEL HAMPE: Tunguska oder das Ende der Natur. Hanser Verlag, München 2011. 306 Seiten, 19,90 Euro.
Was aber geschah 1908
in der Nähe des sibirischen
Flusses Tunguska?
Die Philosophie soll
wieder zur Königin der
Wissenschaften werden
Waldschäden in Folge der Tunguska-Explosion Foto: Scherl
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de

Von heiklen Grenzen, bewegter Rede und verwandelten Bildern
Ein bekannter Primatologe und Professor für evolutionäre Anthropologie hat unlängst mit Nachdruck dafür plädiert, die Entgegensetzung von Kultur und Natur endlich aufzugeben. Diese Dichotomie möge zwar heuristisch nützlich sein, aber bei genauerer Betrachtung falle sie in sich zusammen. Zum einen nämlich seien Kategorien wie Natur und Kultur lediglich gesellschaftliche Konstrukte. Zum anderen würden die Diskurse, die diese Dichotomie stabilisieren, letztlich ja auch von und in Gehirnen erschaffen, die selbst evolutionär gewordene Organe und damit also Naturprodukte sind.
Als Argument wird man das nicht ansehen wollen. Lediglich als Beleg dafür, dass eine naturalistische Grundüberzeugung herauskommt, wenn man schlicht von ihr ausgeht. Dieser symptomatische Kurzschluss berührt allerdings nicht die durchaus triftige Einsicht, dass Grenzziehungen zwischen Natur und Kultur problematisch geworden sind. Bloß ist das Verfahren, einer der beiden Sphären, die lange so reinlich voneinander abtrennbar schienen, nunmehr das ganze Feld zu überlassen - die Natur hat dabei die Oberhand -, kaum ein Weg, die dahinterstehenden Entwicklungen wirklich in den Blick zu bekommen.
Besser schon, man hält sich an Neuerscheinungen in diesem Herbst. Der an der ETH in Zürich lehrende Philosoph Michael Hampe hat mit "Tunguska oder Das Ende der Natur" (Carl Hanser Verlag) ein Buch vorgelegt, das direkt auf unsere Verlegenheiten zusteuert, wenn "die Natur" auf den Plan tritt. Sei es, wenn wir versuchen, uns selbst als Kompositum natürlicher und kultureller Anteile zu bestimmen; oder sei es im Bezug auf äußere Natur als Inbegriff der unabhängig von uns und unseren Interventionen gegebenen Dinge und Phänomene.
Dass beides nicht überzeugend gelingen will, hängt natürlich eng damit zusammen, dass wir unsere eigene Naturgeschichte mittlerweile immer deutlicher vor Augen bekommen und unsere Verfügungsmöglichkeiten über "die Natur" weiter wachsen. Gleichzeitig zeigt uns die neuere Wissenschaftsforschung ganz konkret, wie viele künstliche, also kulturell geformte Verrichtungen es braucht, um die natürlichen Phänomene zu erzeugen, an deren Regularität sich anknüpfen lässt. Wir sind demnach immer schon und auch dort im Spiel, wo wir eigentlich gar nichts zu suchen haben sollten, wenn "die Natur" das schlichtweg andere unserer kulturell-sozialen Welt wäre.
Vor diesem Hintergrund stehen Hampes Überlegungen, was unter "natürlich", "der Natur" und ihren "Gesetzen" zu verstehen sein sollte. Sie sind Lockerungsübungen, um von der Vorstellung einer von sich aus auf genau gebahnten Wegen ablaufenden Natur loszukommen und damit die Auffassung von natürlichen Phänomenen als inhärent gesetzmäßigen auf Abstand zu bringen. Es geht in Richtung eines Verständnisses von Natur als Verkettung von, genaugenommen, unwiederholbaren Einzelereignissen, die eine durch und durch partikulare und historische Wirklichkeit aufspannen.
Kein kleines Unterfangen also, aber vor allem auch eines, bei dem sich der Autor abseits von akademischen Gepflogenheiten der Darstellung hält. In einer Anknüpfung an die Tradition des Totengesprächs bekommt es der Leser hier mit vier Stimmen zu tun, die sich in Debatten verstricken und dabei markante Positionen ohne alle abschreckende Philosophenterminologie ins Spiel bringen.
Magistraler zwar, doch trotzdem elegant widmet sich Philippe Descola in "Jenseits von Natur und Kultur" (Suhrkamp Verlag) unserem eingefahrenen Naturbegriff. Der Inhaber eines Lehrstuhls für die "Ethnologie der Natur" am Collège de France geht es dabei vor allem um die basale Grenzziehung, mit der "die Natur" vom kulturell geformten Reich der sozialen Beziehungen, in dem wir uns bewegen, abgetrennt wird. Natur ist dann, wohin diese sozialen Relationen nicht reichen, weil in ihr die Voraussetzungen für sie gänzlich fehlen: Geist, Subjektivität, Formen des Bewusstseins und der Intentionalität. Sie mag lebendig sein, ist es in den Pflanzen und Tieren offenkundig. Aber das ändert nichts daran, dass diese Formen des Lebens grundsätzlich auf der anderen Seite der großen Auftrennung in Kultur und Natur zu stehen kommen - und also unter unseren Anspruch auf den Gebrauch der essentiell nichtmenschlicher Natur fallen.
Descola weiß natürlich, dass diese geläufige Auftrennung an bestimmten Stellen attackiert wird, vor allem mit Blick auf Tiere. Man denke nur an die regen Debatten darüber, ob und welche Kultur unseren nächsten Verwandten unter den Primaten zuzusprechen ist. Aber als Ethnologe - und Schüler von Claude Levi-Strauss - geht er einen anderen Weg. Sein Anspruch ist, die Abtrennung einer natürlichen, unseren menschlichen Verhältnissen inkompatiblen Sphäre als nur eine unter mehreren Möglichkeiten vor Augen zu führen, wie Gesellschaften sich die Welt zurechtlegen.
Das mag ein wenig abgehoben klingen, führt aber mitten hinein in einen überaus anregenden ethnologischen Parcours rund um die Erde - und in eine Fülle von Erzählungen, in denen Menschen vorkommen und Tiere, Pflanzen und Dinge, aber nicht unsere Grenzziehung zwischen ihnen. Zumindest nicht in der uns vertrauten Form. Da steht die Natur unter der Obhut kultivierender Geister, sind Tiere ebenso sozial organisiert wie die Menschen, haben auch Pflanzen an Personen gemahnende innere Eigenschaften. Wobei diese Beispiele allesamt für die von Descola "animistisch" genannte Konzeption der Welt stehen.
Sie erweist sich für ihn als eine von vier grundlegenden Weisen, wie Gesellschaften die Beziehungen zwischen menschlichem und nichtmenschlichem Bereich organisieren. Und Descolas Pointe ist, dass die für unsere westliche Welt bestimmende "naturalistische" Variante, gemessen an der Zahl von bestehenden Gesellschaften, der seltene Sonderfall ist.
Es liegt nicht auf der Hand, was aus einer solchen Diagnose zu machen ist. Aber wenn auch der ethnologisch entzauberten Notwendigkeit einer bestimmten kulturellen Organisation kein neu eröffneter Spielraum gesellschaftlicher Möglichkeiten entspricht - eine geschärfte Aufmerksamkeit für die auch auf naturalistischem Terrain anzutreffenden Spuren der anderen Varianten kann sie doch bewirken.
So zurückhaltend agiert Hans-Peter Dürr in seinem neuen Buch "Das Lebende lebendiger werden lassen" (Oekom Verlag) gerade nicht. Auch er nimmt die naturalistische Grenzziehung ins Visier, doch gleich mit einer kulturkritisch geläufigeren Vokabel, indem er auf einen falschen Materialismus zielt. Jenen nämlich, den er mit der Vorstellung verknüpft sieht, von der auch Hampe uns auf ganz grundsätzliche Weise entwöhnen möchte: von einer determinierten, maschinenhaft ablaufenden Natur.
Was der Physiker Dürr dagegen aufbietet, ist eine Erinnerung an die Quantentheorie: an ihren irreduziblen Wahrscheinlichkeitcharakter und den Abschied vom Konzept letzter Bausteine der Wirklichkeit, die sich immer noch wie kleine Stückchen von Materie verhielten. Statt dessen gelte es einzusehen, dass auf der untersten Ebene nur Form, Gestalt und Symmetrien anzutreffen sind. Und mit einem entschiedenen Schritt wird daraus die Versicherung, dass also im Grunde und überall etwas Geistiges webt, die Materie dagegen, recht betrachtet, nur als Schlacke anfällt in einer Welt, die sich in jedem Augenblick neu und im Horizont einer offenen Zukunft ereignet. Ein Anklang an religiös bewegte Rede - samt gnostischem Seitenhieb auf die schale Materie - wird einem dabei nicht entgehen.
Der Soziologe auf dem Feld der Wissenschaften Bruno Latour, an dessen Diagnose einer beständig an Hybridisierungen von Kultur und Natur arbeitenden Moderne sowohl Hampe als auch Descola anknüpfen, widmet sich in seinem Buch "Jubilieren" (Suhrkamp Verlag) gleich der Vollform solcher Rede. Oder vielmehr seiner Verlegenheit, zu ihr zu finden. Im Zentrum steht bei ihm die eher elementare Einsicht, dass religiöses Sprechen als eines, das gar keine direkte Referenz auf Dinge in der Welt hat, nicht aufgerechnet werden kann mit Diskursen, die ohne solche Referenzen leer liefen - also insbesondere jenen der Wissenschaften, die freilich auch nicht so einfach mit den Dingen verknüpft sind wie gern angenommen.
Von theologischer Programmatik, die sehr direkt mit weltlichen, nämlich mit römisch-kirchlichen Dingen verknüpft ist, handelt dafür der Kunsthistoriker Willibald Sauerländer. Er widmet sich einem Maler, der einem dabei wohl gar nicht gleich in den Sinn kommt, obwohl die Zahl seiner für Kirchen geschaffenen Werke groß ist. Sauerländer insistiert darauf, diesen "katholischen Rubens" (C. H. Beck Verlag) in den Blick zu nehmen: den europäischen Malerstar mit florierender Werkstatt, der in Zeiten der Religionskonflikte so grandios wie kaum ein anderer gegenreformatorische Bildprogramme verwirklichte.
Wohl ist Sauerländer nicht, wenn er Rubens der triumphierenden Kirche beispringen sieht. Und diese Reserve des Autors, der sich dem Leser als Agnostiker protestantischer Herkunft vorstellt, bekommt der Darstellung ausgezeichnet, zollt sie doch ihrerseits noch Rubens' ungeheurer malerischer Überzeugungskraft Tribut. Zu ihren Verfahren zählt nicht zuletzt, antike Vorlagen ins Christliche hinüberzuspielen (und manchmal auch wieder zurück).
In solche Spiele im Umgang mit Vorlagen führt auch das Buch eines anderen Kunsthistorikers ganz wunderbar hinein. Werner Busch widmet sich in "Great wits jump" (Wilhelm Fink Verlag) dem Umgang von Laurence Sterne mit Werken der bildenden Kunst. Nicht nur sind die Funde beachtlich, die Busch im "Tristram Shandy" macht. Es ist auch äußerst vergnüglich, ihm auf verzweigten Wegen durch all die Übernahmen, Abwandlungen und gewitzten Bedeutungsverschiebungen zu folgen, die Texte und Bilder verknüpfen.
Bestimmte Gaben der Natur, die mit der Anziehung der Geschlechter eng zusammenhängen, sind bei Sterne bekanntlich immer mit im Spiel. Eine moderne, wenn auch etwas wackelige Behandlung einiger solcher Gaben lässt sich im Buch der Soziologin Catherine Hakim über das "Erotische Kapital" (Campus Verlag) nachlesen. Und wer auf diesem Terrain Kultur von Natur scheiden möchte, der sollte ohnehin schnell eines Besseren belehrt werden können.
HELMUT MAYER
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
So mag Martin Seel den philosophischen Disput gern: Höflich, aber leidenschaftlich. Um die Frage zu klären, was Natur und was Kultur ist, lässt Michael Hampe vier Forscher miteinander in den Wettstreit treten, um den mysteriösen Asteroiden-Einschlag von Tunguska im Jahr 1908 zu klären. Angelehnt an reale Denker wie den Biologen Adolf Portmann, den Philosophen Paul Feyerabend und den Mathematiker North Whitehead streiten Hampes Figuren um die Frage, ob die Natur unwandelbares Gesetz sei, reiner Zufall oder gar nicht existent, weil es nur ihre einzelnen Momente gibt. Deutlich erkennt Rezensent Seel aber, dass Hampe kein neutraler Schiedsrichter in diesem Match ist, seine Sympathien liegen deutlich bei Feyerabend, so dass sich für Seel als These deutlich herauskristallisiert, dass die Natur keine Natur hat und deshalb auch nicht so eindeutig von der Kultur zu trennen ist.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH