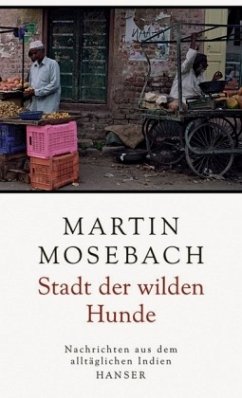Büchner-Preisträger Martin Mosebach auf der Reise in Indien: Das überraschende Porträt eines Landes und seiner Menschen, das zeigt, was die Erfahrung der Fremde für das eigene Leben bedeuten kann. Mosebach berichtet von seinen Eindrücken und Begegnungen aus einer Provinzhauptstadt im Bundesstaat Rajasthan: von dem Sandsturm in der Wüste und dem Rattentempel in Deshnok, vom Gott der wilden Hunde und dem Heiligen des Shivatempels, von den Kasten und der Konfrontation mit dem uralten Königtum, aber auch von der Einladung zum Essen bei einer indischen Familie, von den Frauen und Töchtern, die das Leben im Haus bestimmen. Nur wenige deutsche Schriftsteller der jüngsten Zeit haben sich so tief eingelassen auf die verstörende Erfahrung einer ganz und gar anderen Tradition.

Der Büchnerpreisträger im Land der heiligen Kühe: Martin Mosebach nimmt in seinem Erfahrungsbericht aus Indien keine Rücksicht auf Empfindlichkeiten und schildert ungebremst die Wucht merkwürdiger Erlebnisse.
Von Pia Reinacher
In diesem Buch blättert man wie ein einem Fotoalbum. Ein Schnappschuss reiht sich an den nächsten; staunend und verwirrt, überwältigt und abgestoßen blickt man auf das Panorama einer verblüffenden Welt. Ratten wieseln durch die Häuser. Kakerlaken mit beweglichen Fühlern und harten, braunen Flügeln steigen aus dem Abflussrohr ins schwarze Porzellanbecken. Im Sand der Straße beobachtet der Reisende eine trächtige Hündin, die in ihrer Erschöpfung die geschwollene Zitzenreihe geradezu schamlos ausstellt.
Wir sind in Indien und blicken mit den auf westliche Wahrnehmung konditionierten Augen des Erzählers auf unvertraute Verhältnisse. Büchnerpreisträger Martin Mosebach legt einen Reisebericht aus Bikaner vor, einer Stadt im Bundesstadt Rajasthan im Nordwesten Indiens, der den Leser mitreißt und verstört: "Stadt der wilden Hunde. Nachrichten aus dem alltäglichen Indien". Spätestens bei der Beschreibung der Zeremonie zu Ehren des Geburtstages von Amindab Bachan, einer der berühmtesten Persönlichkeiten Indiens nach Ghandi, eines Filmschauspielers, dessen Ruhm ihn bis zur Einheirat in den Nehru-Ghandi-Clan, der indischen Königsfamilie, geführt hatte, begreifen wir die tiefschürfenden Unterschiede der Kulturen. Was im Westen als Fauxpas gelten würde, gebietet hier der Respekt: Etwas abseits auf einem Tisch ist der Amindab-Bachan-Geburtstagskuchen vorbereitet, eine Torte aus hartweißer, hellgrüner, hellgelber und rosafarbener Sahne. Nach ausschweifenden Huldigungen und Grußadressen schneiden sie der Erzähler und dessen Gastgeberin an. Blitzlicht flackert, die Gäste drängen ungehemmt zur aufgebahrten Süßigkeit. Ihre feinen, langen Finger fahren in die Sahne und greifen sich Bröckchen heraus.
Das ist nur die erste Prüfung, der sich der westliche Besucher zu unterziehen hat. Das Ritual sieht eine entscheidende Steigerung der Ehrerbietung vor. Hinter dem Gast ist ein großes Plakat des lächelnden Stars aufgespannt. Der Schriftsteller wird aufgefordert, dem berühmten Mann ein Stückchen Sahne in den Spitzbart zu schmieren. Der Jubel ist grenzenlos, als dieser - auf die Zähne beißend und den Ekel hinunterwürgend - dem Idol die Ehrerbietung zukommen lässt.
Man hat Martin Mosebach gerne eine im Gegenständlichen verhaftete Schreibweise, eine geradezu akribische Beschreibungswut, eine übersteigerte Detailsucht vorgeworfen. Schreiben war für diesen Schriftsteller vor allem anderen immer auch Handwerk. "Ich wollte das Erzählen lernen, wie man das Schuhmachen lernt", sagte er bei der Verleihung des Kleist-Preises 2002. Dieser Zugriff setzt präzise Sachkenntnisse voraus, die mit der sinnlichen Wahrnehmung verschmelzen.
Die unambitionierte Methode erweist sich gerade in dieser Betrachtung eines unbekannten Universums als äußerst fruchtbar. Scheinbar schwerelos gleitet der Blick des westlichen Beobachters über die östlichen Kulissen, wissbegierig saugt er die exotischen Bilder auf, vorurteilslos lässt er die inkommensurablen Erfahrungen auf sich einstürzen. Nicht die geringste Anstrengung unternimmt er, um aus Rücksicht auf den unvorbereiteten Leser scheinbar anstößige Einblicke zu korrigieren oder die Wucht merkwürdiger Erlebnisse abzubremsen. Er sichtet nur, kommentarlos und unbestechlich. Seine Beschreibungen sind rückhaltlos, das Detail quälend vergrößernd.
Auf diesem Feld liegt denn auch der enorme Vorzug von Mosebachs Erzählstrategie. Die Traumbilder und Realitätsausschnitte, die Visionen und Wahrnehmungsversatzstücke prallen mit ungebremster Kraft auf den Leser und lösen in ihm selbst ein Echo aus. Das ist die Mosebach eigene Methode, um aus scheinbar zufälligen Oberflächenphänomenen die Essenz zu destillieren. Auf diesem Weg werden alltägliche Phänomene zum Sprechen gebracht. Ob er das hennarote Färben von Männerhaaren ins Auge fasst oder das Ritual eines nächtlichen Picknicks rapportiert, das zu den schönsten Talenten der Bikaner gehört, wobei auf dem Sportplatz bei gleißendem Mondlicht ein geisterhafter Salon eingerichtet wird; ob er das Korsett der Kasten beschreibt, die zwar von den Intellektuellen in Delhi ignoriert werden, aber trotzdem das Leben wie ein Naturgesetz ordnen und die vertikale Herrschaftsausübung zementieren - immer verhilft Mosebachs Bericht zu Erkenntnisgewinn.
Am virtuosesten sind seine Journale dann, wenn er Feldforschung auf dem Gebiet des Banalen betreibt. Harmlos wie eine Reportage setzt etwa seine Geschichte über den "stinkenden Gürtel" ein, die den Versuch des westlichen Besuchers schildert, in Indien, dem Land der ungebrochenen Handwerkertradition, einen Sattler zu finden, der ihm einen neuen Gürtel unter Verwendung der alten Schnalle machen würde. Erst allmählich dämmert es dem unbedarften, vom europäischen Konsumrausch verwöhnten Besucher, auf welch heikles Gelände er sich mit diesem Wunsch begibt. Nach Rindsleder darf im Reich der heiligen Kuh kein Mensch fragen. Und wenn es überhaupt vorrätig wäre, dürfte es nicht beim Namen genannt werden. Hartnäckig und taub gegenüber allen Verlegenheitssignalen, setzt der Schriftsteller unaufhörlich neu an, um zu seinem Gürtel zu kommen. Einmal fabriziert man ein Objekt aus Autoreifen, ein andermal aus stinkendem Kamelleder. Den Wunsch einfach abzuschlagen, verbietet das Gesetz der Gastfreundschaft; ihn zu erfüllen, bedeutete den Bruch mit einem heiligen Gebot. Immer tiefer verstrickt sich der begriffsstutzige Reisende im Gestrüpp der kulturellen Gegensätze, immer brüsker prallt er auf die Mauer der religiösen Vorschriften, immer peinlicher stürzt er aus purer Ignoranz seine Gastgeber in die Falle des unlösbaren Widerspruchs.
In diesen Passagen wird der Leser zum Augenzeugen der Konfrontation gegensätzlicher kultureller Erfahrungen. Ein Erkenntnisgewinn über das unangemessene Selbstverständnis des Forschers, das an der andersartigen kulturellen Identität aufläuft, fällt ihm dabei ohne weitere Anstrengung zu.
- Martin Mosebach: "Stadt der wilden
Hunde". Nachrichten aus dem alltäglichen
Indien. Hanser Verlag, München 2008. 176 S.,
geb., 16, 90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Wo Flinksein keine Tugend ist: Martin Mosebachs „Stadt der wilden Hunde” berichtet von der Seinsfülle Indiens
„Nachrichten aus dem alltäglichen Indien” ist Martin Mosebachs neues Buch untertitelt, aber wovon er hier berichtet, das hat mit dem, was man üblicherweise den Nachrichten entnimmt, nichts zu tun. Das alltägliche Indien Mosebachs ist eines ohne Computerexperten, Callcenter-Agenten, neuen Reichtum und altes Elend. Es ist Provinz im Nordwesten, Teil Rajasthans, zur Grenze nach Afghanistan in wüstenhafter Umgebung gelegen: Bikaner. Der Erzähler ist Gast einer wohlsituierten Familie. Sudhir, der Gastgeber, als Repräsentant eines amerikanischen Chemieunternehmens über Jahre sehr erfolgreich, hat sich aus dem Geschäftsleben zurückgezogen; seine Frau Kitty leitet ein örtliches Gymnasium. Das Haus ist groß, Dienerschaft selbstverständlich. Man lebt zusammen, das heißt: in Gemeinschaft. Auch in sehr großen Häusern gibt es nur eine Küche mit einer Feuerstelle. Dass jede Kleinfamilie einen eigenen Haushalt führe, das ist nicht vorgesehen. Jeder hat seinen Platz und weiß, was ihm zukommt.
Gemessene Würde
Das Leben ist nicht ereignislos, aber ruhig. Verändert wird so leicht nichts. Die Vielzahl alter Wassertanks gibt Brutstätten für allerlei Insekten ab, auch für jene Stechfliegen, die Dengue-Fieber und Schlafkrankheit übertragen. „Jeder wusste das, die Zeitungen schreiben täglich darüber, man plauderte lächelnd über die Mücken und ihre Gefahren, und man dachte vor allem nicht daran, die Wassertanks endlich zu leeren.” Der Leser begreift, wie sehr die Maxime „Gefahr erkannt – Gefahr gebannt” eine westliche ist: Alles Wissen drängt zur Praxis. Damit hat es in Indien keine Eile. Das gibt dem Leben eine eigene Würde. Flink zu sein ist eine Dienertugend, der Diener darf nicht auffallen. Herren und Damen bewegen sich gemessen, das ist Ausdruck ihrer Person.
Es ist eine Welt, in der ein jeder eine Rolle spielt. Die romantische Liebe, das Ereignis, das uns mehr als jedes andere Gelegenheit schafft, aus der Rollenhaftigkeit herauszutreten und ganz einzigartig zu sein, diese Art der Liebe und namentlich die Liebesheirat gilt als Verirrung. Und doch hat jeder und jedes seine eine scharf geprägte Anschaulichkeit. Es ist ein Leben und Denken jenseits der Abstraktionen. Was der europäische Besucher aus der indologischen Literatur weiß, stößt bei seinem Gastgeber beständig auf Unbehagen: „Ganz richtig ist es nicht, sie sagen es zu einfach.”
Bikaner ist eine karge Landschaft. Aber es gibt eine Fülle des Lebendigen. Der Rattentempel von Deshnok: „Endlich einmal hatte ich ein Heiligtum mit jenem Schauder und jener Beklommenheit betreten, die einem solchen Besuch angemessen sind”, sagt sich der Berichterstatter. Die Ratten in ihrer wimmelnden, unerschöpflichen, unbesiegbaren Masse geben ein Bild von der gefährlichen Üppigkeit des Lebens: das „geahnte, gefürchtete Lebendigwerden der Welt”. Der „Herr der Ratten und Mäuse” ist in Europa der Teufel, fällt Mosebach ein. Das ist der jüdisch-christliche Verdacht gegen die Welt von Fruchtbarkeit und Reichtum.
Die Fülle Indiens wird gebändigt durch die Beständigkeit und die Strenge der sozialen Erwartungen. Die Menschen bewähren sich in ihren Rollen, das gibt ihnen ihre Haltung. Mosebach beschreibt es mit großer Sympathie. Aber er macht sich keine Illusionen über die Opfer. Diese Art von Festigkeit und Würde wird bezahlt. Von einem idyllischen Verhältnis der Menschen zueinander kann die Rede nicht sein. Wer über das Übliche hinausstrebt, hat auf wenig Mitgefühl zu hoffen. Merkwürdig in einem Land, dessen Denken die Abstraktion vermeidet „und statt dessen ganz nach außen, auf die konkreten Erscheinungen der Außenwelt gerichtet” ist, auf die „möglichst lückenlose Vergegenständlichung jeder Seinsregung”. Doch so ist es. Die Herrin des Hauses, die Gastgeberin des Erzählers, „strahlt vor Güte”, wo sie in den zeremoniellen Sicherheiten präsidiert. Gegenüber dem individuellen Unglück ist sie ganz teilnahmslos. Sie und ihre Tochter wälzen sich in ihren Saris auf dem Bett wie Robben auf ihrem Felsen und lassen eine arme verlassene Ehefrau „bedrückt auf einem Stühlchen sitzen”. Deren Tochter – sie trägt schon Jeans, Sari lehnt sie ab – will in eine große Stadt ziehen, wo niemanden ihre Herkunft interessiert; ihr Trotz imponiert.
Doch mehr noch als die gesellschaftlichen Eigentümlichkeiten interessieren Mosebach die religiösen. Der Kultus ist ein großes Thema, aber völlig untheoretisch. Es werden keine theologischen Dispute geführt und auch von den gesellschaftlichen Wirkungen der Religion ist nicht die Rede. Religion ist nicht Dogma und nicht sozial verstandene Tugendhaftigkeit, sie ist eine persönliche Übung. Sudhir, des Erzählers Gastgeber, hat seine Karriere in der Chemiebranche aufgegeben, um in seiner Religion zu leben. Ein kleiner häuslicher Tempel beherbergt das Idol der Göttin Parvatis, Gemahlin Shivas. Es ist eine ausführliche Liturgie, die Sudhir täglich vollzieht, das Übergießen der Statue mit Butterfett und anderen Lebensmitteln erscheint uns archaisch. Selbst der religiös ansprechbare Europäer wird in dieser Form handfester Versorgung etwas Unverständliches sehen, auch Gottfremdes. Aber die gemessene Ruhe empfindet der Beobachter als schön, „Kunst und Leben gingen hier eine mühelose Verbindung ein”. In dem Ernst, mit dem der Liturge vorgeht, zeigt sich das Heilige.
Der Mosebach-Leser kennt das Thema aus dem großen Roman „Das Beben” (2005), der zu Teilen bereits in Indien spielte, einem Indien, das Bikaner ziemlich ähnlich sieht. Die Schilderung der heiligen Kühe wurde von allen Lesern sofort als ein Höhepunkt des Werkes begriffen. Was Achtung, ja Ehrfurcht weckt, ist nicht zu begründen; wäre es das, so stünde es im Rang unter dem Begründenden. Der Roman kam in Gang mit einer Liebesgeschichte, die männliche Hauptfigur hatte den Umbau eines alten indischen Palastes zu planen: das Erotische und die Kunst sind zwei Felder, auf denen auch der Aufgeklärte akzeptiert, dass sich etwas zeigt, etwas, das sich der Rationalität immer wieder entzieht. Das haben sie mit dem Religiösen gemein. Die Schilderung des Religiösen war in die Geschichte einer fatalen erotischen Faszination sinnvoll eingefügt.
Und doch macht der Kultus, wie Mosebach ihn beschreibt, die Menschen frei. Sie beugen sich Traditionen und Vorschriften, gewiss, aber zugleich schaffen sie selbst etwas. Das Heilige ist auch die Tat derer, die es als heilig verehren. Wie man unter beengten Verhältnissen, gesellschaftlich hoch reguliert und materiell knapp, Freiheit erwirbt, das erfährt der Indienreisende Mosebach immer wieder. Noch das Picknick auf weißen Plastikstühlen am Rande eines Sportplatzes vor der Stadt lenkt den Blick auf Weiteres. Dem Erzähler hatte ein alter Kaufmann ein mit kleinen Elefanten bedrucktes Tuch einpacken lassen: „Wenn sie das ausbreiten und sich darauf setzen, dann sind sie frei! Niemand kann sie stören!” Der Kaufmann teilte seinem Gast ein Lebensgeheimnis mit, „das ihn selbst schon gerettet hatte, es war erprobt”. Und so etwas wie dieses Elefantentuch sind auch die Bücher von Martin Mosebach. STEPHAN SPEICHER
MARTIN MOSEBACH: Stadt der wilden Hunde. Nachrichten aus dem alltäglichen Indien. Carl Hanser Verlag, München 2008. 172 Seiten, 16,90 Euro.
Die heilige Kuh, die sich jedem Fortschritt in Indien in den Weg stellt, ist das Ehrfurcht Gebietende schlechthin. Foto: Walter Vogel
Martin Mosebach Foto: dpa
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.sz-content.de
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Martin Mosebach ist nach Indien gereist. Davon, was ihm dort widerfuhr, ist nun in in diesem Band zu lesen. Nicht in Essays, nicht in Erzählungen, sondern in Form von Notat und Bericht. Darin sieht die Rezensentin Pia Reinacher die Methode des Autors: Mit großer Genauigkeit schildert er, was er sieht, was ihm passiert, auch, was er anrichtet, weil er nicht weiß, was er im Kontext der fremden Kultur eigentlich tut. Exemplarisch sichtbar wird letzteres in der Suche des Autors nach einer Gürtelschnalle, mit der er diejenigen, die er darum angeht, von einer Verlegenheit in die nächste stürzt, weil das erwünschte Rindsleder der Heiligkeit der Kühe wegen ein schlimmes Sakrileg wäre. Auch sehr ausführlich geht Reinacher auf Mosebachs Anwesenheit bei der exzessiven Geburtstagsveranstaltung zu Ehren eines Bollywoodstars ein - dass der ganz offensichtlich gemeinte Amitabh Bachchan allerdings immer nur Amindab Bachan genannt wird, lässt an der Schärfe von Mosebachs - oder Reinachers? - Aufmerksamkeit dann doch ein wenig zweifeln. Die Rezensentin aber ist von diesem Band, soviel steht fest, mehr als nur angetan.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
"Martin Mosebach, der zu den Reisenden unter den deutschen Gegenwartsschriftstellern zählt, entwirft ein Bild aus dem globalisierten Leben der Gegenwart, in dem sich außerordentliche Exotik mit außerordentlicher Vertrautheit, Nähe mit Fremde vermischt." Ursula März, Deutschlandradio Kultur, 01.04.08
"In diesem Buch blättert man wie in einem Fotoalbum. Ein Schnappschuss reiht sich an den nächsten; staunend und verwirrt, überwältigt und abgestoßen blickt man auf das Panorama einer verblüffenden Welt. ... Scheinbar schwerelos gleitet der Blick des westlichen Beobachters über die östlichen Kulissen, wissbegierig saugt er die exotischen Bilder auf, vorurteilslos lässt er die inkommensurablen Erfahrungen auf sich einstürzen." Pia Reinacher, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 24.05.08
"In diesem Buch blättert man wie in einem Fotoalbum. Ein Schnappschuss reiht sich an den nächsten; staunend und verwirrt, überwältigt und abgestoßen blickt man auf das Panorama einer verblüffenden Welt. ... Scheinbar schwerelos gleitet der Blick des westlichen Beobachters über die östlichen Kulissen, wissbegierig saugt er die exotischen Bilder auf, vorurteilslos lässt er die inkommensurablen Erfahrungen auf sich einstürzen." Pia Reinacher, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 24.05.08