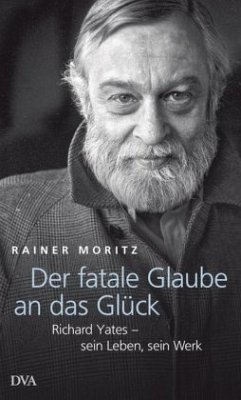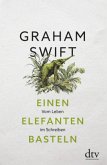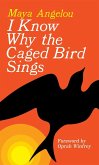Das dramatische Leben eines großen Schriftstellers
In seinen besten Jahren gefeiert, am Ende vergessen - es ist, als wäre der Schriftsteller Richard Yates eine Figur aus seinen eigenen Büchern. Das Scheitern war sein Lebensthema: Zweimal geschieden, hatte er kein enges Verhältnis zu seinen drei Töchtern; Alkoholexzesse und Kettenrauchen ruinierten ihm die Gesundheit, und auf dem Campus, an dem er bis zuletzt unterrichtete, galt er vielen Studenten als aus der Zeit gefallenes Wrack. Erst Jahre nach seinem Tod wurde der große Autor neu entdeckt: von renommierten Schriftstellerkollegen befördert und schließlich durch die Verfilmung seines Meisterwerks »Zeiten des Aufruhrs« auch einem breiten Publikum zugänglich gemacht. Heute zählt er zu den wichtigsten Gegenwartsautoren Amerikas.
Rainer Moritz, intimer Kenner des Werks, spricht uns seine ganz persönliche Einladung aus, in Yates' Geschichte einzutauchen und die Werke des Meisters wieder zu lesen. In leichtfüßigem Ton entführt er uns in das so romanhafte Leben dieses einzigartigen Schriftstellers.
In seinen besten Jahren gefeiert, am Ende vergessen - es ist, als wäre der Schriftsteller Richard Yates eine Figur aus seinen eigenen Büchern. Das Scheitern war sein Lebensthema: Zweimal geschieden, hatte er kein enges Verhältnis zu seinen drei Töchtern; Alkoholexzesse und Kettenrauchen ruinierten ihm die Gesundheit, und auf dem Campus, an dem er bis zuletzt unterrichtete, galt er vielen Studenten als aus der Zeit gefallenes Wrack. Erst Jahre nach seinem Tod wurde der große Autor neu entdeckt: von renommierten Schriftstellerkollegen befördert und schließlich durch die Verfilmung seines Meisterwerks »Zeiten des Aufruhrs« auch einem breiten Publikum zugänglich gemacht. Heute zählt er zu den wichtigsten Gegenwartsautoren Amerikas.
Rainer Moritz, intimer Kenner des Werks, spricht uns seine ganz persönliche Einladung aus, in Yates' Geschichte einzutauchen und die Werke des Meisters wieder zu lesen. In leichtfüßigem Ton entführt er uns in das so romanhafte Leben dieses einzigartigen Schriftstellers.

Man könnte denken, "Eine gute Schule" von Richard Yates sei ein Erinnerungsbuch. Es ist aber ein Roman, sogar einer mit ein wenig Hoffnung am Ende.
Von Verena Lueken
Die Eltern sind geschieden. Der Vater hatte den Traum, mit seiner schönen Stimme nach dem Gesangsstudium sein Geld zu verdienen, schon lange drangegeben und verkauft Glühbirnen, um die Familie zu versorgen. Die Mutter hingegen hat ihren Traum vom Leben als Künstlerin nie aufgegeben. Sie dilettiert als Bildhauerin, und die Boheme ist ihr Ideal, was in ihrem kleinen Leben heißt: Trunksucht und Chaos und garantierter Zusammenbruch in jeder Krise.
Eines Tages erfährt sie von einer Privatschule, die genau die richtige für ihren fünfzehnjährigen Sohn zu sein verspricht: ein Internat auf dem Land, gegründet und errichtet von einer reichen Architektin mit krausen Ideen, eine Schule für Jungs, die es anderswo schwer hatten, und eine Schule, in der weniger die Bildung als die Individualität im Mittelpunkt steht. Dass es eine Schule ist, die ihrerseits am Rand des finanziellen Ruins wirtschaftet, hätte sie ahnen können, denn der Direktor kam sogar ins Haus, um sein Institut vorzustellen. Doch niemand schöpft Verdacht. Der Vater, mit dem schlechten Gewissen des Geschiedenen, kann nicht anders, als sich einverstanden zu erklären, obwohl das Schulgeld weit über seinen Verhältnissen liegt. Er wird sich ranhalten müssen mit den Glühbirnenverkäufen, um dem Sohn die Erziehung im Internat, wie seltsam es auch sei, zu ermöglichen.
Das ist die Kurzfassung der Familienverhältnisse, in die Richard Yates im Jahr 1926 in Yonkers im Bundesstaat New York hineingeboren wird. Es ist aber auch die Kurzfassung des Vorworts zu seinem Roman "Eine gute Schule" von 1978.
Man könnte nun meinen: Aha, "Eine gute Schule" ist ein Buch der Erinnerungen. Der Autor erzählt uns ganz unumwunden von seiner eigenen Schulzeit! Aber so ist es nicht. Zwar hat Yates wohl nie persönlicher erzählt als in diesem Buch. Aber doch hat er dafür nicht die Gattungsbezeichnung "autobiographisches Fragment", sondern "Roman" gewählt, so dass wir uns nicht fragen müssen: Hat Yates das wirklich so erlebt?, sondern: Wie hat er es denn geschrieben?
Er greift fast vierzig Jahre in die frühen Vierziger zurück, in die Zeit des Kriegseintritts der Amerikaner, der von den Schülern, die ihrem Einzug in die Armee, Marine oder Luftwaffe entgegensehen, mit einiger Aufregung wahrgenommen wird. Gegen Ende wird der Krieg, die Angst und der drohende oder schnell eintretende Verlust von Gesundheit und dem Leben junger Männer ein mächtiger Stimmungstöter. Als die Schule Bankrott anmelden muss, macht die Nachricht die Runde, die Armee habe das Gelände gekauft, um dort ein Veteranenhospital für Erblindete einzurichten.
Eingerahmt von dem in der Ich-Form verfassten, mit Details aus dem Leben von Yates gesättigten Vor- und einem ebensolchen Nachwort, wird die Versuchung genährt, unter den Schülern, um die es geht, jenen herauszusuchen, der Richard Yates am ähnlichsten ist. Das ist William Grove, ein Junge in der Pubertät, mit fettigem Haar und indiskutablen Anzügen, ein Junge, der ungelenk wirkt, keine besonders guten Leistungen bringt und sich kaum gegen die Schikanen der anderen Schüler wehren kann, von denen einige sehr schön, einige sehr reich und fast alle offenbar gewandter sind als er.
Eines Tages aber schreibt er einen guten Aufsatz. Das ebnet den Weg in die Redaktion der Schülerzeitung, und dort wird Bill Grove eine kleine Laufbahn machen, wird sicherer im Schreiben werden und Anerkennung finden. Seine Glanzleistung am Ende ist der Leitartikel zum Abschied, als die Schule dicht macht. Er nennt ihn einen "Gruß", und der richtet sich an die blinden Veteranen - ein gefühlvoller, patriotischer Gruß voller Pathos. Bill ist in dieser Schule, die er nun den Blinden übergibt, eine Person geworden, die ins Leben gehen kann. Das ist ein für Yates ungewöhnlich hoffnungsvoller Ausblick.
Und doch ist Bill Grove weder die Hauptfigur dieses Buchs noch sein Erzähler, wie Rainer Moritz in seiner Einführung in Leben und Werk des Schriftstellers behauptet, die gleichzeitig mit dem Roman im selben Verlag erscheint. Weniger für die Abschnitte, in denen Moritz das literarische Werk betrachtet, als für die langen Passagen, in denen er vom Leben des Schriftstellers erzählt und von der eigentümlichen Rezeptionsgeschichte, ist dies eine hilfreiche Ergänzung. Denn noch immer ist Richard Yates unter den amerikanischen Autoren seiner Generation - zu der John Cheever, vierzehn Jahre älter, ebenso gehört wie der zwölf Jahre jüngere Raymond Carver - der bei uns unbekannteste.
Allerdings ist er nicht mehr so unbekannt wie noch vor zehn Jahren, als "Zeiten des Aufruhrs" auf Deutsch erschien, der Debütroman von Yates aus dem Jahr 1961. Nach einer schleppenden Wiederentdeckung in den Vereinigten Staaten, für die sich Schriftsteller wie Stewart O'Nan, Andre Dubus und Richard Ford vehement eingesetzt hatten, stößt seitdem auch bei uns der Name Richard Yates nicht überall mehr auf fragende Blicke. Stewart O'Nans glühender Aufruf, Yates wieder zu drucken, damit man ihn wieder lesen kann, erschien 2004 bei uns in der Zeitschrift "Krachkultur", und noch bekannter wurde zumindest "Zeiten des Aufruhrs" durch die Verfilmung von Sam Mendes mit dem "Titanic"-Paar Leonardo DiCaprio und Kate Winslet im Jahr 2008. Dennoch: So berühmt, wie er es verdient, ist Richard Yates bei uns immer noch nicht. Da muss ein Buch wie das von Moritz, leicht zu lesen, unterhaltsam geschrieben und voller Informationen zur Leidens- und Publikationsgeschichte dieses Autors, der trank und rauchte, bis er tot umfiel, unbedingt begrüßt werden.
Im Fall von "Eine gute Schule" aber, wie gesagt, irrt Moritz, wenn er Bill Grove als "Hauptfigur und Erzähler" dieses Romans bezeichnet. Der Erzähler ist Richard Yates, und er schaut auf diesen William Grove (in dem der Leser gegen Ende erst den Autor erkennen mag) aus derselben Distanz wie auf die anderen Figuren und das, was sie tun und was ihnen geschieht. Und die Stimme, die uns von den Ereignissen im Internat erzählt, ist keine autobiographische, sondern jene Erzählerstimme, die uns aus anderen Büchern dieses Autors bekannt ist: distanziert und klar, ohne Angeberei und ohne die Aufmerksamkeit auf den Stil zu lenken, den man einfach nennen könnte, hieße das nicht so viel wie: kann doch jeder. Nein. Erzählen wie Yates kann kaum einer - mit dem Blick fest aufs Unausweichliche gerichtet, in diesem Buch also den Krieg, in den viele der Schüler am Ende ziehen werden. Von Terry Flynn zum Beispiel, mit dem das erste Kapitel beginnt, heißt es im Nachwort, er sei "in der zweiten oder dritten Angriffswelle am Strand von Iwo Jima" gefallen.
"Eine gute Schule" ist ein Roman mit vielen Figuren; würde er je verfilmt, würde es ein Ensemblefilm. Und eine der unvergesslichen Konstellationen zwischen den zahlreichen Charakteren ist die Geschichte des verkrüppelten Chemielehrers Jack Draper, der zum Trinken ins Labor geht. Seine Frau Alice hat mit dem Französischlehrer Jean-Paul La Prade eine leidenschaftliche Affäre, bis dieser sie einfach fallenlässt. Die ganze Schule weiß von der Liaison, lange bevor Jack Draper von ihr erfährt, und obwohl die Sache vorbei ist, entschließt er sich eines Abends, seinem Leben ein Ende zu machen. Alice tippt derweil Bewerbungen für ihn an anderen Schulen; die "gute Schule" hat schon erklärt, dass sie schließen wird.
Jack Draper sagt: "Alice, ich wollte dir sagen, dass du eine schöne Frau bist." Er überlegt, sie werde später einmal denken, dies sei ein würdiger Abschiedssatz gewesen. Jetzt macht er sich auf ins Chemielabor, steigt mühsam über einen Stuhl auf einen Tisch. "Eines der besseren Dinge an Brooks Brothers war deren Auswahl an Ledergürteln. Geschmeidig, solide, in England hergestellt, waren sie mehr als ausreichend, die Hosen oben zu halten. Man konnte das Schnallenende eines solchen Gürtels über ein dienliches Dampfrohr legen, eine Schlinge machen und sie festziehen, dann das andere Ende um den Hals legen und an der Seite, unmittelbar unterm Ohr, zu einem hervorragenden Knoten binden. ,Okay, Alice', sagte Jack Draper laut in den leeren Raum hinein. ,Okay, Baby, ich liebe dich.' Doch er konnte den Tisch nicht wegtreten. Jeder normale Mann mit normalen Beinen hätte ihn spielend in weniger als einer Sekunde krachend umstoßen können, so dass er fallen, hängen und sich drehen würde - und die ganze Scheißwelt für immer enden würde; Jack Draper dagegen stand zitternd und hilflos lebend da und stieß mit seinen jämmerlichen Schuhen gegen den Tisch. Er konnte eine Zehe unter die hintere Tischkante haken, hatte aber nicht die Kraft, ihn damit umzukippen; er konnte eine Ferse über die vordere Kante klemmen, schaffte es aber auch so nicht."
Der Selbstmordversuch scheitert - und diese Szene, die auch Moritz in seinem Buch erwähnt, zeigt auf kaum zwei Seiten die große Erzählkunst von Yates: Wir sehen den Raum vor uns, in dem sie sich abspielt, wir sehen Draper zappeln und kämpfen und scheitern, und wir spüren die unendliche Einsamkeit, die diesen Mann umhüllt wie seine Schüler auch. Erwachsenwerden hat nichts damit zu tun, dass sie verschwindet. Dann geht Draper zurück nach Hause. "Er würde sich einen Bourbon genehmigen, in einem großen Glas mit viel Eis, und er würde ihn am Küchentisch in seinem eigenen Haus trinken wie ein Mann."
Die klare Sprache, die einfachen Sätze von Yates, sie sind nicht unbedingt auch leicht zu übersetzen. Eike Schönfeld gelingen auch im Deutschen vollkommen prätentionslose Sätze und ein Erzählton, der einerseits leicht ist, manchmal drastisch, und fast immer unterlegt mit einer Melancholie, die nichts Sentimentales an sich hat, aber ein Bewusstsein dafür wachhält, dass es sich um vergangene Ereignisse handelt.
Zwei Männer werden erwähnt, bevor es überhaupt losgeht: Der Vater - seinem Gedenken ist das Buch gewidmet. Und F. Scott Fitzgerald, der Schriftsteller, den Yates mehr verehrte als jeden sonst. Von ihm stammt der berühmte, vorangestellte Satz: "Rück mit dem Stuhl heran / Bis an den Rand des Abgrunds / Dann erzähle ich dir eine Geschichte." Am Abgrund erzählend - das ist die Haltung von Yates auch in diesem Buch.
Rainer Moritz: "Der fatale Glaube an das Glück". Richard Yates - Sein Leben, sein Werk.
Deutsche Verlags-Anstalt, München 2012. 201 S., geb., 19,99 [Euro].
Richard Yates: "Eine gute Schule" Roman.
Aus dem Englischen von Eike Schönfeld. Deutsche Verlags-Anstalt, München 2012. 231 S., geb., 19,99 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Meike Fessmann liebt diesen Autor, Richard Yates natürlich, nicht Rainer Moritz, um dessen Yates-Monografie es in der Besprechung eigentlich gehen sollte, möglicherweise. Vielleicht nimmt Fessmann das Buch aber auch zum Anlass, ihren Yates ein bisschen vorzustellen, seinen beiläufigen wie sicheren, aus den Figuren und ihren Dialogen zu kommen scheinenden Stil. Den Autor denkt sie sich auf der Höhe seines Schaffens. Da kommen Rainer Moritz und seine Monografie gerade recht. Zum Kennenlernen des Autors Yates, meint Fessmann, dessen Geschichte Moritz anschaulich, wenn auch ein bisschen bei Blake Bailey und seiner Biografie abgeguckt darstellt.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Die Kunst des Scheiterns
Langsam wird der große amerikanische Menschenkenner und Stilist Richard Yates auch hierzulande bekannt –
die Einführung in sein Leben und Werk von Rainer Moritz trägt dazu bei
VON MEIKE FESSMANN
Sieben Romane und zwei Erzählungsbände umfasst das schmale Werk von Richard Yates, dessen Stil jeder bewundert, der sein Augenmerk darauf lenkt. Denn ohne dass man eigens darauf achtet, bemerkt man ihn gar nicht. So unangestrengt kommt er daher, so beiläufig und sicher. In der Prosa des Richard Yates drängt sich die Sprache nicht in den Vordergrund. Sie steht im Dienste der Figuren, schmiegt sich ihren Innenwelten an, erwächst aus Dialogen und erhält ihre Dyna-mik aus dem Wechselspiel von hoher Erwartung und Desillusionierung.
In „Baumeister“, der letzten Erzählung seines ersten Erzählungsbandes mit dem charakteristischen Titel „Elf Arten der Einsamkeit“ ( 1962), lässt sich ein Schriftsteller in Geldnöten von einem Taxifahrer als Ghostwriter anheuern. Und diese Erzählung, einer der wenigen selbstironischen, in der ersten Person erzählten Texte des Autors, enthält in nuce die Tragik seines Schriftstellerlebens. Aus dem Rückblick von dreizehn Jahren auf das Jahr 1948 erzählt sie vom Zwiespalt zwischen dem hohen Anspruch an sich selbst – die Messlatte verkörpert zunächst noch Hemingway, später werden es Flaubert und Fitzgerald sein – und den Niederungen der Ebene.
Während der Taxifahrer stolz allerlei Unsinn über das Geschichtenerzählen von sich gibt – es sei wie Häuserbauen, man müsse beim Fundament beginnen und sich dann Stockwerk für Stockwerk nach oben arbeiten –, redet sich der Schriftsteller ein, sein Auftraggeber habe „etwas von der Schwierigkeit und dem Wert von Verdichtung in Prosatexten“ verstanden. Er verbringt Tage damit, einen falschen Anfang nach dem anderen zu produzieren. Als er seine Probearbeit schließlich abliefert, erhält er nur ein Fünftel des in Aussicht gestellten Honorars. Doch selbst unter diesen Bedingungen lässt er sich auf die Zusammenarbeit ein. Das im Entwurfsstadium verharrende Romanprojekt muss aufgeschoben werden. Und daraus ergibt sich, was sich im Leben von Richard Yates oft wiederholen sollte: „dass es nur langsam voranging, vergrößerte das Versprechen seiner schließlichen Großartigkeit“.
Das führt immer wieder zu Blockaden. Zwischen seinem gefeierten Debüt von 1961, dem Roman „Revolutionary Road“ („Zeiten des Aufruhrs“), der nicht zuletzt durch Sam Mendes‘ Verfilmung mit Kate Winslet und Leonardo DiCaprio auch hierzulande seine Leser fand, und dem zweiten Roman, „A Special Providence“ („Eine besondere Vorsehung“), vergingen acht Jahre. Richard Yates steht mit seinem Leben und seinem Werk für eine Entwicklung, die in den fünfziger Jahren begann und mittlerweile wohl ihren Zenit erreicht hat: die Aufspaltung des Individuums in eine reale Person und in das Bild, das es von sich entwirft, den Images der Film- und Werbeindustrie nachgebildet, denen es niemals genügen kann.
Frank und April Wheeler, das scheiternde Ehepaar aus „Zeiten des Aufruhrs“, sind Prototypen dieses Prozesses. Sie leben in der Vorstadt, die sie zugleich ver-achten, weil sie meinen, zu Höherem geboren zu sein. Und jeder sieht am anderen, dass er seinem übersteigerten Selbstbild nicht genügt. Diese wechselseitige Desillusionierung, das Durchschauen des Scheins des anderen, ist das Grundmuster in Yates‘ Werks. Es wurde ihm in die Wiege gelegt.
Beide Eltern des am 3. Februar 1926 in Yonkers, New York, geborenen Schriftstellers hatten künstlerische Ambitionen. Sein früh verstorbener Vater wäre gern Sänger geworden und verdiente sein Geld als Verkaufsleiter von Mazda-Glühbirnen. Seine Mutter verstand sich als Künstlerin und zog nach der Scheidung im Jahr 1929 mit ihren beiden Kindern von einer schäbigen Wohnung in die andere. Von ihr haben Richard und seine fünf Jahre ältere Schwester Ruth die Trunksucht geerbt.
Ruth starb mit nicht einmal siebenundvierzig Jahren. Bei ihrem Bruder kam zum Alkoholismus und psychischer Krankheit noch eine Lungenerkrankung hinzu, die er sich als junger Soldat im Zweiten Weltkrieg zugezogen hatte und durch exzessives Rauchen so sehr verschlimmerte, dass er schließlich von einem Sauerstoffgerät abhängig war. Als er am 7. November 1992 in Birmingham, Alabama, starb, hatte er immerhin ein Alter von sechsundsechzig Jahren erreicht – und ein Werk geschaffen, das die Grundkonstellation seiner Herkunftsfamilie und seine beiden gescheiterten Ehen in immer neuen Variationen zu Geschichten ausformt, die auch zwanzig Jahre nach seinem Tod nichts von ihrer Gültigkeit verloren haben.
Literarische Moden waren diesem bei aller Zeitdiagnostik stets unmodischen Schriftsteller zutiefst suspekt. Als Ende der 1960er Jahre „metafiktionale“ Auto-ren wie Donald Barthelme, William Gass oder John Barth die Aufmerksamkeit auf sich zogen, goss er seinen Spott über die Kollegen aus. Wie einer der Verspotteten, der sechs Jahre jüngere Robert Coover, lehrte Yates „Creative Writing“ an der University of Iowa, das war eine der zahlreichen Lehrtätigkeiten, mit denen er sein Geld verdiente, nachdem er zuvor für die Nachrichtenagentur United Press und den Computerhersteller Remington Rand gearbeitet hatte sowie Reden für den Justizminister Robert Kennedy schrieb.
Die Deutsche Verlags-Anstalt macht sich seit einigen Jahren um die Edition des Werks von Richard Yates verdient, der auch in seinem Heimatland nach seinem Tod rasch vergessen wurde. In einem flammenden Essay wies Stewart O’Nan 1999 darauf hin, dass die Bücher von Yates vergriffen sind. Er fürchtete, der von Kollegen wie Raymond Carver, Alice Munro, Joyce Carol Oates, Andre Dubus, Tobias Wolff, Cormac McCarthy und Richard Ford bewunderte Autor könnte für immer ein „writer’s writer“ bleiben. Doch die Verlage begriffen, dass die Stunde von Yates kommen würde. Denn dieser Autor ist nicht nur ein Maßstäbe setzender Stilist, sondern auch ein großer Menschenkenner, dessen Bücher dem Leser keine Hindernisse in den Weg stellen. Und er hat früh das visuelle und elektronische Zeitalter begriffen, das den existentiellen Grundsituationen einen neuen Stempel aufdrückt.
Mittlerweile sind fünf seiner Romane auf Deutsch erschienen sowie beide Erzäh-lungsbände. Wer bis zum Erscheinen der letzten beiden Romane, „Young Hearts Crying“ (1984) und „Cold Spring Harbor“ (1986), Werk und Leben von Richard Yates näher kennenlernen möchte, dem sei die Monographie von Rainer Moritz empfohlen. „Der fatale Glaube an das Glück“ ist eine gut erzählte Einführung, die keinen Hehl daraus macht, dass sie Blake Baileys großer Biographie „A Tragic Honesty. The Life and Work of Richard Yates“ viel verdankt. Das schadet nicht. So hat Rainer Moritz, Kritiker, Autor und Leiter des Hamburger Literaturhauses, die Hände frei, um seinen Stoff höchst anschaulich zu gestalten.
Rainer Moritz: Der fatale Glaube an das Glück. Richard Yates – sein Leben, sein Werk. DVA, München 2012. 208 Seiten, 19,99 Euro.
Dieser Autor arbeitete an seinem
Stil, bis er unsichtbar wurde
Richard Yates auf der Motorhaube seines alten Mazda.
FOTO: GINA YATES
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de
»Rainer Moritz' Biografie ist ein unaufdringlicher Begleiter auf der Reise zu einem schwierigen Menschen und zu dem, was von ihm bleibt.« Kurier (A), 25.08.2012