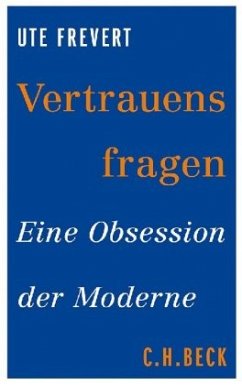"Vertrauen" - kaum ein Begriff hat in den letzten Jahren eine so rasante Aufmerksamkeits- und Erregungskonjunktur zu verzeichnen. Auf Wahlplakaten und in der Produktwerbung begegnen wir ihm, bei jeder Krise wird sein Verlust alarmierend beschworen. Wo Vertrauen in Frage gestellt wird, da gedeiht rasch eine Kultur des Verdachts und der Rechenschaftspflichten mit langfristig fragwürdigen Folgen. Ute Frevert zeichnet in ihrem Buch zunächst die seltsame Karriere des Vertrauens in der Moderne nach, das seit dem 18. Jahrhundert zunehmend säkularisiert und entmoralisiert wurde. Sie untersucht sodann den Gebrauch des Begriffs in unterschiedlichen Kontexten wie Familie/Freundschaft, Schule, Ökonomie und Wissenschaft. Schließlich wirft sie auch einen kritischen Blick auf die "V-Waffe", den inflationären Einsatz des Vertrauensarguments in der Politik.

Ein Begriff, der in vielen Lebensbereichen Konjunktur hat - vielleicht in allzu vielen: Die Berliner Historikerin Ute Frevert legt eine Kulturgeschichte des Vertrauens vor
Heinrich von Kleist ließe sich als Dichter des Vertrauens charakterisieren. In seinem Schauspiel "Das Käthchen von Heilbronn" soll dem schwererkrankten Grafen Wetter vom Strahl ein Engel erschienen sein, der an ihn appellierte: "Vertraue, vertraue, vertraue". Und in der Erzählung "Die Verlobung in St. Domingo" ruft die sterbende Toni ihrem Verlobten Gustav zu, der auf sie geschossen hat: "Du hättest mir nicht misstrauen sollen." Vertrauen wird hier als existentiell entscheidende Größe erfahrbar, deren Bedeutung aus dem zeitlichen Kontext von Kleists Werks zu erschließen ist: Die feudale Gesellschaftsordnung und Religion bieten zunehmend weniger Halt; das Subjekt sucht Stärkung und Selbstvergewisserung im Gegenüber.
Die "Obsession der Moderne", als welche die Historikerin Ute Frevert das Vertrauen im Untertitel ihres neuen Buches kennzeichnet, lässt sich hier besonders intensiv erleben, zu einem Zeitpunkt, da der Begriff allmählich eine zentrale Bedeutung in zahlreichen Lebensbereichen gewinnt. Zuvor war er vor allem gebräuchlich im Sinne von Gottvertrauen; Institutionen und Mitmenschen, nicht zuletzt höherrangige, erwarteten Treue. Doch Mitte des achtzehnten Jahrhunderts beginnt sich dies zu ändern, im Bereich des Zwischenmenschlichen und bald auch im Verhältnis zur politischen Ordnung, schließlich im Ökonomischen, wo zunehmend mehr auf Vertrauen gesetzt und um es geworben wird - ganz selbstverständlich, wie es scheint, doch ohne dass dabei immer klar wäre, ob es berechtigt und was darunter näher zu verstehen sei, wie die Direktorin am Berliner Max-Planck-Institut für Bildungsforschung darlegt.
Die Historikerin macht die grundlegende Bedeutung des Vertrauens für die moderne Welt transparent, die es zu einem Leitmotiv des sozialen Handelns erhebt. Auf den deutschen Sprachraum beschränkt sie sich mit gutem Grund, ist doch die "Vertrauenskommunikation fundamental an Sprache und Rhetorik gebunden", wie sie schreibt. Zahlreiche Belege sammelt sie auf ihrer historischen Spurensuche und verschweigt nicht, was sie selbst als Manko ihrer Darstellung begreift: Wissenschaft und Kunst werden darin weitgehend ausgespart. Am dichtesten argumentiert die Autorin dort, wo ihr eigentliches Metier, die politische Historie und Sozialgeschichte, zu befragen ist.
Am Beispiel von Richard Wagners Deutung des Lohengrin-Mythos - der Schwanenritter erwartet ebenso gegenseitiges Vertrauen wie die von ihm gerettete Elsa, freilich in je unterschiedlicher Akzentuierung, was tragische Folgen zeitigt - zeigt sich die fürs Vertrauen charakteristische Wechselseitigkeit. Diese unterscheidet es von verwandten Phänomenen oder solchen, an deren Stelle es tritt: Treue lässt sich auch einseitig fordern, ein Gleiches gilt für etwas, auf das man sich schlicht verlässt. Die Zuversicht impliziert keine Reflexion wie das Vertrauen, das dosiert und einer Prüfung unterzogen werden kann. Mit Mitteln einer Theorie rationaler Entscheidung lasse sich das Phänomen nicht erfassen. Denn Vertrauenshandlungen sind immer riskant, was Vertrauensspendern wie -nehmern stets bewusst bleibt.
Die Rationalisierung politischer Prozesse, die Max Weber als Charakteristikum der Moderne beschrieb, findet am Vertrauen eine Grenze. Wobei sie zunächst offenlässt, ob ein Vertrauen, um das Politiker und Parteien werben, dem eigentlichen Charakter desselben noch entspricht. An einem unwandelbaren Bedeutungskern hält sie in ihrer Darstellung nämlich fest: Nähe, Intimität, Offenheit und Transparenz impliziere der Begriff dauerhaft.
Im Zwischenmenschlichen markiert das Konzept der romantischen Liebe den Zeitpunkt, wo das Vertrauen zur bestimmenden Größe wird. Unter Männern entfaltet es seine Wirkung in Freundschaften und kann auch dort eine totale und exklusive Dimension eröffnen, welche im Gegenteil dann leicht Misstrauen befördert: Die Beziehung Richard Wagners zu Friedrich Nietzsche dient Frevert als Beispiel. Ausführlich erörtert sie nicht zuletzt die Bedeutung des Vertrauens in der modernen Pädagogik seit Pestalozzi.
Es versteht sich, dass es in der wirtschaftlichen Sphäre nicht um Vertrauen im emphatischen Wortsinn geht. Doch wem sonst sollte man Kredit gewähren als einer Person, der man vertraut? Schon die Etymologie legt nahe: Kredit impliziert Glauben. Das der Ökonomie mindestens so naheliegende rationale Kalkül führt freilich auch zum Gegenteil, was sich im raschen Wachstum von Auskunfteien, die ihren Kunden Informationen über die Kreditwürdigkeit von Personen verschaffen, bestätigt. Dass auch die intime Note des Vertrauens im Ökonomischen angesprochen werden kann, belegen das sogenannte Konsumenten- und Markenvertrauen. Reaktionen auf geänderte Produktverpackungen bestätigen, wie lebendig Marken zuweilen erscheinen.
Als im neunzehnten Jahrhundert auch in Deutschland demokratische Bestrebungen an Macht gewinnen, macht das auf John Locke zurückgehende Konzept des "Vertrauensstaats" von sich reden. Die Abgeordneten der Frankfurter Bundesversammlung werden "Vertrauensmänner" genannt. Auch in der Weimarer Verfassungsdebatte ist häufig von Vertrauen die Rede. Der nationalsozialistische Sprachgebrauch appelliert dann wieder eher an die alte Treue. In der DDR wird Vertrauen in die Partei gefordert. In der Bundesrepublik werben Politiker wie Willy Brandt und Helmut Kohl um das Vertrauen der Wähler, indem sie sich selbst als vertrauenswürdig darstellen. Und zuweilen stellen Kanzler die Vertrauensfrage, um ihren Rückhalt zu prüfen.
Prosaischen Verhältnissen verleihe der Begriff des Vertrauens poetischen Glanz, so Frevert; er suggeriert Emotionalität und moralisches Verhalten. Seiner anhaltenden Konjunktur ist dieser Umstand sicher zuträglich, auch wenn man sich wohl meistens darüber bewusst ist, dass das tatsächlich Gemeinte seinen Namen oft nur in Maßen verdient. Emotionalität bleibt erst recht im stahlharten Gehäuse der Moderne gefragt, doch Vertrauensseligkeit ist heute keine nützliche Eigenschaft.
THOMAS GROSS.
Ute Frevert: "Vertrauensfragen". Eine Obsession der Moderne. Verlag C.H. Beck, München 2013. 259 S., br., 17,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Was Ute Frevert hier zum Thema Vertrauen vorgelegt hat, ist keine große Studie, baut Johan Schloemann falschen Erwartungen vor, sondern vielmehr eine Ansammlungen von Beobachtungen, Befunden, die mitunter pointiert ausfallen, aber nicht immer ganz tiefgründig. Frevert geht von einer Überbeanspruchung des Vertrauensbegriffs aus, ständig fordern Politiker, Händler oder Werber Vertrauen ein oder sprechen von Vertrauen, wenn es eigentlich um Mehrheiten oder Kaufanreize geht. Nicht immer kann man Schloemann folgen, wenn er etwa vom Vertrauen spricht, dessen Berechtigung durch einen Kontrolldienst wie die Schufa hergestellt werde, vermisst man irgendwie die Anführungszeichen. Aber sehr deutlich wird, dass Schloemann unzählige Belege für eine "semantische Entgrenzung des Vertrauens" gefunden hat.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Ute Frevert erklärt, warum heutzutage alle von allen „Vertrauen“ verlangen
Der Zusammenbruch von Vertrauen auf den Finanzmärkten, innerhalb des Bankensektors, bei Sparern, die plötzlich um ihre Einlagen bangen und die Banken stürmen, sowie zwischen Anlegern und verschuldeten Staaten – das war und ist ein alles bestimmendes Thema seit der Finanzkrise von 2007/2008. Und so häufig vom Vertrauensverlust die Rede ist, und so sehr er als Grund für das Platzen einer Spekulationsblase auch einleuchten mag – besonders post festum –, so wenig einfach scheint sich erklären zu lassen, was unter dem ominösen „Vertrauen“ der Märkte eigentlich genau zu verstehen sei. Herdentrieb? Vernünftige Gewinnerwartungen? Blinde Raserei oder sinnvolle Effektivitätsannahmen, bei denen bloß keiner wusste und weiß, zu welchem Zeitpunkt der Bogen eindeutig überspannt wird?
Wer hier von dem neuen Buch der Historikerin Ute Frevert, das vom Vertrauen handelt, Auskunft erwartet, der wird erst einmal schwer enttäuscht. Bis auf den Hinweis in ein paar dürren Sätzen zur Finanz-, Euro- und Schuldenkrise, dass „alles und jedes heutzutage als Krise des Vertrauens ausgegeben“ werde, erfährt man rein gar nichts über diese Fragen, die Verhaltensökonomen, Wirtschaftssoziologen und die Öffentlichkeit in den letzten Jahren beschäftigt haben. Dennoch könnte Ute Freverts Buch gerade auch für diese Diskussionen nützlich sein: weil es nämlich die Besinnung über diesen allgegenwärtigen Begriff anreichert mit einer weiter ausgreifenden Wort- und Ideengeschichte, die dann auch durchaus in die Gegenwart führt. Das allgemeine Verständnis von „Vertrauen“, das dem gesellschaftlichen und politischen Wandel der letzten zweihundert Jahre gefolgt ist und ihn auch umgekehrt beeinflusst hat, muss schließlich auch dort zugrundegelegt und problematisiert werden, wo es sich (scheinbar) um einen eher technischen Begriff der Finanzwelt und der Wirtschaftspolitik handelt.
Ute Freverts Buch „Vertrauensfragen“ nimmt seinen Ausgang bei der Überbeanspruchung des Begriffs: in der Politik, in der Werbung, im Privatleben und in dessen öffentlicher Darstellung. Von allen wird überall Vertrauen gefordert, eine schwer greifbare, aber universell positive Haltung, ja, wie Frevert es nennt, eine „Obsession der Moderne“: von Bürgern, Wählern und Parlamentsabgeordneten – letztere können es, auf die „Vertrauensfrage“ des Regierungschefs hin, entziehen, wobei das Bundesverfassungsgericht festgestellt hat, dass die moralische und emotionale Aufladung des Begriffs im demokratischen Verfahren des Parlaments eigentlich fehl am Platze ist – „Vertrauen“ hat dort in Wahrheit nur eine pragmatische staatsrechtliche Bedeutung, namentlich die Existenz einer verlässlichen Mehrheit; diese Mehrheit soll aber durch das pathetische Erpressungspotenzial des Wortes „Vertrauen“ erzwungen werden, was wiederum der ständigen Anwendung der „Vertrauensfrage“ entgegensteht, die andernfalls ja ihre Kraft verlöre.
Vertrauen verlangt man aber auch von Konsumenten – gegenüber den Waren, den Unternehmen und ihren Marken; von Handels- und Vertragspartnern und von den Teilnehmern an Kreditgeschäften. Für die Berechtigung des Vertrauens gibt es eine ganze Prüf-Industrie, von der Schufa über die Stiftung Warentest bis hin zu den gefürchteten Ratingagenturen. Und ebenso sollen sich Eltern, Kinder, Schüler, Lehrer, Ärzte, Patienten, Ehepartner, Freunde und Liebende stets um Vertrauen bemühen oder, noch besser, die Bemühung so großzügig verinnerlichen, dass keine Mühe, sondern nur noch Aufrichtigkeit zu spüren ist. Wenn Ökonomen vom „rational choice“ ausgehen, also einen Marktteilnehmer postulieren, der immer dort Vertrauen als vernünftige Unterstellung schenkt, wo es letztlich den eigenen Interessen dient – dann übersehen diese Ökonomen, wie Ute Frevert plausibel argumentiert, „die starke normativ-moralische Aufwertung des Begriffs“ sowie seine „Konnotation von Wohlgefühl und Aufgehobensein“.
Wir leben also in einem Zeitalter der „semantischen und sozialen Entgrenzung des Vertrauens“, stellt Ute Frevert fest. Es muss desto mehr beschworen werden, je weniger es in verlässlichen (lokalen, ständischen, kirchlichen) Bindungen selbstverständlich ist oder überhaupt nicht beeinflussbar erscheint; und je mehr Sicherheit das moderne Leben verspricht, desto schärfer schmerzen die Lücken, die verbleibenden Risiken, die Vertrauen brauchen. Das heißt: Das Vertrauen, das wir Zeitgenossen als eine Kraft von geradezu zeitloser Wärme empfinden – der Psychoanalytiker Erik Erikson hatte große Wirkung mit seiner These vom „Urvertrauen“ zwischen Mutter und Kind –, dieses Vertrauen hat doch seine Geschichte in der Zeit.
Dieser Entwicklung geht Ute Frevert in historischen Skizzen nach. In Psalm 118,8 heißt es: „Es ist gut auf den Herrn vertrauen und sich nicht verlassen auf Menschen.“ Noch in Zedlers „Universal-Lexicon“ von 1746 wird vermerkt: Sicheres Vertrauen gebe es unter wahren Christen nur zu Gott. Doch schon bahnt sich das schwindende Gottvertrauen in einer mobileren, komplexeren und wissenschaftlicheren bürgerlichen Gesellschaft an – derselbe Lexikoneintrag von 1746 nennt auch schon das Arzt-Patienten-Verhältnis als einschlägiges Beispiel und warnt mit gut aufklärerischem, kritischen Sinn für Psychosomatik: „Fällt das Vertrauen weg, so haben die Medikamente schon die halbe Krafft verlohren. Denn das gute Vertrauen des Patienten erhält das Gemüth in Ruhe, und trägt zur Genesung nicht wenig bey.“
Erst seit Ende des 18. Jahrhunderts hat „Vertrauen“ den guten Klang, den es heute hat. Um 1800 war, so Frevert, Gott „nur noch einer unter mehreren Vertrauensnehmern“, es kamen die Kaufleute, die Freunde und die romantische Liebesheirat hinzu. In der Politik verschob sich, gefärbt von der Herzensrhetorik der Empfindsamkeit, das Verhältnis zwischen Obrigkeit und Bürgern: von der Treue zum Vertrauen, so wie es das englische Parlament schon länger verlangt hatte. Reaktionäre Juristen wehrten sich gegen den liberalen Verfassungsstaat mit dem Argument, dieser beruhe „auf dem Princip des Mißtrauens“ (so Friedrich Jakob Schmitthenner, 1838). Im 20. Jahrhundert notiert Frevert die Verwässerung und den Missbrauch des Vertrauensbegriffs in verschiedenen Sphären: in der Konsum- und Warenwelt, wo Millionen den Marken „vertrauen“ sollen; auch in der Sprache der Nationalsozialisten.
Ute Freverts Buch ist keine ganz große Studie, eher ein Katalog von Befunden und Anregungen. Während die zeitdiagnostischen Möglichkeiten nicht überall genutzt werden (es fehlen bei der Behandlung von Freundschaft und Staat die heutigen Fragen von Facebook-Vertrauen, Datenschutz, Persönlichkeit und Überwachung in der digitalen Welt), so finden sich pointierte Beobachtungen etwa zur Erziehung: Der „pädagogische Vertrauensdiskurs“ der Reformpädagogik seit Pestalozzi war derart wirksam, dass Gerold Becker, der Kinderschänder von der Odenwaldschule, noch im April 2002 in einer „langen Nacht“ der Deutschlandfunks auftreten konnte – als berufsmäßiger Experte für das Thema Vertrauen.
JOHAN SCHLOEMANN
Ute Frevert: Vertrauensfragen. Eine Obsession der Moderne. Verlag C. H. Beck, München 2013. 259 Seiten, 17,95 Euro. E-Book 13,99 Euro.
Das Buch geht aus von der
Überbeanspruchung des Begriffs
in Politik, Werbung, Privatleben
Um 1800 war Gott nur
noch einer unter verschiedenen
Vertrauensnehmern
Die Historikerin Ute Frevert lehrte bis 2007 an der Yale University und ist heute Direktorin am Berliner Max-Planck-Institut für Bildungsforschung. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit ist die Geschichte der Gefühle. FOTO: MPI, DAVID AUSSERHOFER
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de