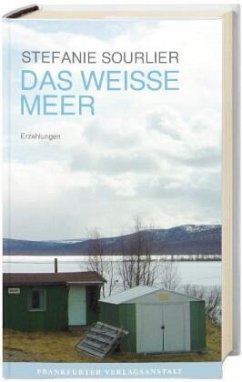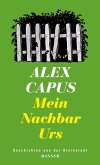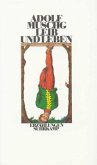Drei Jugendliche verbringen einen heißen Sommer in einem südfranzösischen Fischerdorf. Doch nichts ist mehr, wie es noch vor wenigen Jahren war: Frühere Lieben sind verschwunden, die Kinderspiele langweilig geworden. Als die Hitze immer unerträglicher wird, bricht die scheinbare Idylle zusammen. Eine junge Frau wandert nach Manchester aus, seltsam getrieben von einer Frau, die sie nicht vergessen kann. Die Sehnsucht nach ihr führt sie - fast - bis an das Weiße Meer. Zwei Geschwister haben sich eine zauberhafte eigene Welt geschaffen. Tage- und nächtelang spielen sie am Mondsee, aus dem sie geboren zu sein glauben, sprechen »Rosam«, ihre eigene Sprache. Als die Geburt eines Geschwisterchens ihre Zweisamkeit zu zerstören droht, fassen sie einen ungeheuren Plan.

Ein gelungenes Debüt aus der Schweiz: Stefanie Sourliers Erzählungsband „Das weiße Meer“
Sommer in Südfrankreich, schön, aber das Meer ist zu weit, kein Auto zur Verfügung, es ist heiß, und der Bus zum Wasser fährt früh am Morgen. Wieder ein überlanger Nachmittag, wieder Zeit zum Herumhängen im kühlen Haus, Zeit für schlimme Geschichten, die sich das Ich und eine Freundin erzählen: „Als ich elf Jahre alt war, wollte ich sterben und schluckte das Kupfersulfat aus dem Kosmos-Chemiekasten, den mein Bruder zum Geburtstag bekam.“ Ein energischer, geradezu giftiger erster in-medias-res-Satz für ein Erzähldebüt. Stefanie Sourlier, 1979 in Basel geboren, hat weder ein Schreibinstitut absolviert noch renommiert sie mit einer Matrosen- oder Taxifahrerinnen-Karriere. Sie hat, ganz schlicht, in Zürich und Berlin Germanistik und Filmwissenschaft studiert und daneben an vier Wochenenden die Autorenwerkstatt des Literarischen Colloquiums Berlin besucht.
Der Selbstmord-Versuch der elfjährigen Ich-Erzählerin misslingt, doch sie gibt nicht auf, leert die Aknekapseln des Bruders, füllt sie, wieder mit Kupfersulfat. „Erst geschah nichts. Aber nach zwei Stunden kam es. So stark, dass ich mich am Badewannenrand festhalten musste. Ich wusste, dass das Sterben nicht einfach sein würde, also nahm ich es hin.“ Am Ende erbricht sich das theatralische Kind, bleibt auf dem Badezimmerboden liegen, das ist alles.
Gern wird jungen, einigermaßen vielversprechenden Autorinnen bescheinigt, sie seien die Stimme ihrer Generation. Das wäre hier sinnlos, auch wenn das Setting und einige Stilmittel manchmal auf eine der zahlreichen Autorinnen hinzuweisen scheinen, denen Judith Hermanns berlin-brandenburgische Geschichten den melancholischen Ton vorgegeben haben und die jetzt, jede für sich, versuchen müssen, die 101. Variation auf die Wohlstands-Ziellosigkeit ihrer Protagonisten zu liefern.
Doch bei Stefanie Sourlier bestimmt, schon in „Kupfersulfatblau“, nicht nur das härtere, südfranzösische Licht, die weniger „weiche“ Sinnleere des cafard, den abweichenden Ton. Ihre Atmosphären entstehen auch durch präzise Charakterisierung, geschickte Zuspitzung oder Retardierung der Handlung, durch genau gesehene Details. Es ist muss ja nicht immer das eigene Thema sein, das einen Erstling von anderen abhebt. Manchmal genügt schon die Souveränität der Darstellung, ein einfacher Satz wie „Auf der anderen Straßenseite liegt die Katze des Nachbarn wie ein schwarzer Fleck auf dem Gehsteig“, oder der Einfall, Onkel Georg vor allem der „angenehmen Kühle“ wegen ins Kino gehen zu lassen. Onkel Georg vergisst die Filme, er liebt die Klimaanlage.
Bei Hanna Lemke, die mit „Gesichertes“ im vergangenen Frühjahr ähnlich trendnah und doch eigenständig debütierte, war die Unbestimmtheit der sexuellen Identitäten ein immer wieder präsentes Merkmal. Stefanie Sourlier, bei der es nicht in erster Linie um ein Portrait städtischer Jugend geht, hat sich an den Entwurf eines Familienromans in Erzählungen gemacht. Vor allem die Bruder-Schwester-Beziehung zwischen dem Erzählerinnen-Ich und Paul durchzieht das ganze Buch.
Das Spektrum reicht vom angedeuteten Selbstmordversuch Pauls im kupfersulfatblau leuchtenden Schwimmbecken – „Ich hätte nicht gedacht, dass man Schwimmen verlernen kann“ – bis zum ebenfalls nur angedeuteten Inzest-Motiv in „Das weiße Meer“: eine lesbische Freundin wird anhand eines Fotos beschrieben. Sie sieht, trotz Pünktchen- Kleid, nicht nur aus „wie ein verkleideter Junge“: „Sie sieht aus wie mein Bruder als er noch jünger war und schmal wie ein Mädchen.“
Mit diesem Schluss gehört die Titelerzählung, die sich auf das Meer vor Archangelsk bezieht, zu den Texten des Bandes, in denen der Bruder „verschoben“ auftaucht: „Jonas war mein Bruder, jedenfalls sagten wir das so,“ heißt es in „Morgen ist schon wieder heute.“ Bei aller motivischen Bedeutung bleibt die Geschwisterliebe bei Sourlier jedoch ähnlich zweideutig wie die meisten anderen Beziehungen in diesen Texten. Sie trägt keine fatal-existenziellen Züge. Nur an den seltenen Stellen, in denen die Eltern mit einbezogen sind, vor allem in der letzten Erzählung „Rosam“, spürt man, dass sich die Intensität zwischen Bruder und Schwester aus der Abwehr gegen diese Eltern, gegen die feindliche Umwelt und gegen ein drittes, um einige Jahre jüngeres Kind speist.
„Rosam“ ist eine „geheime Sprache“, „die Waffe gegen den Kindergarten, der uns Bauchschmerzen verursachte, gegen die bösen Kinder, die den Fröschen die Beine aus dem Leib rissen und sie mit Fahrradpumpen aufzublasen versuchten, gegen unsere Eltern, die immer fortgingen am Abend.“ Als das neue Kind kommt, bleibt die Mutter abends zuhause, „aber das bedeutete nicht, dass es besser wurde“, jetzt müssen die beiden still sein, und sie denken in dieser, in den zivilisierteren Westen geholten Huldigung an Agota Kristof und Thomas Bernhard, an Mord.
Ansonsten spielen die Eltern kaum eine Rolle, aber mit Onkel Georg (in der Erzählung „Nach Italien“) und einem der Großväter (in „Demut“) finden auch andere Familienmitglieder in die Geschichten hinein und erweitern den Weltbezug. Vor allem „Nach Italien“ ist in dieser Hinsicht aufschlussreich. Onkel Georg ist nicht nur einer der vielen Verwirrten der gegenwärtigen deutschen Literatur, er stellt auch eine Verbindung her zur „alten“, ländlichen Schweiz, die hier längst schon, in einem 1937 gebauten Stausee versunkenen ist. Schon für den Onkel ist sie fremd, aber die auf nachkolorierten Fotos bewahrte dörfliche Idylle wirkt nun vollends wie ein bewusst gesetzter Kontrapunkt zu den auf sich selber konzentrierten Mittelschicht-Eltern mit Ferienhaus in Südfrankreich.
So hinterlassen Stefanie Sourliers Geschichten, auch wenn Motive wie der „Tod“ oder das „Alter“ gelegentlich fast zu „schön“ über den Text gestreut wirken, nicht nur den Eindruck einer gekonnten Wahl der Mittel, sondern allmählich auch den von vielversprechender Tiefe und Eigengesetzlichkeit, die beide noch weiter erkundet werden können.
HANS-PETER KUNISCH
STEFANIE SOURLIER: Das weiße Meer. Erzählungen. Frankfurter Verlagsanstalt, Frankfurt am Main 2011. 170 Seiten, 19,90 Euro.
Onkel Georg geht wegen der
„angenehmen Kühle“ ins Kino.
Die Filme vergisst er
Eingesponnen in die Geschichten der Autorin Stefanie Sourlier: Ein blaues Boot am weißen Meer bei Archangelsk. Foto: Alexander Gronsky/Agentur Focus
Stefanie Sourlier. Foto: Laura J. Gerlach
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de
Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension
Geradezu Sorgen möchte sich Judith von Sternburg nach diesem Erzählungsband von Stefanie Sourlier machen. Ihr stellt sich nämlich die Frage, "wie es nach einem solchen Debüt weitergehen soll". Sourlier erzählt in verschiedenen Geschichten von einer jungen Frau, deren Bruder Paul und einer Reihe Freunde und Freundinnen, die durch ein eher unglückliches Leben, durch Unglücksfälle, Missgeschicke verbunden sind, berichtet Sternburg. Der "komische Freund" nimmt sich das Leben, der Bruder hätte es beinahe getan. Für die Rezensentin kündeten die Erzählungen von einer "atemnehmende Traurigkeit".
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH