Im August 2009 meldeten die Feuilletons eine Sensation: In einem der Öffentlichkeit nicht zugänglichen Teil des Max-Frisch-Archivs in Zürich war das Typoskript eines bisher unbekannten Werks des Schweizer Autors gefunden worden: 184 Seiten, von Frisch auf Tonband diktiert, von seiner Sekretärin in die Maschine getippt. Der Autor selbst hatte auf der Titelseite notiert: "Tagebuch 3. Ab Frühjahr 1982".
Max Frisch lebte zu dieser Zeit in New York, zusammen mit seiner damaligen Lebensgefährtin Alice Locke-Carey, bekannt als "Lynn" aus der Erzählung Montauk. Ihr ist das Tagebuch 3 gewidmet, und vermutlich fällt das abrupte Ende der Aufzeichnungen Mitte der achtziger Jahre mit der Trennung von der Amerikanerin zusammen. Die USA und die Schweiz, die Reagan-Administration und das belastete Verhältnis zu der um vieles jüngeren Frau, der Kalte Krieg und der Krebstod eines engen Freundes: Wie die beiden legendären, 1950 und 1972 erschienenen Tagebücher verzeichnet auch das Tagebuch 3 Augenblicksnotizen neben längeren reflexiven Passagen und hebt das scheinbar flüchtig hingeworfene Notat in den Rang des Literarischen: "Es gibt in Amerika alles nur eins nicht: ein Verhältnis zum Tragischen."
Max Frisch lebte zu dieser Zeit in New York, zusammen mit seiner damaligen Lebensgefährtin Alice Locke-Carey, bekannt als "Lynn" aus der Erzählung Montauk. Ihr ist das Tagebuch 3 gewidmet, und vermutlich fällt das abrupte Ende der Aufzeichnungen Mitte der achtziger Jahre mit der Trennung von der Amerikanerin zusammen. Die USA und die Schweiz, die Reagan-Administration und das belastete Verhältnis zu der um vieles jüngeren Frau, der Kalte Krieg und der Krebstod eines engen Freundes: Wie die beiden legendären, 1950 und 1972 erschienenen Tagebücher verzeichnet auch das Tagebuch 3 Augenblicksnotizen neben längeren reflexiven Passagen und hebt das scheinbar flüchtig hingeworfene Notat in den Rang des Literarischen: "Es gibt in Amerika alles nur eins nicht: ein Verhältnis zum Tragischen."

Unverhofft ist er hier noch einmal zu hören, der Zeitgeist der frühen achtziger Jahre - von einem der Klassiker des Jahrhunderts: Max Frischs "Entwürfe zu einem dritten Tagebuch".
Von Wolfgang Schneider
Der alte Max Frisch wurde zum Virtuosen der Verknappung und Aussparung, er entwickelte seine Schweizer Spielart der Lakonie. Immer spärlichere Werke wurden dem Misstrauen gegenüber dem Erzählen abgewonnen. Dass sein Tagebuch aus den Jahren 1982/83 nun als Zufallsfund veröffentlicht wird, hat angesichts dieser Tendenz zum allmählichen Verstummen und Verschwinden eine gewisse Logik. Der Autor hatte den aufgegebenen Text, weil er ihn für vernichtet hielt, für Nachlassverfügungen überhaupt nicht mehr in Betracht gezogen; vor einiger Zeit wurde in den Unterlagen seiner damaligen Sekretärin eine Abschrift gefunden. So kommt der späteste Frisch auf die Nachwelt: aus dem Abfall geborgen. Lakonischer geht's nicht; vielleicht hätte ihm das sogar gefallen.
Dabei enthält dieses Tagebuch durchaus nicht nur Mäßiges und Unfertiges, sondern auch sorgfältig bearbeitete und verdichtete Texte, große Passagen wie die Phantasmagorie vom "Lebensabendhaus". Groß ist allerdings auch Frischs Unlust an Worten und Meinungen; sie hemmt die literarische Arbeit. Schon die 1982 erschienene Erzählung "Blaubart" wird hier als "Fratze" und "gekonnte Grimasse" verworfen. "Es langweilt mich jeder Satz, den ich geschrieben habe"; "Ein fast unüberwindlicher Ekel vor der Schreibmaschine"; "Ich schüttle Sätze, wie man eine kaputte Uhr schüttelt." Mit meditativer Bewunderung schaut er dagegen einem alten Handwerker beim Bauen einer Mauer zu: diese "Zärtlichkeit mit einem Stein", diese "tätige Geduld", die er selbst als Autor mit schwerem Alkoholproblem nicht mehr aufbringt.
Die Begründung, die Frisch für die versiegende Produktivität gibt, kann nicht überzeugen: "Offenbar verdränge ich, was ich durch das Alter erfahre, und deswegen habe ich nichts zu sagen." In Wahrheit hat er die Erfahrung des Alters nie verdrängt, sondern sich schon in vergleichsweise jungen Jahren darauf gestürzt. Im "Tagebuch 1966-1971" gehören die Reflexionen über das Altern zum Stärksten; bereits in "Homo Faber" erlebt sich Walter Faber als auf suspekte Weise alt im Gegensatz zu seiner übermäßig jungen Freundin. Das Alter ist ein Stück gelebter Verfremdung und das Überspielen seiner Spuren eine Komödie - von daher so ungemein produktiv für Frischs psychologische Beschreibungskunst. Auch in diesem Tagebuch blitzen bisweilen in alter Weise dialektischen Pointen auf: Warum findet man sich mit dem Verlöschen der Sexualität im Alter nicht ab? "Weil auch auf Impotenz kein Verlass ist."
Ein verlässliches Leitmotiv ist der Tod: Sei es, dass dank der Rodearbeit eines Gärtners plötzlich der benachbarte Friedhof unvermutet ins Sichtfeld rückt, sei es, dass übler Aasgeruch aus dem Tessiner Keller aufsteigt - Schaden der Kühltruhe nach Gewitter. Oder sei es ein Zwischenfall in Ägypten, auf der letzten Reise mit dem unheilbar an Blasenkrebs erkrankten Freund Peter Noll, dem Frisch hier ein anrührendes Gedenken widmet.
Die Stimmungskunst in den Beschreibungen der Nil-Landschaft kontrastiert hart mit dem Protokoll eines Siechtums zum Tode. Noll erleidet einen Zusammenbruch; Frisch bestellt ein Rettungsflugzeug aus Zürich. Makabre Szene auf dem Weg zum Flugplatz: "Der arabische Fahrer hat verstanden, dass mein Freund sehr krank ist, und fährt langsam auf der holprigen Straße, dann aber zu langsam: vor uns ein arabischer Leichenzug; der Sarg, eine Kiste aus rohem Holz, getragen von sechs Männern, wackelt inmitten einer Sippe, die singt. Kein Überholen möglich." Das ist Frisch auf der Höhe seiner Kunst.
In der Abkehr von der "allwissenden" Erzählerposition hatte er einst seine artistische Form des Tagebuchs entwickelt: als fortlaufende Bewusstseinsstudie, als literarisches Labor, wo Ideen skizziert, wo Geschichten und Formen ausprobiert werden. Damit haben diese späten Aufzeichnungen nur noch wenig zu tun. Öfter wirken sie wie eine Nachschrift zur autobiographischen Prosa von "Montauk". Dort wurde - als Gegenmodell zu Frischs schuldverstrickten Ehen - von einer zwanglosen, unkomplizierten Liebe zu einer viel jüngeren Frau erzählt. "Lynn wird kein Name für eine Schuld": dieser Satz aus "Montauk" wird jetzt zitiert und ergänzt, bezogen auf das reale Vorbild Alice Locke-Carey, mit der Frisch wechselnd im New Yorker Loft und im Tessiner Landhaus lebt (F.A.Z. vom 3. April): "Wird Alice der Name für eine Schuld?" Zumindest baut sich von ihrer Seite eine Wand aus mal stummen, mal therapeutisch beredten Vorwürfen auf: "Stunden lang spricht sie von sich aus kein Wort, sie liest, und wenn ich etwas sage, zeigt sie mit keiner Miene, ob sie es gehört hat." Er dagegen hört geduldig zu, wenn Alice ihr "Daddy"-Problem analysiert, das sie auf Frisch und sein bevaterndes "Besserwissen" überträgt. Sie nimmt teil an Gruppentherapien und Psycho-Workshops - Frisch gibt die Berichte über die Gefühlsarbeit möglichst neutral wieder und fügt dann doch nicht ohne Befremden über die amerikanische Therapiekultur hinzu: "Am besten nehme ich es als Landeskunde."
Dabei versteht er sich nach wie vor als Fürsprecher der Emanzipation, nur stellt er auch Einbußen fest: "Zu sehen ist der notorische Katzenjammer, der zurzeit viele Lebensläufe mitteljunger Frauen kennzeichnet, da sie nur Liebhabern gegenüber sich nicht als Opfer fühlen und daher unter keinen Umständen für einen Partner da sein wollen oder können." Aber noch gibt es die Momente des Einverständnisses ohne störende Worte, etwa auf einer Bergtour: "Ich kann vollkommen glücklich sein . . . Wenn sie hundert Schritte vor mir wandert, als gehörten wir nicht zusammen, und wenn sie vor sich hin singt, bis sie plötzlich wartet, um mich nach dem Namen eines grotesken Pilzes zu fragen, den ich natürlich nicht kenne . . ."
Frisch hat nie zu den großen Unzeitgemäßen gehört. Vielmehr ist es eine Qualität dieses Schriftstellers, dass er den Zeitgeist in seinen Werken akkurat gespiegelt hat, ohne in der Sackgasse des bloß Modischen zu landen. Es gibt wenige Romane, in denen man das Aroma der zweiten Moderne der fünfziger und sechziger Jahre mit ihrem Ingenieursgeist und dem neuen interkontinentalen Lebensstil so nachschmecken kann wie in "Stiller" oder "Homo Faber". In den Dreißigern war auch Frisch erfasst von Wanderburschenseligkeit; im "Tagebuch 1966-1971" schlägt sich die forcierte Politisierung nieder. "Montauk" passte in die verkaterten Siebziger, die sich der zuvor revolutionär verworfenen Literatur auf dem Weg des Authentisch-Autobiographischen ("Neue Subjektivität") wieder annäherten. Kaum erstaunlich deshalb, dass sich dann auch der Zeitgeist der frühen achtziger Jahre im Tagebuch niederschlägt: nukleare Panik.
Nichts ist allerdings so schnell vergessen wie der Weltuntergang, der nicht stattgefunden hat. Während die apokalyptische Stimmung der Jahre vor 1914 im Nachhinein sehr angebracht erscheint, wurden die kollektiven Ängste der Achtziger widerlegt vom unerwartet konstruktiven Verlauf der Historie. Heute ist das Thema so entrückt, dass Frischs Ausführungen dem Herausgeber Peter von Matt fast peinlich erscheinen: "Selbst wenn man die frühen achtziger Jahre politisch wach erlebt hat, ist man überrascht von dem vehementen Empfinden eines unmittelbar drohenden Atomkriegs und der möglichen Vernichtung der ganzen Menschheit." Offenbar hat von Matt nicht zu den Millionen gehört, die damals in Europa auf Friedensdemonstrationen gingen. Oder zu den siebenhunderttausend, die - Frisch mittendrin - im Central Park protestierten und den (womöglich durch Computerpanne ausgelösten) Atomkrieg nur noch für eine Frage der Zeit hielten.
Frischs ambivalente Amerika-Faszination weicht in Zeiten des finalen Wettrüstens dem zornigen Antiamerikanismus. "Max, you hate my country": Mit diesem Ausruf wird Alice einmal zitiert. Es ist Wut über ungezügelten Kapitalismus und imperiale Arroganz, Hohn über das maskenhafte Dauerlächeln des amerikanischen Optimismus, der so schlecht zur eigenen Verbitterung passt: "Zuversicht als Tugend und Pflicht". Das Endzeit-Bewusstsein ist für Frisch zudem der letztgültige Anlass zum Schreiben - so war es schon, als er sich ein halbes Jahrhundert zuvor der Tagebuchform zuwandte: Der einberufene Soldat verfasste unter der Drohung des Zweiten Weltkriegs "für die letzte Zeit, die noch blieb", die Notizen der "Blätter aus dem Brotsack".
Ob Frisch der Publikation des Tagebuchs zugestimmt hätte, ist eine müßige Frage. Niemand kann im Ernst fordern, neuentdeckte Texte eines Klassikers des zwanzigsten Jahrhunderts unter Verschluss zu halten oder irgendwo als Marginalie zu verstecken. Auch wenn dies kein Meisterwerk ist - jeder Leser dieses Autors ist dankbar für das Buch, für den Ton, der hier unverhofft noch einmal zu hören ist, für Sätze von unverkennbarem Frisch-Zauber, für die Momente lapidarer Schönheit, wenn das zerquälte Bewusstsein zur Ruhe kommt: "Mittage am Bach, das Wasser ist kieselklar, aber kalt, die Felsen sind warm von der Sonne und die Luft riecht nach Wald, nach Pilzen, man hört nichts als das Wasser und es gibt nichts zu denken."
Max Frisch: "Entwürfe zu einem dritten Tagebuch". Herausgegeben und mit einem Nachwort von Peter von Matt. Suhrkamp Verlag, Berlin 2010. 213 S., geb., 17,80 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Max Frischs drittes Tagebuch und der Streit um seine Veröffentlichung: Die Geschichte eines Mannes, der sich selbst entgleitet
In diesem schmalen Buch ist ein Typoskript gedruckt, auf dessen Titelseite der Autor Max Frisch notiert hat: „Tagebuch 3 Ab Frühjahr 1982 Widmung: Für Alice New York, November 1982”. Wann genau das Typoskript ins Max Frisch-Archiv in Zürich gelangt ist, weiß niemand ganz genau, es soll um das Jahr 2001 gewesen sein, zehn Jahre nach dem Tod von Max Frisch. Aber die Herkunft ist klar. Es stammt aus dem Besitz der langjährigen Sekretärin des Schriftstellers Rosemarie Pribault. Ihr hatte es der Autor diktiert, sein eigenes Handexemplar des Textes, auf Basis dessen das Diktat erfolgte, ist nicht überliefert. Er hat es womöglich vernichtet. Es ist im übrigen unklar, ob ihm klar war, dass sich ein Doppelexemplar im Besitz seiner Sekretärin befand, als er im April 1991 starb. Es gibt jedenfalls keine Verfügung des Autors darüber, wie damit zu verfahren sei.
Weil alles dies so ist, wie es ist, hat es im Max Frisch-Archiv Streit über das Buch gegeben, in dem nun das Typoskript erstmals der Öffentlichkeit vorgelegt (und kommentiert) wird. Gegen eine Publikation war nicht nur Walter Obschlager, der das Archiv bis 2008 leitete, sondern auch Rosemarie Primault, aus deren Besitz es stammt. Vor allem aber hat der Schweizer Schriftsteller Adolf Muschg noch im September 2009 in einem ausführlichen Brief an die Stiftungsräte sein Veto gegen eine Publikation eingelegt. An den literarischen Rang der von Frisch selbst zu Lebzeiten veröffentlichten Tagebücher reiche das Typoskript nicht entfernt heran. Dass Frisch es nicht ins Archiv gegeben habe, sei ein deutlicher Hinweis darauf, dass er eine ursprünglich womöglich erwogene Veröffentlichung später verworfen habe.
Dieses Schreiben hat Muschg während der Leipziger Buchmesse 2010 in der deutschen Wochenzeitung Die Zeit öffentlich gemacht und so dem Buch kurz vor seiner Auslieferung noch einmal mit publizistischem Nachdruck die Existenzberechtigung abgesprochen. Zugleich fuhr er dessen Herausgeber, dem Schweizer Germanisten Peter von Matt, vehement in die Parade. Unterstützt unter anderem vom Suhrkamp Verlag, hatte sich von Matt als Präsident der Max Frisch-Stiftung im Stiftungsrat durchgesetzt. Und er begründet dies nun im Anhang nicht zuletzt dadurch, dass er dem Typoskript einen erheblich höheren literarischen Rang zubillige als Muschg.
Nun ist aber in Fällen wie diesen die literarische Qualität des in Frage stehenden Manuskriptes nicht der entscheidende Punkt. Zu Recht werden bei bedeutenden Autoren auch die schwachen Seiten publiziert. Und jemand, der, wie Frisch schon zu Lebzeiten sein eigenes Archiv in die Welt setzt, weiß, dass was immer dort auch nach seinem Tod Eingang findet, mit der Publikation rechnen muss. Auch auf das, was er im Zwielicht der vagen Erinnerung belässt, fällt irgendwann ein Scheinwerfer.
Man mag auch ein Typoskript, das man seiner Sekretärin diktiert und mit einem neugierig machenden Titel versehen hat, vergessen. Aber wenn man auch nur den Verdacht hat, da sei etwas, sollte man ihm nachspüren und, ist man seiner habhaft geworden, das Typoskript eigenhändig vernichten. Nur so kann ein Autor, der weiß, dass er in einer Epoche lebt, in der allen Nachlassspuren nachgegangen wird, die Publikation wirksam verhindern. Wer es drauf ankommen lässt, lässt es halt drauf ankommen. Und so ist hier bei allem Streit etwas sehr Normales geschehen. Es ist ein nicht autorisiertes Manuskript separat publiziert worden, bei einem Autor, für den eine historisch-kritische Ausgabe, die dergleichen en passant aufnehmen könnte, derzeit nicht in Sicht ist.
Max Frisch gehört im übrigen zu denjenigen Autoren, deren literarisches Werk geradezu systematisch das Interesse an der Person des Autors weckt. Das Spiel mit der eigenen Biographie wie mit den in seiner Umgebung gelebten Biographien hat Max Frisch nicht nur in seinen Tagebüchern gespielt, sondern auch in seiner erzählenden Prosa, und man kann nicht sagen, dass er in der Verwertung fremden Lebensmaterials so skrupulös verfuhr, wie es nun Adolf Muschg für den Umgang mit einem Frisch-Typoskript verlangt, weil es, da literarisch belanglos, eben dies sei: Lebensmaterial.
Berühmt für die Radikalität, mit der ein literarisches Werk die Herkunft aus der Biographie des Autors demonstrativ hervorkehrt, ist die Erzählung „Montauk”, die Max Frisch im Jahr 1975 veröffentlichte. Ihr war als Motto der berühmte Anfang der Essays von Montaigne beigegeben: „Dies ist ein aufrichtiges Buch, Leser, es warnt dich schon beim Eintritt . . . ” Im Innern enthielt Montauk neben der Liebesgeschichte, die es erzählte, auch eine Beschwerde der Ehefrau des Ich-Erzählers dagegen, in ein Element der Literatur ihres untreuen Mannes verwandelt zu werden.
Die amerikanische Geliebte des Erzählers – auch sie war Teil der Experimentanordnung, in der die Literatur ihre eigene Indiskretion reflektierte – trug in „Montauk” den Namen Lynn. In der Widmung des nun veröffentlichten Tagebuch-Typoskripts, das vom Frühjahr bis zum Herbst 1982 reicht, trägt sie ihren Klarnamen Alice. Alice lebt noch und wird gelegentlich von deutschen Journalisten besucht. Im ihr gewidmeten Tagebuch-Typoskript ist sie noch die Geliebte des Autors, aber die in die Jahre gekommene Liaison ist als Liebesgeschichte nur noch ein Schatten von „Montauk”. Es hilft dieser Geschichte nicht, dass sie gelegentlich in eher peinliche Reflexionsgirlanden gewickelt wird: „Hänge ich am Leben? Ich hänge an einer Frau. Ist das genug?”
Und sie hat viele, sehr viele Rivalen. Zum Beispiel die Zeitgeschichte. Frisch schreibt, während die Engländer den Falkland-Krieg führen, Ronald Reagan den Plan zum Bau der Neutronenbombe verkündet, Helmut Kohl seine erste Aufwartung in Washington macht und die Israelis in den Libanon einmarschieren. Die Kritik an Amerika klingt manchmal so, als habe sich der bekennende Europäer zu ihr etwas pflichtschuldig aufraffen müssen, und das gilt zumal dort, wo er seinem Unbehagen haltbare Aphorismen abpressen will: „Es gibt in Amerika alles – nur eins nicht: ein Verhältnis zum Tragischen.” Weil Frisch für die 1982 befürchtete atomare Eskalation des Kalten Krieges den Begriff „Holocaust” benutzt, fallen im Rückblick die Passagen über seine Irritation angesichts der Massaker in den Flüchtlingslagern der Palästinenser auf. Hier riskiert er in der Diskussion mit jüdischen Freunden in Amerika den Vorwurf des Antisemitismus.
Einmal notiert Frisch: „ Ich bin auf Erfahrungen angewiesen, die mich begrifflich hilflos machen und von daher narrativ. Was sich nicht umsetzt ins Anschauliche, bleibt bei meiner Anlage immer uneigen.” Die schwachen Seiten in diesem Tagebuch sind vor allem diejenigen, auf denen der Autor selber diese Sätze dementiert und das Meinen sich von der Anschauung und dem Anlauf zu Erzählungen ganz ablöst.
Viele Passagen aber finden, auch ohne dass dies ein so durchgearbeitetes „literarisches Tagebuch” wäre, wie der Herausgeber Peter von Matt es gerne will, einen Ton, der die mitgeteilten Erfahrungen haltbar macht. Das gilt für die Notizen über die Abende und eine gemeinsame Luxor-Reise mit dem todkranken (jüngeren) Freund Peter Noll, der im Oktober 1982 stirbt. Und es gilt immer dann, wenn der alternde, ins Greisentum und in den Alkoholismus gleitende Mann, als den sich Max Frisch beschreibt, wieder einmal der Welt als Beobachter zuwendet und die Handgriffe von Arbeitern oder das nachmittägliche Licht beschreibt.
Nur der Eintrag, in dem der Tod des Freundes berichtet wird, ist datiert. So entzieht dieses Typoskript das Tagebuch einem Ziel des Tagebuchschreibens: dem Datum eine Physiognomie zu geben. Lesenswert aber ist es immer dort, wo es gerade nicht die Zeitlosigkeit sucht. Sondern das Zeitverfallene, und zwar nicht als Begriff, sondern als Anschauung.
Stärker als die Reflexionen über das Älterwerden bleibt daher das eigentümliche Bilderspiel in Erinnerung, das diese Aufzeichnungen beschließt. In ihnen kommt der Architekt Max Frisch dem Schriftsteller zu Hilfe, der an sich und seinen Worten mehr und mehr zu zweifeln beginnt. Dieser Architekt entwirft in Gedanken ein weißes Holzhaus mit Veranda in Neuengland, als einen Raum des Lebensabends, der sich zunehmend mit toten Freunden bevölkert. In diese Villa hinein, von der er träumt und deren Veranda zu streichen er zu seiner dringendsten Aufgabe macht, scheint der Autor am Ende zu verschwinden. Die Leserbriefe, für die er eigens einen Briefkasten hergeträumt hat, können nun kommen.LOTHAR MÜLLER
MAX FRISCH: Entwürfe zu einem dritten Tagebuch. Herausgegeben und mit einem Nachwort von Peter von Matt. Suhrkamp Verlag, Berlin 2010. 215 Seiten, 17,80 Euro.
Die matter werdende Liebes- geschichte hat in diesem Tagebuch eine Rivalin: die Zeitgeschichte
Bilder des Jahres 1982: Ronald Reagan, die englische Fahne auf den Falkland-Inseln, die Prince-Street in New York, wo Max Frisch lebte, palästinensische Frauen nach dem Massaker im Lager Sabra. Fotos: AP; Retna / Topics
Ein Autor, der den Anschein erweckt, man könne ihm beim Schreiben über die Schulter schauen: Max Frisch Foto: Bild & News
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.sz-content.de
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Mögliche Einwände gegen die Publikation von Max Frischs "Entwürfe zu einem dritten Tagebuch" werden von Martin Meyer entschieden beiseite gewischt, ist der Band doch in seinen Augen ganz klar in der Machart seiner ersten beiden Tagebücher zusammengestellt. Also sind in diesem Band, der die Zeit von Februar 1982 bis April 1983 abdeckt und hauptsächlich zwischen New York und Frischs Erstwohnsitz im Tessin angesiedelt ist, wie gewohnt persönliche Betrachtungen und Befindlichkeiten mit politischen Einschätzungen und philosophischen Betrachtungen gemischt, lässt der Rezensent wissen. Die Beziehung zur sehr viel jüngeren Amerikanerin Alice Locke-Carey, mit der er zeitweise in Manhattan zusammenlebt und Beobachtungen zu den eigenen Alterserscheinungen prägen die Notate, wobei Meyer aufgefallen ist, wie viel "Hader" und offene Abneigung gegen Amerika diesen Aufzeichnungen zu entnehmen sind. "Humor" oder "Distanz zu sich selbst" darf man von Frisch auch in diesem Buch nicht erwarten, betont der Rezensent, der beinahe erleichtert wirkt ob der wesentlich "entspannteren" Einträge aus dem Tessiner Berzona. Hier findet Meyer zu seiner Freude eine an Stifter erinnernde Sprache, "nah an den Dingen, frei, empathisch" und die ist ihm ganz offensichtlich wesentlich sympathischer als die misanthropischen Nörgeleien aus Amerika.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Das letzte Buch von Max Frisch blieb ungeschrieben. Aber ... der Entwurf zu einer letzten Wahrheit ... dieses großen Autors, der liegt mit diesem Buch vor.« Volker Weidermann Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung 20100328
»Dieses dritte Tagebuch enthält Notizen von einer Brillanz, wie man sie schon aus den ersten beiden Tagebüchern kennt. ... ein bewegendes Alterswerk, das, zu Lebzeiten veröffentlicht, ein würdiger, krönender Abschluss des Werks von Max Frisch gewesen wäre. Zum Glück lässt es sich jetzt lesen.«



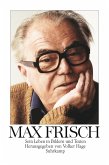

andrejr.jpg)