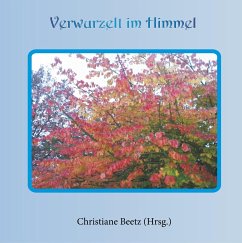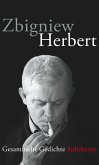Die Verse in Krügers neuem Gedichtband begeben sich ins Offene genauso wie unter die Menschen; auf Reisen, in Gesprächen scheint die Essenz des Erfahrenen auf, und den heiteren Szenen, schlaflosen Momenten, ruhigen Beobachtungen, melancholischen Einsichten, die die Gedichte spiegeln, fehlt eines nie: die Weltzugewandtheit. Krügers Lyrik läßt die Dinge sprechen, ohne dem Leser Einsichten aufzudrängen.

Gegen den Strich gedichtet: Was der Dichter zudecken möchte, decken seine eigenen Worte mitunter wieder auf. Michael Krügers neuer Gedichtband berichtet vom Eigenleben der Poesie.
Von Wulf Segebrecht
Manche meinen, Dichtung sollte / prächtig sein oder schwierig. / Ich dagegen bevorzuge / klare Aussagen in einfachen Worten, / weil so deutlich wird, was ich meine". Man könnte versucht sein, diese "Ars poetica" als Michael Krügers eigene poetische Confessio zu lesen; denn auch seine neuen Gedichte verzichten auf jede rhetorische Prachtentfaltung und auf all die herkömmlichen formalen Kunststücke des Reims, der Metrik, des Klangs. Sie vermeiden auch ausdrücklich die Unauslotbarkeiten einer hermetischen Metaphorik und wenden sich den "einfachen Worten" zu, den durchschaubaren Sätzen und den klaren Aussagen. Insofern stimmt Krüger mit der von ihm referierten Poetik überein. Doch in einem Punkt weicht er von ihr - zum Vorteil seiner Gedichte - deutlich ab: Man kann ihnen gewiss nicht nachsagen, dass ihr Verfasser die Kunst der Einfachheit und Klarheit nur mit dem Ziel kultiviert, dass "deutlich wird, was ich meine". Als bloße Meinungsäußerungen wären Krügers Gedichte gründlich missverstanden. Sie sind weit mehr.
Das hier zitierte Credo der Simplizität unterstellt Michael Krüger dem amerikanischen Autor James Laughlin (1914-1997), der, wie Krüger selbst, Lyriker und zugleich Verleger war; Laughlin gründete 1936 den Verlag New Directions in New York, in dem er die Werke von William Carlos Williams, Ezra Pound, Djuna Barnes und Henry Miller publizierte. In deutscher Sprache kann man seine Gedichte, übersetzt von Eva Hesse, in dem Bändchen "Die Haare auf Großvaters Kopf" (1966) nachlesen. In Krügers neuem Gedichtband erscheint Laughlin noch ein zweites Mal: Eine "Rede auf und mit James Laughlin", verfasst offenbar nach dem Tod des Amerikaners, bescheinigt ihm: "Du lebtest in drei Welten. / In dieser hier; / in der Welt deiner Gedanken, / die uns einschloss; / und in der Welt deiner Bücher" - damit fällt erneut eine Parallele zu dem Multitalent Michael Krüger ins Auge. Ihm liegt die Dreiwelten-These so am Herzen, dass er sie fast gleichlautend auch für den Kirchenvater Augustinus in Anspruch nimmt: "Ich lebe in drei Welten: in dieser hier, / im Schatten unter dem Maulbeerbaum; in der Welt meiner Gedanken / . . . und in der Welt der Bücher".
Die gedoppelte Formulierung am Exempel so unterschiedlicher Autoren wie Laughlin und Augustinus hat ihren geheimen, guten Sinn. Natürlich identifiziert sich Krüger weder mit dem Heiligen noch mit dem Modernen. Aber er verweist auf eine Gemeinsamkeit zwischen ihnen, in die er sich gern einbinden lässt: Tolle et lege, nimm und lies! Das ist der Auftrag, den Augustinus, seinen "Confessiones" zufolge, deutlich hörte, als er sein Erweckungserlebnis "unter dem Maulbeerbaum" hatte. Und auf die Pointe "Nimm und lies!" - freilich auf unverschämte Weise - läuft auch der böse Vorschlag hinaus, den Krüger James Laughlin zuschreibt: "Wenn ein Dichter die Geliebte / nicht herumkriegt mit seinen Worten, / sollte er das Dichten lassen / und auf die Wall-Street wechseln, / damit er sie kaufen kann". Tolle et lege - wer wollte daran zweifeln, mit dieser Formel das Motto vor sich zu haben, das Michael Krüger sich zu eigen macht und dem seine Gedichte dienen.
Leseerfahrungen, Leseprozesse, Lesesituationen begegnen dementsprechend in seinen Gedichten immer wieder. Da werden die Reaktionen einer Frau aufgezeichnet, die "In der Bahn" ein Buch, offenbar einen Trivialroman, liest; da erinnert das "Quasseln" der Vögel an das Waffengeklirr in den Epen Homers; da flüstert die Heizung im Hotel dem Gast die "Ilias" zu, und einmal wird sogar die ganze Natur - "ich bitte um Nachsicht" - als Dichterin gelesen, deren Gedicht mit allem ausgestattet ist, was dazugehört, also mit dem Reim, dem Enjambement und den besagten "einfachen Worten: Hase, / Eule, Knöterich, Gewitter, Ulme, ich". Allerdings muss die "Natur als Dichterin / . . . die Erfahrung machen, / dass ihre einfachen Worte ein eigenes Leben / führten und oft sagten, was ihr, der Natur, / gegen den Strich ging".
Der Naturentzifferer Krüger ist kein Naturlyriker reinsten Wassers. Ihn interessiert die Frage nach der Möglichkeit einer Deutung der Naturphänomene mehr als die geduldige Abschilderung der Naturphänomene selbst. Es ergeht ihm so, wie es, seiner Darstellung zufolge, wiederum James Laughlin erging: "er musste feststellen, / dass die Worte ein eigenes Leben führten / und oft sagten, was ihm gegen den Strich ging". Auch hier verweist die wiederholte Formulierung auf das Gewicht, das diesem Befund zukommt, wonach die Worte wie die Naturphänomene eine gewisse Autonomie besitzen und sich sogar gegen den Autor selbst wenden können, der sie anschaut oder verwendet.
Die Erfahrung, dass man der Wörter nicht gänzlich habhaft werden kann, begünstigt den zurückhaltenden Umgang mit ihnen, sie befördert ein unaufwendiges, pathosfreies, taktvolles Sprechen, ein Reden unter Vorbehalt. So, "unter freiem Himmel", nicht im Ton der akademischen Seminare, redet Michael Krüger in seinen Gedichten. Nichts gilt uneingeschränkt, keine politische Überzeugung und kein noch so kluges Systemdenken kann Allgemeingültigkeit für sich beanspruchen; selbst die Position eines aufrichtigen Liberalen beschreibt ein Gedicht als "Flucht vor den Liberalen", und die "Rede auf den Tod von Niklas Luhmann" gerät geradezu zu einer parodistischen üblen Nachrede, wünscht sich aber zugleich sehnsuchtsvoll und ironisch eine "warme hermeneutische Decke" herbei, unter der die "Theorie als Passion" geträumt werden kann.
Ob es, in den meditativen Naturgedichten, um die Enten, Molche und Kirschen geht; oder im anschließenden "Gespräch mit den Freunden" um die lieben Dichterkollegen; in den autobiographischen Gedichten um den Großvater, die Schule und das Dorfkino; oder schließlich in den "Reden" um das Orakel von Delphi und um andere letzte Dinge - stets gibt Krüger zu denken und befördert die Nachdenklichkeit seiner Leser. Er ist, mit Verlaub, ein Gedankenlyriker, freilich ein solcher modernen Zuschnitts. Seine Kunst besteht darin, über das, was wir zu verstehen glauben und doch zuletzt nicht verstehen können, in verständlicher Sprache zu reden. Denn seine Gedichte verbinden oft eine Beobachtung, eine Situation, eine kleine Geschichte oder Anekdote mit einem im poetischen Bild kaum versteckten Gedankengang, der dann zumeist in eine unauflösbare Frage, eine Ausweglosigkeit, eine Rätselhaftigkeit, eine Vergeblichkeit einmündet. Es herrscht ein skeptischer, sanft melancholischer, resignativer Grundzug in seinen Versen. "Meine Erinnerung trägt", heißt es am Ende der schwarzgalligen "Rede des Saturnikers", "einen sternenbesetzten Mantel, / der deckt alles zu, auch die Liebe", der man doch ihrerseits gern bibelfest nachsagt, sie decke alles zu.
Entzauberungen solcher Art finden sich aber nicht nur in dem mit "Reden" überschriebenen vierten Teil des Gedichtbandes; schon die "Meditationen unter freiem Himmel", die ihn als Zyklus von 23 Gedichten eröffnen, führen angesichts von Naturbeobachtungen zu Relativierungen, wenn nicht gar zu Aufkündigungen der großen menschlichen Ideen, Werte und Verbindlichkeiten: Der Glaube, die Wahrheit, der "Schöpfer des Universums", die Zeit, die "philosophischen Fragen" geraten in das Magnetfeld der Desillusionierung, auch die Hoffnung auf zunehmende Selbsterkenntnis: "Gottlob haben wir nur eine schwache Ahnung / von dem, was wir sind, das wäre das Ende", lesen wir da und - das sind die letzten Worte des Zyklus -: "zu viel / geht zu Ende, zu wenig beginnt".
Von einer Fußwanderung "durch Italien" berichtet Krüger: "Ich habe nichts erlebt". Dann aber heißt es: "Übrigens las ich beim Gehen / Ungarettis kurze Gedichte, / bis sie sich aufgelöst hatten / in meinem strahlenden Glück". Eine schönere Leseempfehlung für Gedichte läßt sich kaum denken. Tolle et lege!
- Michael Krüger: "Unter freiem Himmel". Gedichte. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2007. 122 S., geb., 19,80 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Natur zur Sprache bringen: Michael Krügers neue Gedichte
„Die Natur, ich bitte um Nachsicht, / schreibt ein Gedicht,” heißt es in dem schönen neuen Gedichtbändchen „Unter freiem Himmel” von Michael Krüger. Wie das 2003 erschienene Buch „Kurz vor dem Gewitter”, dem es nicht nur äußerlich ähnelt, enthält es vier Teile, diesmal mit Überschriften: „Meditationen unter freiem Himmel”, „Im Gespräch mit den Freunden”, „Über die zu kurzen Reisen” und schließlich „Reden”. Darin finden sich überall und besonders im ersten Teil viele Gedichte mit Bezug auf das, was man gern die Natur nennt, und gleich auf den ersten zehn Seiten begegnen uns „unter freiem Himmel” hustende Rehe, Mohn, Lavendel, Maulwürfe, Bienen, Vögel, Sonnenblumen, Tannen, Turmfalken und ein Pirol.
Kann man die Natur schreiben lassen, als ob sie selber eine Sprache hätte, die wir nur zu lernen brauchen, eine Sprache, die sich noch dazu in unsre übersetzen lässt? Die Antwort ist klar. Das Gedicht der Natur, heißt es, „benutzt einfache Worte: Hase, Eule, Knöterich, Gewitter, Ulme, ich. (Aber auch die Natur als Dichterin / mußte die Erfahrung machen, / daß ihre einfachen Worte ein eigenes Leben / führten und oft sagten, was ihr, der Natur, / gegen den Strich ging.)”
Die Natur spricht ja nicht, und noch weniger dichtet sie. Und wenn der Dichter ihr Worte in den Mund legt, ist er schon nicht mehr auf ihrer Seite: „. . . bleibe stumm, / denn wenn du den Dingen Worte leihst, / sprichst du nur noch von dir selbst.” Das Eigenleben der Wörter ist die unausschöpfbare Quelle von Michael Krügers Poesie, wo Worte und Dinge sich gegenseitig erleuchten, aber auch verfinstern können: „Ein Komet wird wieder sichtbar – / hell (wie ein lange vermißtes Wort)”.
In „Kurz vor dem Gewitter”, gibt es eine Skizze über den Botaniker August Garcke (Krügers Urgroßonkel). Das geduldige Beobachten der Natur, hier in Gestalt der ungezählten Formen (und Namen!) des Pflänzleins Ehrenpreis, faszinierte den Dichter. Auch diesmal erweist er einem Naturforscher Ehre. Es ist der fromme Darwinist Jean-Henri Fabre, von dem er ein unscheinbares Motto zum ersten Teil („Meditationen unter freiem Himmel”) entlehnt: „Beobachten, das ist immerhin schon etwas, aber das reicht nicht aus.” Es reichte dem Jean Henri Fabre so wenig aus, dass er auch selber in seinem provenzalischen Heimatdialekt zu dichten anfing. Klang das nicht mehr nach Zikaden, Fröschen und Eseln als das akademische Französisch? Mit Parallelen zwischen der Natur und dem Menschenleben geizt er nicht, und doch rückt die Natur in immer größere göttliche Ferne, je mehr er sie studiert. Für den Forscher hält sie seit Ewigkeiten Antworten bereit, lange ehe er seine Frage gestellt hat, aber sie spricht die Antworten nicht aus. Je einfacher und je poetischer die Wörter, desto empfindlicher scheinen sie der Natur gegen den Strich zu gehen.
Gehören sie dann wenigstens den Dichtern? Keineswegs! Zum Thema „Das Leben der Wörter” gibt es noch eine kleine Skizze. Sie spricht über James Laughlin, den amerikanischen Dichter, der wie Michael Krüger auch ein berühmter Verleger war: „Später wollte er / selber schreiben. Aber er mußte feststellen, / daß die Worte ein eigenes Leben führten / und oft sagten, was ihm gegen den Strich ging.” Man kann ihnen ja nicht blind vertrauen, man muss ihr Vertrauen gewinnen, ihr Leben und ihr Vorleben achten, vor allem ihre poetische Vergangenheit, ihre verdiente oder unverdiente Aura. Man muss genau wissen, welche Aufgabe sie im Gedicht erfüllen sollen, und man muss ihre Zustimmung dafür einholen.
Wenn das gelingt, sind sie freilich ganz bei der Sache und doch ganz sie selbst. Michael Krüger ist der ehrliche Makler, der es versteht, die Wörter für seine Pläne zu begeistern. In einem meisterhaften Kurzschluss bringt er zum Beispiel die Krähen in sein „Septemberlied”: „Krähen, wie mit Blei gefüttert, / fallen auf die Straße. / . . . / Wollen wir umkehren? / An den sauertöpfischen Krähen vorbei, / nach Hause, am Zuhause vorbei?” Das Blei, mit dem sie gefüttert sind, ist auch die poetische Last, die sie tragen, seit sie in Nietzsches „Vereinsamt” „schwirren Flugs” zur Stadt ziehen: „Weh dem, der keine Heimat hat.” Krügers Krähen verleugnen nicht ihre Vergangenheit, aber sie sind doch nicht Nietzsches Krähen.
Jedesmal, wenn das Wort auftaucht, bringt es seine poetische Geschichte ein, und ist doch wieder ganz und gar neu und nur es selber: „kaltäugige Bussarde und zerfetzte Krähen” im Gedicht „Ahnung des Gewitters”, „eine Krähe hält mir / den Tod vom Leib” in „Der Apfelbaum”, und wiederum im Zusammenhang mit dem Zuhause: „Auf dem Heimweg, der nicht nach Hause führt, / weil sich das Haus, das eng bemessene, / einen anderen Mieter suchen durfte, sah ich / den Krähen zu, die mit weiten Schwüngen / ihr schwarzes Epos in den Abend schrieben.” Ein „schwarzes Epos”, in dem die Krähen, Dohlen und Raben zu Hause sind, ist jenes erstaunliche frühe Denkmal russischer Poesie aus dem 12. Jahrhundert, das unter dem Namen Igorlied bekannt ist.
Daran braucht man nicht zu denken, und niemand würde vielleicht daran denken, wenn Michael Krüger sich nicht schon einmal vor etwa zwanzig Jahren („Weit hinter Prag”) von der kunstvollen Poetisierung der Natur in diesem großen Werk hätte inspirieren lassen: „Und nicht zum Guten fallen die Blätter ab von den Bäumen” hieß es da (in Rilkes Übersetzung), in Kursivdruck als Zitat kenntlich gemacht.
Michael Krüger lässt nicht die Natur dichten. Es gelingt ihm aber immer wieder scheinbar mühelos, die Worte anzuheuern, welche Natur, Welt und ihn und uns selber zur Sprache bringen. Das ist stärkend, denn „was nicht zur Sprache kam, / verwelkt lange im Schatten”. Theoretisch und poetisch zugleich versucht er, zu sagen, was Gedichte auch heute noch können: „ . . . zu sich selber sprechen / in einer Sprache, die ihnen nicht gehört, / in der wir uns selbst nicht vergessen.”
Das letzte Gedicht heißt „Post” : „ . . . ,teilen wir Ihnen mit . . . daß bestimmte / Worte (siehe Rückseite) zurückgegeben werden müssen.‘ / Ich trug sie zusammen, die Leihgaben / . . . ”. Aber dann bäumt er sich auf: „Nein, ich gebe sie nicht zurück. Am Abend / werde ich sie unter Disteln vergraben, / wo sie keiner vermutet. Es geht darum, / eine Botschaft zu hinterlassen, die keiner / versteht” – außer uns natürlich, die wir dem Selbstgespräch der Gedichte zuhören und wissen, wo die Wörter vergraben sind.HANS-HERBERT RÄKEL
MICHAEL KRÜGER: Unter freiem Himmel. Gedichte. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2007. 118 Seiten, 19,80 Euro.
„Er mußte feststellen, / daß die Worte ein eigenes Leben führten / und oft sagten, was ihm gegen den Strich ging.”
Michael Krüger, ein ehrlicher Wort-Makler Brigitte Friedrich
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Eine Dienstleistung der DIZ München GmbH
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
In höchsten Tönen lobt Rezensentin Beatrice von Matt Michael Krügers neuen Lyrikband, in dem sie selbst noch die Vögel so dramatisch von Selbstverteidigung, von Krieg und Verrat " quasseln" hört, dass sie an Homer denken muss. Auch sonst faszinieren sie Krügers Gedichte durch ihre Ausdeutung der Natur, insbesondere Krügers Talent, in ihren Rhythmus "einzugehen", wenn er sich etwa in der Mittagshitze der Stille und der Müdigkeit überlasse, und so "begnadete Momente" zu schaffen versteht, in denen dann Erinnerungsfetzen hochbrodeln. Aber auch die Dezenz, mit der Krüger Natur, Erfahrung und Geschichte ineinander webt, sorgt für enormen Eindruck bei der Rezensentin.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Stets gibt Krüger zu denken und befördert die Nachdenklichkeit seiner Leser. Er ist, mit Verlaub, ein Gedankenlyriker, freilich ein solcher modernen Zuschnitts.« Wulf Segebrecht Frankfurter Allgemeine Zeitung