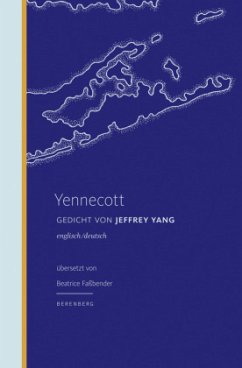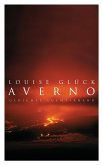"Yennecott / nannten die Corchaug / diesen Ort" - einen Ort, der heute östlich von New York auf Long Island liegt und der zum Ausgangspunkt für Jeffrey Yangs Reise in die Anfänge der Vereinigten Staaten wird. In einer kunstvollen Verflechtung aus Poesie, Mythos und Historie berichtet Yang von europäischen Siedlern und nordamerikanischen Ureinwohnern, deren Geschichte - und Geschichten - fortan untrennbar voneinander verlaufen sollten.Urahnen / am ersten Ort / Gedenken im Namen / dieser Ort ihr Grab / - kein Geist kein Schreiber - // Könnten Meere sprechen / Sterne berichten / Blut Zeit begleichen // Morgenlicht Fels / beleben / Geschichte // dann, vielleicht // (chippapuok)Jeffrey Yang, geboren 1974 in Kalifornien, ist Dichter, Übersetzer aus dem Chinesischen - darunter Liu Xiaobo und Bei Dao - und Lektor. Für "Ein Aquarium" (Berenberg 2012), seinen ersten Gedichtband, wurde er mit dem PEN / Osterweil Award for Poetry ausgezeichnet. "Ein höchst bemerkenswerter Band" schrieb Manfred Papst in der NZZ, "Yangs Verse sind von hoher Musikalität und poetischer Schönheit." Yang lebt in Beacon, New York.
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Keinen Pocahontas-Kitsch bekommt Nico Bleutge mit Jeffrey Yangs Langgedicht. Für den Rezensenten reiht sich der Autor ein in eine Traditionslinie mit Walt Whitman und Gary Snyder. Dass der Text für Bleutge als sprachlich avancierte Gegenbewegung zur Geschichtsschreibung weißer Siedler auf Long Island, als Anteilnahme am Schicksal der indianischen Einwohner und Erkundung der Schichten historischer Gründungsakte und poetischer Strategien funktioniert, liegt an dem Netz aus Korrespondenzen (zu Melville, Dickinson, Majakowski, Mythen und Reiseberichten), das der Autor webt, und an seiner sprachlichen Kraft, laut Bleutge kongenial übertragen von Beatrice Faßbender.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Jeffrey Yangs Langgedicht „Yennecott“ reflektiert amerikanische Siedlungsgeschichte – aus poetischer Perspektive
Die Geschichte, hat der amerikanische Dichter Kenneth Rexroth einmal angemerkt, setze sich immer nur aus den kleinen Dingen zusammen. Begegnungen, Momente, manchmal kaum spürbar – und irgendwann sind sie zu unserer Erzählung geworden. „Der lange Schmerz der Geschichte“, wie Rexroth schreibt, „ist zu viel für mich.“ Auch bei Jeffrey Yang sind es die Einzelheiten, die am Anfang stehen: Blockhütten, Pfosten, eine „straff gespannte Kette“. Doch bald schon öffnet sich der Blick, und die Zeiten vermischen sich: „Eben noch im Binnenland / mit einem Mal von Meer / umgeben / Licht // lockt / Vergangenes hervor am / Vergessen vorbei.“
Vielleicht sammelt das Gedicht die Erinnerungen auf, in einem Zustand, der dem Traum ähnelt, und erst in einem zweiten Schritt erfolgt eine Art Deutung, das Bündeln der Phänomene zu einer bestimmten Sicht. Jeffrey Yang, 1974 in Kalifornien geboren, kennt diesen Zustand allzu gut, verbindet die Erinnerung aber mit dem Wissen. „Anemonen sind Krieger“ hat er in seinem Debütband „Ein Aquarium“ von 2008 (dt. 2012) geschrieben, einem bildstarken Wörterbuch der Meereswesen und Fachsprachen, in dem er noch aus der kleinsten Beschreibung einen Faden Erkenntnis hervorzaubert. „Die Geschichte / der Welt wird erzählt aus der Sicht / des Siedlers“.
Nicht von ungefähr hat Yang darin auch Kenneth Rexroth ein kleines lyrisches Porträt gewidmet. Neben der Liebe zur Geschichte teilt er mit ihm die Lust am Übersetzen und an der theoretischen Beschäftigung mit Literatur. Darüber hinaus arbeitet Yang als Lektor für Verlage in New York. „Yennecott“, ein Langgedicht von mehr als 50 Seiten, das die Übersetzerin Beatrice Faßbender seinem Gedichtband „Vanishing-Line“ (2011) entnommen hat, ist so etwas wie die Gegenbewegung zu jener Vorstellung von Geschichte, die aus der Perspektive der Siedler gezeichnet wird. Yang tastet darin den Vergangenheitsspuren auf Long Island nach. Seine Zuneigung gilt nicht etwa den Entdeckern, er zeigt einen Prozess der „Besitznahme“, der die indianischen Einwohner verdrängt, den Ort, den sie „Yennecott“ nennen, nach und nach in einen Ort der Zerstörung und Sklaverei verwandelt, oft im Namen von Religion und Kirche.
„Quer durch die Jahrhunderte“ geht der Blick. Das meint nicht allein die zeitlichen Schichten, die das Gedicht vor uns aufruft, von einer historischen Notiz aus dem Jahr 1069 über die Gründung der Vereinigten Neuniederland-Handelskompanie im Jahr 1614 bis zur Ankunft des sprechenden Ichs auf der heutigen Insel: „Auf Nebenwegen, Pfaden / durch verschlungenes Grün / zu einer Reihe Blockhütten / in denen früher Maurer lebten / verpflanzt / entlang der Küste“. Es meint auch die poetischen Strategien, mit deren Hilfe Yang die Erinnerungssuche und das „Gedächtnis“ zum eigentlichen Metier des Dichters macht, nicht zuletzt, um jene begrenzte Sichtweise, wie sie etwa der Geschichtsschreibung zukommt, zu übersteigen.
So setzt er den zahllosen historischen Quellen, die er verwendet – Ausschnitten aus Reiseberichten, Tagebüchern, Briefen und sogar juristischen Texten –, indianische und europäische Mythen gegenüber. Vor allem aber schiebt Yang immer wieder Zitate anderer Autoren zwischen die Zeilen, auf dass ein Netz von Korrespondenzen entstehe, das so unterschiedliche Stimmen wie jene von Herman Melville, Emily Dickinson, Joseph Roth oder Wladimir Majakowski umfasst. „Yennecott“ lebt von einer Technik der Montage. Dazwischen blendet er immer wieder in die Gegenwart, folgt der suchenden Stimme zwischen „Flohkraut“ und „eleganten Anwesen“.
Die Kunst zeigt sich hier im Schnitt. Neben der sprachlichen Eigenkraft, die den einzelnen Stoffen zukommt, gelingt es Yang, Töne zu brechen oder ihre rhythmische Energie zu bündeln. Auch kann er durch die geschickte Reihung manche historische Erscheinung, Techniken der Unterdrückung etwa oder glatten Betrug, kritisch reflektieren, ohne zu direkten Aussagen greifen zu müssen. Allerdings hat eine solche Materialkunde auch ihre Gefahren. Bisweilen nennt Jeffrey Yang die geschichtlichen Ereignisse eher, als dass er sie tatsächlich in die Form seiner wechselnden Rhythmen einschmelzen würde. An diesen Stellen, etwa wenn er über fast zwei Seiten hinweg einen Vertragstext mit dessen strenger juristischer Diktion ausbreitet, droht sein Langgedicht zu zerfasern.
Und etwas Zweites setzt der poetischen Suchkraft der Zeilen zu. Immer wieder löst sich Yang von der Erinnerungswelt Long Islands und versucht, die zahllosen Eroberungszüge auf dem amerikanischen Kontinent kurzzuschließen. So landet er nicht nur bei allzu groben Verallgemeinerungen, sondern deutet seine Beobachtungen in diesen Fällen auch direkt, entwirft Kommentare wie „Krieg / genannt Unfall“ oder „eine Geschichte der Verwüstung“.
Am stärksten ist Jeffrey Yang dort, wo er die Suchbewegung als solche inszeniert und mit einer Sprache sinnlicher Details verknüpft. Wobei ein festes „Ich“ meist nur als Zitat auftaucht. Eher ist es eine Art von Wahrnehmungsbewegung, die Yang vor uns auffaltet, eine Mischung aus „ungesagten / Gedanken“ und dem „Gehen als Erlebnis“, verwandelt in die poetischen Möglichkeiten von Rhythmus und Klang: „Meeresfalten, wellengrau / Strömung kreist, streift / Kruste, weicht zurück“.
Beatrice Faßbender hat diese Klangfächer in ihrer Übersetzung sehr gut eingeholt. Sei es, dass sie Lautmalereien direkt nachbildet, sei es, dass sie jene Stellen, an denen Yang Bedeutung, Klang und Wortgeschichte verschränkt, in einer anderen Lautreihe aufbaut. Manchmal verschiebt sie Yangs Ton ein klein wenig, ohne dass ein Grund erkennbar wäre, wenn sie zum Beispiel „to filter“ mit „seihen“ übersetzt oder „Mosquitos sucked“ mit „Mücken schlürften“ (statt das plausiblere „saugten“ zu wählen). Umso genauer trifft die Übersetzung den Duktus der Quellen aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Mit einem hellwachen Ohr für die historischen Schichten der Sprache schreibt Yang die Tradition des amerikanischen Langgedichts fort, von Walt Whitmans „Leaves of Grass“ bis zu den Landschaftserkundungen eines Robinson Jeffers oder eines Gary Snyder. „Yennecott“ ist ein vielstimmiges Gebilde voller Wortlust und leuchtendem „Muschelglas“. Und ein gutes Gegenmittel zu jener Art von Pocahontas-Kitsch, wie ihn zuletzt Terrence Malick in seinem Film „The New World“ gezeigt hat.
NICO BLEUTGE
Jeffrey Yang: Yennecott. Gedicht. Zweisprachige Ausgabe. Aus dem Englischen von Beatrice Faßbender. Berenberg Verlag, Berlin 2015. 116 S., 19 Euro.
Das Gedicht lebt von
der Montage. Die Kunst
zeigt sich im Schnitt
Liebe zur Geschichte, Lust am Übersetzen: Jeffrey Yang.
Foto: University of Arizona
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de