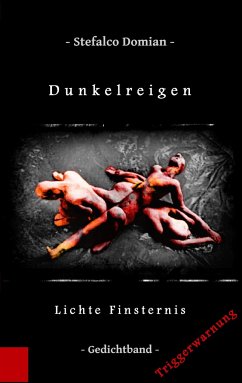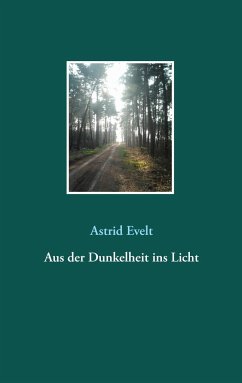'Mitschrift des Sommers' heißt der schöne geduldige Zyklus, der diesen Band abschließt und der entstanden ist während eines längeren Aufenthalts der Autorin in einem Frauenstift. Ihn durchziehen die Wärme und das Blühen der Jahreszeit, die gesteigert sind durch die Stille, wie die Klosterregel sie will. Sie führt zu einem gelassenen Für- und Bei-sich-Sein, das zugleich aufmerksam macht für die Geschichte des Ortes, die auch die Geschichte jener Frauen ist, die dort zuhause waren, bis sie im Klosterfriedhof ihre endgültige Ruhe fanden. Ursula Krechel, die zuletzt mit dem großen historischen Roman 'Shanghai fern von wo' ihr episches Können vorgeführt hat, kehrt in diesem Buch einstweilen zurück zum Gedicht. Zwischen winterlichen Bildern der Erstarrung und Tagen, 'als hätte jemand / du vielleicht oder ein schüchterner Glückspilz / mit einem großäugigen Würfel die richtige Zahl getroffen', entfaltet Ursula Krechel mit kluger und hellwacher Aufmerksamkeit - und bisweilen nicht ohne hintersinnigen Humor - ihr Wissen darüber, wie das, was einst 'Erdenwandel' genannt wurde, dahingeht.

Wie Buchstaben sich entzünden: In ihrer Lyrik vollzieht Ursula Krechel eine Wende zur metaphysischen Poesie. Der Aufenthalt in einem Frauenstift veranlasst sie zu der Frage, ob Gedichte eigentlich schweigen können.
Für "Shanghai fern von wo", ihren Roman, der die Schicksale deutscher Juden im Schanghaier Exil beschreibt, hat Ursula Krechel allseitige und verdiente Aufmerksamkeit gefunden. Sechs Literaturpreise gingen an die Autorin, darunter der renommierte Breitbach-Preis. Wenn dessen Jury die "lyrische Evokationskraft" des Romans lobte, dann erinnerte sie daran, dass Ursula Krechel vor allem Dichterin ist, Lyrikerin.
Ihr Gedichtband "Jäh erhellte Dunkelheit" rückt das erneut in den Blick. Sein Titel evoziert das epiphanische Moment von Poesie, nämlich ihre Fähigkeit, die Welt in unserem Bewusstsein aufleuchten zu lassen. Er markiert eine neue, wichtige Station in der Entwicklung dieser Autorin. Vielleicht zu dem, was die Engländer "metaphysical poetry" nennen. Auf jeden Fall zu einer Wendung.
In ihren frühen Gedichtbüchern "Nach Mainz!" (1977) oder "Verwundbar wie in den besten Zeiten" (1979) sympathisierte Krechel mit dem Projekt einer radikalen Aufklärung. Jetzt, dreißig Jahre später, spricht sie eher von Zweifel und Skepsis. In ihrer Breitbach-Dankrede fragte sie: "Gibt es einen Weg, der kein rhetorischer ist, aus der Dunkelheit des Wissens zum Kern des Poetischen? Gibt es Erkenntnis aus der Dunkelheit, gibt es Verstehen?" Man spürt das Tastende dieser Fragen und begreift, dass ihre neuen Gedichte auf Antworten verzichten, die nur rhetorisch sein könnten.
Krechel setzt sich als Wegmarke Zeilen von Genadij Ajgi: "Und dort, wo wir standen, / bleibe ein Leuchten / zurück - unsrer Dankbarkeit." Ihr Buch beginnt mit Erkundungen des Terrains, mit Texten, die man Essay-Gedichte nennen möchte, weil sie Schilderung und intellektuellen Diskurs miteinander verbinden. So handelt "Winterkampagne" von Krieg und Rückzug und den Schrecken der Kälte. Obwohl es Hitler zitiert, ist es kein historisches Gedicht über den Russland-Feldzug. Es sucht jene strukturelle Wahrheit, die in der Sprache beschlossen ist. Intertextuell erinnert es an Brodskys "Verse von der Winterkampagne". Ähnlich verweist "Schneepart Hoffart" auf die späte Lyrik Paul Celans. Manchmal verdichten sich die Anspielungen zu veritablen Zitat-Collagen. So in dem langen Gedicht "Dramatische Praxis, Theorie mit Pelzbesatz", darin sich Szondi, Diderot und andere in ernsten Theatermotiven verstricken.
Die Gestalt erledigt bekanntlich das Problem. In einer Folge heiterer Gedichte erleichtert sich die Autorin in Pastiches, die Huldigungen an Kollegen sind. In "Kantilene, Abschiedsszene", einem Gedenkgedicht für Oskar Pastior, spielt sie sich mit kecken Reimen ins Freie: "wie Buchstaben sich entzünden / wie sie sich finden, Ströme münden / Wasser füllt kein Sieb aus guten Gründen". Hier nimmt sie Motive auf, mit denen sie einst in den Kinder- und Nonsense-Gedichten von "Kakaoblau" entzückte.
Spielerisch agiert auch die Erzählerin. "Mein Balladenladen ist heute geöffnet", heißt es einmal. Dieser Ankündigung folgen traurig-komische Stücke, quasi linguistische Moritaten. Sie umkreisen in diversen Nummern "Das Ende vom Lied". In einer erscheint der Schneider, der die Kleider mit einem "Scherenschnitt" zertrennt und notdürftig zusammenflickt, als Wiedergänger des Dichters als traurige Gestalt. Da hilft nur die makabre Lustigkeit: "Als Heiterkeit nicht mehr gelang / ein Knallen war es, als sie zersprang".
Krechel hat einen speziellen Sinn für die Zerbrechlichkeit. Sie setzt auf das Paradox: Zersplittern ist Gelingen. Sie vertraut - mit einem schönen Kalauer - auf "Grammaire - ma mère". Von ihr angeleitet, beugt sie ihre Knie vor einer Vaterfigur wie H.C. Artmann. "Artmann, Artista" ist - wieder mit einem Wortspiel - ein Art-Man, ein Mann der Kunst. Ihm erweist sie Reverenz: "Es spricht niemand, Die Gedichte schweigen / Nein, wiederum, man muss sich tief verneigen."
Wie können Gedichte schweigen? Auch Ursula Krechel kennt das Chandos-Problem, kennt die Verführungen der Sprache. Doch sie wählt nicht das Schweigen, sondern - wie sie in ihrer Breitbach-Dankrede sagt - die "ausgehaltene Sprachlosigkeit". Diese hat ein meditatives, ein metaphysisches Moment. Es scheint im dritten, dem schönsten Teil ihres Buches auf.
Der Zyklus "Mitschrift eines Sommers" ist das Resultat eines Aufenthaltes in einem Frauenstift. "Vorläufig der Welt entzogen", wird ihr dieser hortus conclusus zu einer epiphanischen Sphäre. Das ausgeruhte und erfrischte Sehen verspricht "Geistausgießen, o überwach hell / Meine vergrößerte Wahrnehmung". In der klösterlichen Ordnung empfindet das lyrische Ich ein "Übermaß von Ewigkeit, dem / Keine Gegenwart standhält". Ja, das meditative Hinhören auf den eigenen Atem scheint die Möglichkeit einzuschließen, dass aus dem Schweigegelöbnis "nahrhaftes Gedichtbrot" entsteht.
Wie nahrhaft ist dieses Brot? Es kann nur Metapher sein, wenn man will: Gleichnis. "Mitschrift eines Sommers" ist nicht religiöses Bekenntnis - der Zyklus ist das Protokoll einer Erfahrung. Ursula Krechel, die Agnostikerin, hat eine Erfahrung gemacht: Die Dunkelheit kann sich jäh erhellen. Sie versucht, in dieser Dunkelheit die Augen offen zu halten. Sie versucht davon zu sprechen. Sie weiß: Chorfrauen und Stiftsdamen haben ein verschwiegenes Erbe. "Auch ich schwiege", bekennt sie, "wenn ich nicht schriebe." Aber sie schreibt ja, wir lesen es und danken es ihr. So schreibend erscheint ihr die Religion weiterhin als eine prekäre, der Geschichte unterworfene Sache. Der Glaube - versichert uns der Schluss des schönen Bandes nicht ohne Ironie - ist "eine pikierte Pflanze / Die andere Blüten treibt". Zum Beispiel Blüten der Poesie, die in der Dunkelheit aufleuchten.
HARALD HARTUNG
Ursula Krechel: "Jäh erhellte Dunkelheit". Gedichte. Verlag Jung und Jung, Salzburg und Wien 2010. 103 S., geb., 20,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Der neue Gedichtband von Ursula Krechel leistet Widerstand gegen die Ohnmacht der Sprache
„Das Gedicht muss keinen Gegenstand haben, es ist selbst ein Gegenstand“, behauptet Ursula Krechel in ihrem schönen poetologischen Buch „In Zukunft schreiben“ (2003). In den Gedichten, die sie in mehr als dreißig Jahren veröffentlicht hat, ist dies eine Konstante: die Bemühung, nicht von einem Gegenstand auszugehen, sondern einen Gegenstand zu „erdichten“. Das leistet schon das erste Gedicht in ihrem ersten Band „Nach Mainz“ (1977). Es heißt „Meine Mutter“ und besteht aus zwei Blöcken. Der erste Block beschreibt ein Mutterschicksal, das man als biographisch real lesen darf: „Als meine Mutter ein Vierteljahrhundert lang / Mutter gewesen war . . . fraß sich ein Krebs / in ihre Gebärmutter, wuchs und wucherte / und drängte meine Mutter langsam aus dem Leben.“ Der zweite Block beginnt: „Zehn Tage nach ihrem Tod war sie im Traum plötzlich / wieder da.“ Das ist ein altes Klischee und ein poetisches Fundstück: Es gibt der Mutter das Leben, diesmal ein eigenes, erotisch getöntes: Sie fährt lachend zwischen zwei Jungen sitzend in einem alten Auto davon. Als wollte sie verschämt eine Träne der Rührung über diesen Traum aus den Augen wischen, fügt die Dichterin eine Pointe an: „An der Haustür könnte ich mich ohrfeigen. / Nicht einmal die Autonummer habe ich mir gemerkt.“ In einer Sammlung der besten Gedichte feministischer Inspiration dürfte dieses nicht fehlen!
Im neuen Gedichtband „Jäh erhellte Dunkelheit“ begegnen wir wieder dieser Mutter. Sie „liebte die weißen Männer . . .“, den Tennisspieler Gottfried von Cramm und den Nuntius Pacelli in der Wochenschau. Kein Traum kommt diesmal dem Sinn zu Hilfe. Das Weiß des umschwärmten Sportlers und das Weiß des verklärten Würdenträgers mischen sich; formelhafte Fragmente dringen ein, die Syntax zerfällt: „nieder / kniete meine Mutter hielt ihren gläubigen / Blick hielt den Segen aus und weiter / Weiß sie Schwarzes blieb schwarz und / Schweiget o mein Vater das Geröll aus / Den Wiesen steiget und blieben immerdar /Im verschlossenen Gemüt und die Sieger / Unter sich“. Solche zerriebenen Motive und Zitate ergeben keine resümierbare Botschaft, sie schicken ihre Leser in eine Gedicht-Welt, die konstruiert werden möchte.
Auch die „Winterkampagne“ mit dem Refrain „Das sind ganz normale Verluste“ erinnert an Früheres, an den Kriegszyklus „Stimmen aus dem harten Kern“ von 2005. Poetische Stilmittel haben hier noch eine traditionelle rhetorische Funktion. So fächert sich das Bedeutungsspektrum des Verbs „schlagen“ auf: „Flügelschlagen. Mit den Armen um sich schlagen. Geschlagen.“ Alliteration und Gleichklang unterstreichen Bilder: „Krähen krächzen, kreisen um den Spähtrupp“, „Nasenrot. Lippenrot. Ohrenrot. Tot.“ Die Materialität der Sprache, ihr Lautmusik- und Schriftbildcharakter hat die Lyriker des vorigen Jahrhunderts fasziniert, auch Ursula Krechel, die schon 1985 „Unica Zürn zu Ehren“ und nun „Kantilene, Abschiedsszene“ Oskar Pastior zum Gedenken geschrieben hat – beide haben wie besessen zu ergründen versucht, „wie Buchstaben sich entzünden / wie sie sich finden“.
Darum geht es auch immer in diesem Band: Sätze werden abgebrochen, die Zeichensetzung setzt aus, Reime erklingen, aber nicht am Versende. Wörter zu setzen, weil sie alliterieren, weil sie sich reimen, ist riskant, denn es führt an die Abgründe des Kalauers: „Auch wenn dein Fuß, dein Spann, die Ferse / Was schmerzt, darüber wirst du dich nicht / Äußern, und allzu viele Sorgen machen sich / Perverse, auch wenn du glaubst, du sprichst / In Versen“.
Es ist heute schwerer geworden, so zu dichten. Ursula Krechel sucht das Wagnis, und es gelingt in dem Gedicht auf den Tod des Dichters Gennadij Aijgi, der zuerst tschuwaschisch, später auf Anregung Pasternaks vor allem in Russisch gedichtet hat. Mit einem Wort-Crash an der Grenze des Erträglichen tritt das Ich neben die Trauerszene, verfremdet sie gewaltsam und erhebt sie auf die abstrakte Ebene des Bildes: „der Dichter Gennadij Aijgi / wird begraben / wie weiß ist der Schnee / leis die Schritte / Leichnam in Tücher gehüllt / den Leichnam gebettet / weißer als weiß, blendend / tschuwaschisch gewaschen / und die das Tuch halten / im einträchtigen Gleichgewicht / niedergerlegt, das Bild schneit ein / verblasst nicht / So haben Sie es erzählt“. Das Gedicht heißt „Mit dem Blick, allein – Für Felix Philipp Ingold“ (er hat sich um die Übersetzung von Aijgis Gedichten verdient gemacht).
In der gewaltsamen Instrumentalisierung von Stilmitteln in diesem Gedichtband wird man nicht mehr eine Verstehenshilfe suchen, sondern den Ausdruck eines „Beharrens auf dem Poetischen“, wie die Dichterin es selber ausgedrückt hat. Es gelingen ihr Seite um Seite eigenwillige, intelligente, manchmal auch humorvolle oder sarkastische Gedichte, die ihren Lesern wie Personen begegnen: körperlich gegenwärtig, einladend, zurückhaltend oder abweisend, offen oder geheimnisvoll, aber nie einfach als dekodierbare Botschaft.
Am Schluss des Bandes finden wir einen kleinen Zyklus mit dem Titel „Mitschrift des Sommers“. Er besteht aus 16 Gedichten, die von einem Aufenthalt der Autorin in einem evangelischen Damenstift handeln. „Die Gräber im Klosterhof schweigen /. . . / Auch ich schwiege, wenn ich nicht schriebe“. Was die Autorin mit den stummen Schatten teilt, über die Jahrhunderte hinweg, ist das Frausein. Auch diese Gedichte suchen nach ihrem eigenen Gegenstand; sie verbreiten einen manchmal beißenden Hauch von Idylle. Im Vergleich mit allen anderen Gedichten spürt man hier jedoch eine fremde und bedrohliche Kraft, die der Dichtung entgegenarbeitet und das lyrische Ich vereinnahmt, selbst wenn es sich wehrt. Zwischen die Gedichte sind dokumentarisch einige Grabinschriften verstreut, welche die Aufmerksamkeit auf die historische Wirklichkeit lenken.
Das letzte Wort im buchstäblichen Sinne hat denn auch die Autorin, nicht die Dichterin, in einer Prosa-Passage: Sie würdigt jene Elisabeth von Brandenburg, die als 15-Jährige mit dem vierzig Jahre älteren Herzog Erich I. von Braunschweig-Lüneburg verheiratet wurde, den neuen Glauben annahm und 1542 die Calenberger Klosterordnung erließ – und also dafür sorgte, dass Obernkirchen bis heute als Stift erhalten blieb. Dafür und für andere fromme Werke mag sie Lob verdienen – und doch ist sie dieselbe, die einen Inquisitionsprozess gegen die Mätresse des Herzogs, Anna von Rumschottel, erzwang, der mehrere andere Frauen, dann wohl auch sie selber das Leben kostete. Elisabeths Sohn Erich II. wurde zwar gegen den Willen seiner Mutter katholisch, machte ihr aber alle Ehre, indem er jener frommen Fleischeslust frönte, die darin bestand, Hexen erst „mit glühenden Zangen reißen“ zu lassen, ehe sie ihre satanische Körperlichkeit auf dem Scheiterhaufen verrauchen lassen durften. HANS-HERBERT RÄKEL
URSULA KRECHEL: Jäh erhellte Dunkelheit. Gedichte. Jung und Jung, Salzburg und Wien 2010 , 104 Seiten, 20 Euro.
Bisweilen streift die gewaltsame
Instrumentalisierung der
rhetorischen Mittel den Kalauer
Sucht, wie Buchstaben sich finden: Ursula Krechel Foto: Uwe Zucchi/dpa
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Harald Hartung kennt die Dichterin und ihr Werk und weiß diesen neuen Gedichtband von Ursula Krechel innerhalb der Entwicklung der Autorin zu verorten. Eine bedeutende Station, eine Wendung stellt das Buch für ihn insofern dar, als der aufklärerische Gestus hier von einem des Zweifelns, der Skepsis abgelöst wird, wie er schreibt. Keine Antworten also, sondern Fragen, das Gedicht als Essay. Wenn Krechel darin mit Dichter-Kollegen wie Celan, Diderot oder H.C. Artmann in einen intellektuellen Diskurs tritt und die "strukturelle Wahrheit" in der Sprache auslotet. Dazu liest Hartung Gedenkgedichte (für Oskar Pastior) und lernt schließlich, dankbar für diese Erfahrung, das Metaphysische in der von der Dichtern ausgehaltenen Sprachlosigkeit kennen.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH