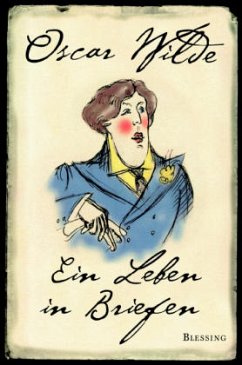"Es ist nicht klug, der Welt sein Herz zu zeigen. In einem so vulgären Zeitalter wie diesem benötigen wir alle Masken." So kennt ihn die Welt - Oscar Wilde, den Meister der Selbstinszenierung, der mit Rollenspiel und faszinierenden Posen das Publikum seiner Zeit verzückte und auch verschreckte. In seinen Briefen dagegen erleben wir ihn unverstellt - spontan, warmherzig, freundschaftlich besorgt, boshaft, selbstironisch, berechnend, leidenschaftlich, alltagsnüchtern. In einer sehr persönlichen Briefauswahl bringt sein Enkel Merlin Holland uns den glänzenden Stilisten Wilde nahe, mehr aber noch: den Menschen.
Oscar Wilde hat kein intimes Tagebuch hinterlassen, und Memoiren zu schreiben lag ihm fern. Was ihn berühmt machte, waren elegante Komödien, zauberhafte Kunstmärchen und ein brillanter Roman. Ganz Gesellschaftslöwe, wie es schien. Einer, der auch in Amerika Furore machte: "Ich winke mit behandschuhter Hand und Elfenbeinstock, und sie jubeln mir zu."
Doch dieses Leben kennt Höhenluft wie auch die Mühen der Ebene und sehr schmerzhafte Tiefen. All dies zeigen die Briefe. Einer glänzenden Außenseite - Wilde der Dandy, Wilde der genialisch-verruchte Künstler - fügen sie die Innenansicht hinzu. Erst durch sie lernen wir ihn als hart arbeitenden, professionellen Autor kennen, mit einem stets wachen Interesse für die Themen der Zeit. Dazu einen, der in seinem geistigen Gepäck etwas Seltenes aufzuweisen hatte: eine umfassende klassische, literarische und philosophische Bildung.
Merlin Holland beschäftigt sich seit fünfundzwanzig Jahren mit dem Werk seines Großvaters. Zusammen mit Rupert Hart-Davis gab er die erste vollständige Ausgabe von Wildes 1562 erhaltenen Briefen heraus. Hier legt er nun eine Auswahl von 400 Briefen vor, die einer Quintessenz gleichkommt. Denn das war seine Absicht: dieses spannungsreiche Leben in Briefen einzufangen und sie so zu arrangieren, dass der Akteur in neuem Licht erscheint. Ungeschönt, von allen Seiten erfasst - der Mensch Oscar Wilde.
"Bin fest entschlossen, dass die Welt mich versteht."
OSCAR WILDE
Oscar Wilde hat kein intimes Tagebuch hinterlassen, und Memoiren zu schreiben lag ihm fern. Was ihn berühmt machte, waren elegante Komödien, zauberhafte Kunstmärchen und ein brillanter Roman. Ganz Gesellschaftslöwe, wie es schien. Einer, der auch in Amerika Furore machte: "Ich winke mit behandschuhter Hand und Elfenbeinstock, und sie jubeln mir zu."
Doch dieses Leben kennt Höhenluft wie auch die Mühen der Ebene und sehr schmerzhafte Tiefen. All dies zeigen die Briefe. Einer glänzenden Außenseite - Wilde der Dandy, Wilde der genialisch-verruchte Künstler - fügen sie die Innenansicht hinzu. Erst durch sie lernen wir ihn als hart arbeitenden, professionellen Autor kennen, mit einem stets wachen Interesse für die Themen der Zeit. Dazu einen, der in seinem geistigen Gepäck etwas Seltenes aufzuweisen hatte: eine umfassende klassische, literarische und philosophische Bildung.
Merlin Holland beschäftigt sich seit fünfundzwanzig Jahren mit dem Werk seines Großvaters. Zusammen mit Rupert Hart-Davis gab er die erste vollständige Ausgabe von Wildes 1562 erhaltenen Briefen heraus. Hier legt er nun eine Auswahl von 400 Briefen vor, die einer Quintessenz gleichkommt. Denn das war seine Absicht: dieses spannungsreiche Leben in Briefen einzufangen und sie so zu arrangieren, dass der Akteur in neuem Licht erscheint. Ungeschönt, von allen Seiten erfasst - der Mensch Oscar Wilde.
"Bin fest entschlossen, dass die Welt mich versteht."
OSCAR WILDE

Briefe eines Lebens: Oscar Wildes exquisite Enthüllungen
Die Rheinfahrt war nicht seine Sache, denn der berühmte Fluß "ist natürlich langweilig, die Weinberge sind steif und öde und die Deutschen, soweit ich das beurteilen kann, Amerikaner." Das bedeutete für Oscar Wilde eine ganz erhebliche Strapaze des Geschmackssinns. Die Anstrengung, Deutsch zu lernen, unternahm er denn auch erst im Zuchthaus - "hier scheint mir der richtige Ort dafür zu sein" -, Amerikanisch lernte er nie. Daher zählen seine gelegentlichen Beschreibungen von Amerikanern wie von Deutschen zu den schönsten Höhepunkten teilnahmsloser Wildbeobachtung.
In der Opéra Comique traf es sich beispielsweise eines Abends, daß Bosie, sein Begleiter, ausgerechnet neben einem Deutschen sitzen mußte, "der in seltsamen Schwaden die ungewöhnlichsten Gerüche verströmte", als wolle er auf diese urtümliche Weise seinen Beifall für die Vorstellung (man gab die "Sappho" mit Georgette Leblanc) kundtun. "Bosie trug es mit Fassung, doch er saß mir praktisch auf dem Schoß." Das wird Wilde allerdings schon recht gewesen sein. Die Szene spielt im Juni 1898; ein Jahr zuvor erst war er aus dem Zuchthaus, wohin er Bosies wegen gehen mußte, freigekommen.
Ausdruck ernster Leidenschaften wie auch schrecklichster Erniedrigung, herrliche Gehässigkeit und kunstsinnige Betrachtungen, intime Selbstkundgabe sowie virtuoses Rampenspiel - in Oscar Wildes Korrespondenz, nicht anders als in seiner Existenz, treffen solche Gegensätze oft zusammen. Daß die Kunst dem Leben das Modell vorgebe, gehört zu seinen wichtigsten Maximen. Sein einziger Roman, "Das Bildnis des Dorian Gray", ist daher, wie er einmal erklärte, die perfekte Vorlage zur bevorzugten Daseinsform: "nur Konversation und keine Handlung". Und weil Briefe ihm nichts anderes als die Fortsetzung der Konversation mit bleibenden Mitteln waren, ist "Ein Leben in Briefen" unzweifelhaft die kongeniale Art, Oscar Wildes Autobiographie zu verfassen: als Nachvollzug eines Lebenden am Selbstbildnis dieses Künstlers.
Dafür hat Merlin Holland, der Herausgeber und Enkel, aus dem erhaltenen Material, das vor fünf Jahren erstmals vollständig veröffentlicht wurde, mit vierhundert Briefen ein gutes Viertel ausgewählt, durch hilfreiche Erläuterungen in Form von Zwischentexten kommentiert und durch zwei Briefe von Wilde nahestehenden Personen sparsam ergänzt. Für die deutsche Fassung, die dankenswerterweise außerhalb fälliger Klassikergedenkjahre erscheint, findet Henning Thies eine nuancenreiche, nur ganz vereinzelt etwas saloppe Sprache, bei der zwar die literarischen Echos des Englischen, aber keine Pointen auf der Strecke bleiben müssen. Ein eigentlicher Briefwechsel also wird nicht präsentiert, was sich jedoch um so leichter verschmerzen läßt, als die einseitige Dominanz des Austauschs sicher einen lebensnahen Eindruck von Wildes legendärer Konversationskunst gibt. Entstanden ist so jedenfalls ein wahrhafter Briefroman, der den Größten seiner Gattung wie dem "Werther" an Intensität nur wenig nachsteht und an abgründigem Witz naturgemäß weit überlegen ist.
Platon als Bettlektüre
Durchweg lebt er von der Spannung zwischen dem Erlebnis eines Augenblicks, den der Schreibende jeweils fixiert, und der Erkenntnis weiterer Konsequenzen, die wir als Lesende daraus ziehen, weil wir alles mit dem späterhin Erlebten in Beziehung setzen können. Dabei ist allerdings ein Hintersinn der Worte oft vom Verfasser bereits kalkuliert. Im Winter 1893 schrieb Wilde einen artigen Dankesbrief an Lady Mount-Temple, eine entfernte Verwandte seiner Frau, die ihm ihr Landhaus Babbacombe Cliff günstig zur Miete überlassen hatte. Während die Gattin in Florenz weile, arbeite er dort nicht nur an einem neuen Stück, teilt er mit, sondern habe auch "eine Art College" zum Griechischstudium eingerichtet: einem jungen Oxfordianer gewähre er vorübergehend Unterkunft und Unterstützung bei der schwierigen Arbeit an Platon. Dagegen mochte die Lady nichts weiter einzuwenden haben, zumal es sich beim Schüler um den Sproß einer bekannten Adelsfamilie, Lord Alfred Douglas, genannt Bosie, handelt. Einem anderen Adressaten schildert Wilde den Stundenplan von "Babbacombe School" dann etwas detaillierter, inklusive "Versteckspiel mit dem Rektor", Abendessen mit "Champagnerzwang" sowie mitternächtlicher "Bettlektüre (Pflichtfach)". Damit war das Platonische des Tages abgeschlossen.
In dem spektakulären Strafprozeß von 1895 wurde er als "Sodomist", wie die Viktorianer sagten, vorgeführt und hart verurteilt. Sein eigentlicher Fetisch aber, dessentwegen Oscar Wilde bis heute gelesen und geliebt wird, war nicht etwa Bosies honigblondes Haar, das er in verhängnisvollen Briefen rühmte, sondern war die Sprache, und zwar wegen ihres exquisiten Hangs zum Doppelsinn. Was Mittelklassesprecher gemeinhin Schlüpfrigkeit nennen mögen, zeigt ja nichts anderes als das zutiefst erregende Vermögen einfacher Wörter, ein Vielfaches zu bedeuten. Statt durch klare Referenz Ordnung zu stiften, leiten sie Leser wie die ehrenwerte Lady in die Irre, wenn Wortartisten wie Oscar Wilde damit ihre Pirouetten drehen. Solche Lust am verdrehten Aussprechen des Unaussprechlichen treibt alle seine Texte und regte sicher das erotische Rollenspiel mit den Griechenknaben an. Das Verbotene dadurch zu verbergen, daß er es auf die Bühne brachte, war eine bewußt riskante Strategie. Heute folgt ihr unsere Lust an der Lektüre.
Entdeckung der Einzigartigkeit
"Liebster aller Jungen - Dein Brief war köstlich - roter und goldener Wein für mich - aber ich bin traurig und verstimmt." Natürlich hat es bei aller zeitlichen Distanz etwas Voyeuristisches, wenn wir solche Zeilen wie über die Schulter des Empfängers mitlesen. Aber noch das innigste Gefühlsbekenntnis Oscar Wildes lebt von der Theatralik seiner Kundgabe, die das große Publikum sucht. Seine inkriminierenden Liebesbriefe wurden dadurch nur noch trunkener, daß er ihre Entdeckung weniger fürchten als geradezu verlangen mußte. Und tatsächlich gingen sie bald durch die Presse, während ihr Verfasser sich vor Gericht genötigt sah, der Öffentlichkeit seine Sprachbilder als artistische Lyrismen zu erklären. Die bittere Bestrafung, deren Folgen ihn drei Jahre nach Entlassung aus der Haft zugrunde richteten, nahm er auf sich, weil ihm nur das Doppelleben wie der Doppelsinn erlaubten, seine Singularität zu pflegen.
Man sollte daher Merlin Hollands Ansicht, in den Briefen zeige sich der Autor "unverstellt" nicht ohne weiteres Glauben schenken. Gerade weil sich jeder Brief an einen Adressaten richtet und oftmals diesem ein besonderes Anliegen - häufig ein finanzielles - vorträgt, wählt der Autor die jeweils passende Pose sicher mit Bedacht, denn "in einem so vulgären Zeitalter wie dem unseren braucht jeder seine Maske". Von den ersten illustrierten Reiseberichten aus Italien, die der hoffnungsvolle Oscar den Eltern nach Dublin schickte, über die brillanten Briefe, die der Autor gern als seine "Enzyklika" bezeichnete, bis zu den späten Bettelschreiben des Pariser Exilanten, der sich Sebastian Melmoth nannte, können wir diesen Maskenreigen über dreißig Jahre mitverfolgen.
Dabei erleben wir ihn mal als Liebhaber, Rechthaber, Bittsteller oder Bewerber, mal als Kritiker, Programmatiker, Spieler oder Spötter - immer aber auf der Höhe seiner Kunst, den Wendungen der Sprache wie des Lebens etwas Erstaunliches abzugewinnen. Der einzige Unterschied zwischen einem Heiligen und einem Sünder liege darin, daß jeder Heilige eine Vergangenheit, jeder Sünder aber eine Zukunft hat: So lautet eine seiner Einsichten. Wenn wir dieses mitreißende "Leben in Briefen", Oscar Wildes ungeschriebene Autobiographie, lesen, verstehen wir sogleich, warum.
Oscar Wilde: "Ein Leben in Briefen". Herausgegeben und kommentiert von Merlin Holland. Aus dem Englischen übersetzt von Henning Thies. Karl Blessing Verlag, München 2005. 587 S., geb., 24,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Vademecum gegen Wehleidigkeit: Oscar Wilde in seinen Briefen
„Das Kloster oder das Café - in einem der beiden liegt meine Zukunft. Ich habe es mit dem häuslichen Herd versucht, aber das war ein Fehlschlag”. Als Oscar Wilde dies schrieb, lag keine Zukunft mehr vor ihm: die Briefstelle datiert aus dem Todesjahr 1900. Ihr Ton ist indes charakteristisch für den Autor. In höchstem Maße zum Erstaunen war, ist und bleibt an diesem Ton die Absenz von Selbstmitleid - kennt man nämlich den biographischen Kontext. Es ist der eines Absturzes, unermesslich nicht nur nach den Maßstäben seiner Zeit: vom gefeierten Liebling der Londoner Society zum Sträfling, vom literarischen Star des Großbürgertums, der dessen Amusement mit Provokationen auf einen Nenner brachte, zum ob seiner Homosexualität Ausgestoßenen - englische Touristen in Frankreich wechselten, seiner angesichtig, die Straßenseite und beschwerten sich, im selben Hotel untergebracht zu sein wie dieser Mann -, zum Bankrotteur, der die letzten Jahre in einem Exil schäbiger Bohème verbrachte.
Hundert Jahre später, da, was einmal politischer Streit war, zunehmend in einer Konkurrenz der Opfer ausgetragen wird und das Jammern zur vorherrschenden Form der Durchsetzung von Ansprüchen geworden ist, erscheint der Mangel an Wehleidigkeit als der vielleicht auffallendste Zug der Briefe Oscar Wildes. Ihre Noblesse mag nostalgisch stimmen; doch war sie auch am Ende des 19. Jahrhunderts schwerlich Zeitgeist, weit eher eine höchst persönliche Qualität.
Die Erkenntnis, dass mit dieser Noblesse im bürgerlichen Heldenleben wenig oder nichts auszurichten sei, gehört in diese Qualität selber hinein und steigert den Secco-Tonfall der konstatierten gescheiterten Häuslichkeit am Ende zu soziologischer Klarsicht: „Bislang habe ich mich stets auf meine Persönlichkeit verlassen; doch jetzt weiß ich, dass meine Persönlichkeit in Wirklichkeit auf der Fiktion hoher gesellschaftlicher Stellung beruhte. Nach dem Verlust dieser Stellung nützt mir meine Persönlichkeit überhaupt nichts mehr”.
Da Oscar Wilde zunächst so durchaus mit dem aristokratischen wie bürgerlichen Kult der „Persönlichkeit” und ihrer „Ausstrahlung” sympathisierte, wird seine Korrespondenz zur desto bestürzenderen Studie über deren Ohnmacht. Die Einsicht wird erreicht auf dem Weg leidvoller Desillusionierung. Wilde nennt sie „eine seltsame, bittere Lektion”; doch er kehrt das Lernen hervor, vermerkt den Schmerz wie nebenbei. Wenn je der amor fati mehr war als eine philosophische Parole, falls irgend eine Existenz nach dieser Idee geführt wurde, dann in dem Leben, welches sich in diesen Briefen spiegelt; „schon die bloße Tatsache, dass er mein Leben ruiniert hat, lässt mich ihn lieben”, schrieb Wilde 1897 über Alfred Douglas. Wilde führt exemplarisch an der eigenen Existenz vor, dass sich nach jener Idee nicht leben lasse, und lebt dennoch nach ihr.
Ein unlösbares Problem: Ich
„Es tut mir Leid, dass ich durch meine Extravaganz mein Leben so verpfusche und vertue. Aber ich kann nicht anders leben”: diese hellsichtigen Sätze wurden bemerkenswerterweise schon vor der Katastrophe des Prozesses und der Verurteilung, im Februar 1895, niedergeschrieben. Die kürzeste Formel fand Wilde im Schlusssatz eines Briefes vom November 1897: „Ich war ein Problem, für das es keine Lösung gab”. Diese Selbstdeutung ernst zu nehmen, macht gegenwärtig wohl die eigentliche Herausforderung seiner Briefe aus. Denn weit schmeichelhafter ist uns die Vorstellung, Wilde sei an viktorianischer Prüderie gescheitert, einer Repression, von der sich die gegenwärtige Freigabe sexueller Vorlieben, ihre Deklaration zur Privatangelegenheit der Beteiligten, aufs Erfreulichste abhebe. Doch die Dialektik von Verbot und Übertretung gibt Wildes Werk in Wahrheit erst Stoff und Form. Seine Briefe explizieren sie in überreichem Maße, und extrapolieren sie aufs Leben. Zuweilen auch umgekehrt von diesem auf die Kunst. Und mehr als einmal sistieren sie die Extrapolation vielmehr gerade in einer Weise, dass kurrenter Zeitgeist sich kaum bestätigt fühlen dürfte: „Künstler haben ein Geschlecht, aber die Kunst hat keines”, schrieb Wilde 1887.
Wilde war ein großartiger Briefschreiber, in guten Zeiten souverän, charmant, boshaft, witzig, intelligent, nuancenreich, in schlechten Zeiten von abgründiger Einsicht. Von 1562 überlieferten Briefen - viele, zumal an seine Frau, wurden vernichtet - hat sein einziger Enkel Merlin Holland 400 ausgewählt. Dass der wichtigste Brief Oscar Wildes, sein unter dem Titel „De profundis” bekannt gewordenes, 1897 aus dem Gefängnis an Alfred Douglas gerichtetes Schreiben, ausgespart blieb, ist eine ebenso (wie der Herausgeber weiß) fragwürdige wie (angesichts von dessen Umfang) verständliche Entscheidung.
Hollands Auswahl ist plausibel und enthält sogar Neues - ein interessanter Brief Wildes an Arthur Conan Doyle, den Erfinder des Sherlock Holmes, wurde nach der erst im Jahre 2004 wieder aufgefundenen ersten Seite ergänzt -, die Übertragung von Henning Thies scheint mir untadelig. Vor allem dürfte dies „Leben in Briefen zu einer neuen Lektüre des Werks von Oscar Wilde verführen. ANDREASDORSCHEL
OSCAR WILDE: Ein Leben in Briefen. Herausgegeben und kommentiert von Merlin Holland. Aus dem Englischen von Henning Thies. Karl Blessing Verlag, München 2005. 608 Seiten, 24 Euro.
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Eine Dienstleistung der DIZ München GmbH
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Oscar Wilde sei als Briefschreiber nicht minder "großartig" gewesen denn als Lebemann, zieht Rezensent Andreas Dorschel den Zylinder, und bemüht eine ganze Galerie an rühmenden Adjektiven. Das auffälligste Merkmal, so der Rezensent, sei allerdings die "Absenz von Selbstmitleid". So gelängen Oscar Wilde Einsichten von "soziologischer Klarheit", wenn er nach der Inhaftierung seine Persönlichkeitsverständnis als letztlich fremd bestimmte gesellschaftliche Fiktion entlarve. Aus heutiger Sicht, so der Rezensent, würde man gerne dem prüden England der Vergangenheit alle Schuld für Wildes tragisches Schicksal geben, um unsere aufgeklärte Zeit frei zu sprechen. Doch Wildes "Extrapolationen" würden durchaus auch dem heutigen Zeitgeist die Leviten lesen, beispielsweise wenn es um die Frage nach dem möglichen Geschlecht von Kunst gehe. Von 1562 Briefen habe der Herausgeber und Enkel Oscar Wildes in dieser Ausgabe 400 "plausibel" ausgewählt und sogar einen neu entdeckten Brief an Conan Doyle einfügen können. Dass der berühmte Gefängnisbrief "de profundis" nicht in der Auswahl enthalten ist, erscheint dem Rezensenten rätselhafterweise ebenso "verständlich" wie "fragwürdig". Auf jeden Fall werde diese Briefauswahl in "untadeliger Übertragung" ihre Leser unter anderem zur erneuten Lektüre Oscar Wildes verführen.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH