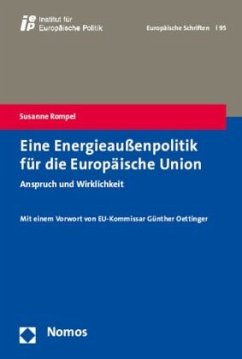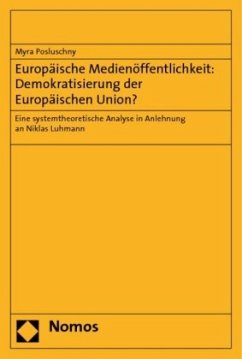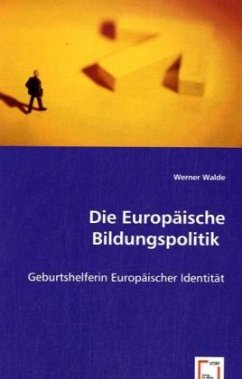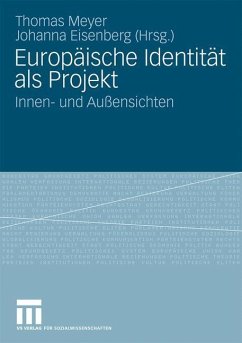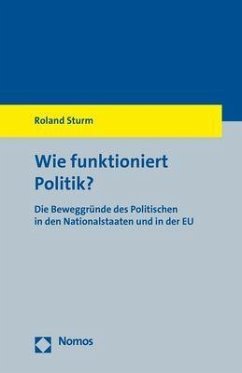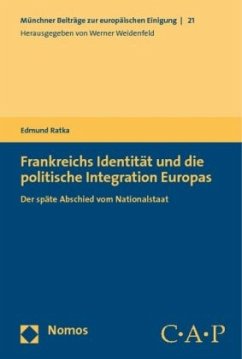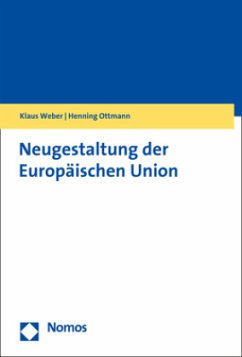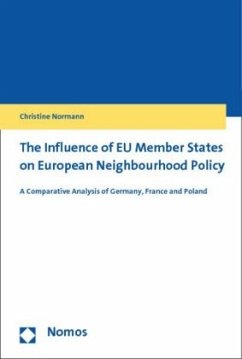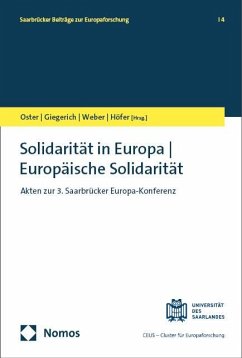Politikforschung.
Die Autoren sind sich nicht ganz einig, ob es sich bei der Ablehnung des Verfassungsvertrags in Frankreich und in den Niederlanden lediglich um ein tragisches Missverständnis handelt. Wolfgang Schmale glaubt, die Konstruktion eines "Europäischen Demos" zumindest seit der Zeit des Zweiten Weltkriegs registrieren zu können. Gegenwärtig seien mehrere Millionen Menschen als Vermittler tätig, die die Bevölkerungen zu einem europäischen Demos vernetzen. Auch wenn der Prozess der Formierung eines solchen Demos noch nicht abgeschlossen sei, sei man damit über das Europa der Eliten hinaus. Demgegenüber beklagt Michael Weigl, dass Europa zunehmend nur noch als Beiwerk eines neuen identitären Selbstbewusstseins der Nationalstaaten verstanden wird. Und Jochen Roose schließt aus der Entwicklung der Eurobarometer-Umfragen, dass sich nur vergleichsweise wenige Bürger mit Europa identifizieren.
Ein Trend zu stärkerer Identifikation mit der EU sei nicht erkennbar. Das stimmt nicht ganz. Differenziert man die Ergebnisse der Umfragen, wird deutlich, dass die Europa-Orientierung der Bürger mit ihrem Alter, ihrem Bildungsgrad und dem Maß an gesellschaftlicher Verantwortung korreliert. Je jünger, je höher im Bildungsabschluss und in der gesellschaftlichen Stellung, desto stärker ist auch die europäische Dimension der Identität ausgeprägt. Europa ist danach immer noch eher ein Elitenprojekt; gleichzeitig kann die "pro-europäische" Fraktion langfristig aber mit weiterem Zuwachs rechnen. Mit der weiteren Verdichtung der Beziehungen innerhalb der Union, der Stärkung europäischer Institutionen, der absehbaren Zunahme von Mobilität über nationalstaatliche Grenzen hinweg und der steigenden Bedeutung beruflicher Qualifikation wird die europäische Dimension von personaler und kollektiver Identität in der EU in Zukunft gewiss noch stärker ins Bewusstsein treten.
Im Interesse an der Handlungsfähigkeit und Akzeptanz der EU täten europäische Politiker freilich gut daran, diesen Prozess zu beschleunigen. Davon sind alle Autoren überzeugt, und sie bieten eine Reihe plausibler Vorschläge, wie das geschehen könnte. Jochen Roose empfiehlt häufige, zum Teil auch ritualisierte Erinnerungen an positive Eigenschaften der EU, etwa als Friedens- und Demokratieprojekt. Werner Weidenfeld fordert, die aktuelle Begründung Europas als Antwort auf die Herausforderungen der Globalisierung stärker zu betonen. Claire Demesmay rät zur offensiven Befassung europäischer Politik mit Themen, die den Bürgern Identifikation und offene Emotionalisierung ermöglichen - wie Außenpolitik, Migration und innere Sicherheit, Energie, Vollendung des Binnenmarkts und Erweiterung. Thomas Meyer argumentiert, dass der Überwindung der Diskrepanz zwischen sozialpolitischem Anspruch und erfahrbarem sozialem Output der EU dabei eine Schlüsselrolle zukommt. Einerseits muss der gängige Populismus in der Zuschreibung von Verantwortlichkeiten überwunden werden. Andererseits muss die EU nachdrücklicher für die Durchsetzung der Mindeststandards sozialer Sicherung und Teilhabe sorgen.
Daneben werden in dem Band einmal mehr institutionelle Reformen angemahnt, die die Partizipation der Bürger am europäischen Entscheidungsprozess verstärken und sowohl die Entstehung einer europäischen Öffentlichkeit als auch die Identifikation mit der Union befördern. Da die Wahrnehmung solcher Partizipationsmöglichkeiten immer schon ein gewisses Maß an Öffentlichkeit und Identifikation voraussetzt, empfiehlt Achim Hurrelmann alternativ eine stärkere Demokratisierung der Europapolitik der Mitgliedstaaten und eine Formalisierung der Mitwirkung informeller Netzwerke. Letzteres kann freilich nur ein Notbehelf sein; und bei Ersterem wird man darauf zu achten haben, dass die Handlungsfähigkeit der nationalen Regierungen als unverzichtbaren europapolitischen Akteuren nicht beeinträchtigt wird.
Die beste Nachricht findet sich in dem Beitrag von Julian Nida-Rümelin: Ein normativer Grundkonsens, auf den sich die Europäische Union stützen kann, ist nach seiner Auffassung durchaus postulierbar; und es steht dafür sogar ein historisch einigermaßen fundierter Mythos zur Verfügung. Die Selbstbehauptung eines Verbands von Verbänden freier Bürger in den Kriegen der griechischen Städte gegen das monarchische Großreich der Perser kann als die Geburtsstunde Europas gelten, entstand doch damit erstmals ein Raum, in dem Autarkie und wissenschaftliche Rationalität als normative Leitlinien galten. Mit der Stoa kam die universalistische Humanität dazu, und aus diesen drei Prinzipien ließen sich dann Demokratie und Rechtsstaat ableiten - die beiden weiteren Elemente, die zur normativen Identität Europas gehören. Diese normative Orientierung steht nun in einer, wenn auch vielfach gebrochenen, historischen Tradition; zudem lässt sie sich mit guten Gründen postulieren. Auch wenn Nida-Rümelin dies nicht so sagt: Das lässt es aussichtsreich erscheinen, sich für eine Stärkung der europäischen Identität zu engagieren.
WILFRIED LOTH
Julian Nida-Rümelin/Werner Weidenfeld (Herausgeber): Europäische Identität: Voraussetzungen und Strategien. Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2007. 255 S., 29,00 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 20.07.2009
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 20.07.2009