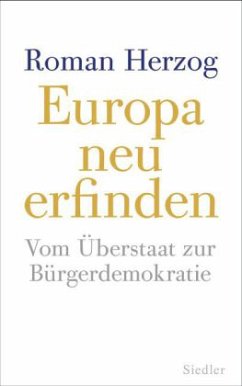Produktdetails
- Verlag: Siedler
- Seitenzahl: 160
- Erscheinungstermin: 12. März 2014
- Deutsch
- Abmessung: 219mm x 135mm x 19mm
- Gewicht: 330g
- ISBN-13: 9783827500465
- ISBN-10: 382750046X
- Artikelnr.: 40018695

bis Marokko
Wo liegt Europa? Kann die EU so etwas wie Heimat
sein? Worum es geht bei den Europawahlen
VON DIETMAR SÜSS
Es raunt in Deutschland. Endlich, so tönt es auf vielen Kanälen, endlich werden die Deutschen die Verantwortung für den Ersten Weltkrieg los.
Doch damit nicht genug. Die erinnerungskulturelle Schlacht um den Ausbruch des Ersten Weltkriegs ist längst keine „historische“ Debatte um diplomatische Interessen, politische Verantwortung oder Großmachtstreben. Heute geht es – mit Blick auf den Europawahlkampf – um deutlich mehr. Denn zur Disposition steht die Legitimation des europäischen Projekts als eine wesentliche Lernerfahrung aus dem mörderischen Nationalismus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
Die neue Kritik am deutschen „Schuldstolz“, ein hässliches Wort der deutschen Rechten, zielt vordergründig auf eine Neubewertung des Ersten Weltkriegs. Doch der eigentliche Fluchtpunkt ist ein anderer: „Die Idee“, so schrieben unlängst einige Historiker in einem kleinen Manifest in der Welt , „dass wir mit ,Europa‘ den Nationalismus bekämpfen müssten, der angeblich die Triebfeder des Dreißigjährigen Krieges des 20. Jahrhunderts gewesen sei, hat den Nationalstaat zu Unrecht diskreditiert.“
Gibt es aber wirklich einen Zweifel, dass der Nationalstaat im 20. Jahrhundert nicht eher Teil des Problems als Teil der Lösung war? Bemerkenswerterweise verliert diese Kritik am Euro, am angeblich falschen Geschichtsbewusstsein kaum ein Wort über die Bedeutung des Zweiten Weltkriegs, über den rassistischen Vernichtungskrieg und den Mord an den europäischen Juden.
Für eine ganze Generation deutscher Nachkriegspolitiker aller Couleur spielten die Erfahrungen des Zweiten, weniger des Ersten Weltkriegs eine zentrale Rolle für
ihre Vision eines gemeinsames Europas. Und dazu zählte auch eine gemeinsame europäische Währung.
Wie prägend diese historische Erfahrung ist, lässt sich mit viel Gewinn in den Reden und Aufsätzen Helmut Schmidts nachlesen, die er über mehr als fünfzig Jahre hin gehalten und publiziert hat. Auffallend ist die lange und ungebrochene Kontinuität seines europapolitischen Engagements, das schon in den späten Vierzigerjahren begann, als er sich vehement für den Schuman-Plan und die gemeinsame deutsch-französische Kohle- und Stahlproduktion einsetzte – zum Entsetzen seines Parteivorsitzenden Kurt Schumacher.
Schmidt war beides zugleich: Visionär und Realist, ein Europäer aus Vernunft, der den Integrationsprozess immer auch als notwendige Folge nationaler Interessenabwägung begriff. Das ließ ihn mit scharfer Zunge gegen Regelungswahn wettern, gleichzeitig beispielsweise 1974 mit Engelszungen an die Genossen der Labour-Partei appellieren, ihren Beitritt zur Europäischen Gemeinschaft nicht rückgängig zu machen. Und er warb, wie anlässlich der ersten Wahlen zum Europäischen Parlament 1979, für ein Europa der „sozialen Gerechtigkeit“, das weder von den „Kapitalisten“ noch von einer einzigen kommunistischen Partei regiert werde. Da sprach noch der Kalte Krieg sein Nachtgebet.
Europa, auch eine gemeinsame europäische Währung, waren für Schmidt Herzensangelegenheiten, und er wurde nicht müde, gerade auch die ökonomischen Vorteile der europäischen Integration für das vereinigte Deutschland zu betonten. „Der Ausbau der Europäischen Union geschieht nicht aus Idealismus“, bekräftigte Schmidt während der Griechenland-Krise im Juli 2010. „Sondern für uns Deutsche ist er eine strategische Notwendigkeit.“ Auf dem Bundesparteitag der SPD im Dezember 2011 erinnerte er seine Genossen daran: „Für uns Deutsche scheint mir entscheidend zu sein, dass fast alle Nachbarn – und außerdem fast alle Juden auf der ganzen Welt – sich des Holocaust und der Schandtaten erinnern, die zurzeit der deutschen Besatzung in den Ländern der Peripherie geschehen sind. Wir Deutschen sind uns nicht ausreichend im Klaren darüber, dass bei fast allen unseren Nachbarn wahrscheinlich noch für Generationen ein latenter Argwohn gegen die Deutschen besteht.“ Nur aber aus der Vergangenheit, das betont Schmidt immer wieder, lebe Europa nicht.
Ihm geht es ums Heute, um die „Selbstbehauptung der europäischen Zivilisation“. Die Europäer und europäische Werte – wie etwa der Ausgleich sozialer Interessen – drohten an den Rand gedrängt zu werden im globalen Wettbewerb, so die Argumentation Schmidts, der aus diesem Grund einem raschen Beitritt der Türkei skeptisch gegenübersteht – und das mit Argumenten, die ziemlich befremden. Im Gespräch mit Joschka Fischer, das den Abschluss des Bandes bildet, versteigt sich Schmidt zu dem Satz: „Verhandlungen können eines Tages zur Vollmitgliedschaft führen. Dann muss man wissen, dass die Türken sehr zeugungsfreudig sind und es vor dem Ende des 21. Jahrhunderts hundert Millionen Türken geben wird.“
Die oftmals so verzweifelte Suche nach einer europäischen Identität hat indes allzu leicht in Vergessenheit geraten lassen, dass die Grenzen Europas immer fließend waren. Die Zeitgenossen zogen die Grenzen jeweils neu. Nach dem Ersten Weltkrieg glaubten beispielsweise viele Intellektuelle, dass die „Neue Türkei“ unter Kemal Pascha rasch ein Teil Europas werden würde. Die Türkei-Debatten haben also einen langen Vorlauf, und sie deuten an, dass das Reden über Europa ein „riesenhafter Roman“ ist, wie das der Wiener Historiker Wolfgang Schmale genannt hat; ein Roman, „in dem Hunderte, vielleicht Tausende Geschichten zusammengefädelt werden, die einerseits „passiert“ sind, andererseits, so wie sie erzählt werden, voller Mythen, Legenden, Verleugnungen“ stecken. Schmale, ein ausgezeichneter Kenner der europäischen Geschichte, hat kein gewöhnliches Geschichtsbuch vorgelegt, sondern einen Reisebericht, in dem er über „sein“ Europa, persönliche Begegnungen, historische Zusammenhänge, alltägliche Kleinigkeiten berichtet – in einer uneitlen Sprache, mit Blick für Details. In seinem Buch geht es um Menschen und Landschaften, um Erinnerungen und Sehnsüchte nach untergegangenen Welten.
Er erzählt nicht nur über Berlin und Paris, Wien und Kopenhagen. Seine Reise führt dorthin, wo er „sein“ Europa findet: in Armenien als gemeinsamem Teil der christlich-jüdischen Welt, oder in Usbekistan, wo Europa und Asien aneinanderstoßen. Wenigstens dort, so Schmale, erfreue sich der Euro noch „ungebrochenen Interesses“. Und er erzählt von den Jungen, die die Euro-Münzen sammeln und wissen, aus welchen Ländern sie stammen und welche Münzen ihnen noch fehlen. Seine Reise führt Schmale auch nach Marokko, zu Europas „südlichem Limes“, wo so viele unterschiedliche kulturelle Einflüsse – arabische, schwarzafrikanische, christlich-jüdische –aufeinandertreffen.
Der Kampf um Europas Grenzen, um die „Festung Europa“ und seine lange imperiale Vergangenheit und Gegenwart: Auch darum geht es in Schmales Buch. Kann Europa so etwas wie Heimat sein? Zurückhaltend ist er gegenüber all den Untergangsszenarien, die vielerorts beschworen werden. Schmale findet sein Europa nicht in Brüssel oder bei der Europäischen Zentralbank. Sein Europa findet er in der Vielgestalt europäischer Erinnerungsorte, in der Verflechtung der vielfältigen Geschichten der Europäer. Das mag manchen naiv anmuten, und natürlich ist damit kein Problem der Währungsunion gelöst. Aber Schmale erinnert daran, dass dieses Europa nie eindeutig definierbar war und sich jenseits der großen Schlagworte von „Europa als Wertegemeinschaft“ konstituierte – wer die spanisch-französische Filmkomödie „L’auberge espagnole“, die Geschichte über eine europäische Studenten-WG in Barcelona, gesehen hat, ahnt, was Schmale etwas abstrakt formuliert.
Womöglich sind die ehemaligen Erasmus-Studenten der 1990er-Jahre inzwischen die Europa-Experten der Gegenwart und müssen sich nun mit der Reform der Europäischen Union herumschlagen. Altbundespräsident Roman Herzog macht dafür einige Vorschläge, die jedoch kaum jemand als besonderen „Ruck“ empfinden wird. Dafür wiederholt er, geschliffen klar formuliert, viel Bekanntes: die EU als „Überstaat“, als Bürokratiemonster, dem vor allem eines hilft: eine Verschlankung seiner Organe und eine Einschränkung seiner Regelungen. Auffällig ist, wie sehr sich die Argumente liberal-konservativer Staatskritik, die seit den 1980er-Jahren gegen den Sozialstaat vorgetragen wurden, heute in den Debatten über die Reform der EU wiederfinden. Zu Recht beobachtet Herzog jenes „Demokratie-Defizit“, das die Überzeugungskraft der europäischen Idee hat schwinden lassen. Kaum jemand wird bezweifeln, dass es der EU-Kommission an demokratischer Legitimation fehlt und die Macht des Europäischen Parlaments auf allen Ebenen gestärkt werden muss.
Wie überzeugend Herzogs Idee einer „europäischen Nation“ als eines neuen Großkollektivs ist, wird sich erst noch herausstellen. Doch schon die ersten Versuche, so etwas wie eine gemeinsame europäische Geschichtskultur zu etablieren und daraus in Brüssel ein Museum zu machen, zeigen die Probleme, vor denen ein solch neues Konstrukt steht. Herzog legt viel Wert auf den „Bürger“ und die „Bürgerdemokratie“. Das ist gut und richtig. Gleichwohl nimmt es wunder, wie wenig der Altbundespräsident die EU auch als soziales Projekt begreift, in dem der Bürger nicht nur mehr „Demokratie wagen“ und weniger Bürokratie ertragen soll, sondern auch angesichts der Finanzkrise Schutz vor den Verwerfungen marktwirtschaftlichen Wildwuchses erfährt.
Wie soll künftig das Verhältnis von Demokratie und Kapitalismus organisiert werden: mithilfe einer weiteren Supranationalisierung der Politik, um ein stärkeres Gegengewicht gegenüber den „Heuschrecken“ zu schaffen? Oder ist die EU selbst ein „neoliberales Projekt“, mit dessen Hilfe sich die globale Finanzelite am Leben hält und geschützt ihren Raubzügen nachgehen kann? Was also können mögliche Alternativen sein? Dazu gehört zunächst eine gesunde Grundskepsis gegenüber aller Rhetorik des „Sachzwangs“ und der „Krise“; dazu gehört auch, wie es Gesine Schwan in einem lesenswerten Interview-Band mit dem Soziologen Hauke Brunkhorst und dem Schriftsteller Robert Menasse formuliert, die Kritik an Begriffen wie „Standortwettbewerb“, die auch Eingang in den Vertrag von Maastricht von 1992 fanden.
Schwans Urteil: „Standortwettbewerb heißt, dass die Staaten miteinander in Wettbewerb treten, nicht aber die Unternehmen. Wenn Staaten miteinander in Wettbewerb treten, versuchen sie, sich gegenseitig in Sachen Kapitalinvestitionen durch Reduktion von Steuern und Sozialleistungen das Wasser abzugraben. Das hat aber in Europa dazu geführt, dass über die bestehenden, tradierten Vorbehalte und Vorurteile hinaus die Gegnerschaft zwischen den Nationalstaaten verstärkt wurde.“ Schwan will die Rechte des Europarlaments gestärkt und zentrale Entscheidungen mit den nationalen Parlamenten verschränkt sehen – eine „verschränkte Souveränität“, wie sie das nennt –, sodass beispielsweise Gesetze der Kommission oder der Haushalt sowohl im Europäischen als auch in den nationalen Parlamenten behandelt werden könnten. Im Kern geht es Schwan um den Versuch, die Legitimität der europäischen Institutionen und damit das Vertrauen zur Transparenz der Verfahren zu stärken.
Ganz so konkret wird der österreichische Schriftsteller Robert Menasse nicht, und doch liest man das Gespräch mit viel Vergnügen, gerade wegen der ordentlichen Polemik. Menasse warnt davor, sich vom Begriff der „Finanzkrise“ blenden zu lassen. Denn in ihm spiegeln sich jene grundsätzlichen politischen und institutionellen Widersprüche der Europäischen Union: „Die nachnationale Entwicklung in Europa, die schon relativ weit gegangen ist, stößt immer wieder und immer schärfer auf nationalen Widerstand. Wir haben ein Zwischenstadium zwischen einem Nicht-mehr und einem Noch-nicht.“ Eine „nachnationale Demokratie“ – das ist ein verwegener Vorschlag, der darauf abzielt, dass langfristig nationale Parlamente abgeschafft und die europäischen Institutionen beispielsweise auch Steuern erheben können, gleichzeitig aber auch regionale Partizipationsmöglichkeiten gestärkt werden.
Das klingt alles noch recht abstrakt, zielt aber doch sehr grundsätzlich darauf, Begriffe wie „Bürgerbeteiligung“ oder „europäische Zivilgesellschaft“ mit Leben zu füllen. Dafür kann es nicht schaden, noch einmal ganz neu nachzudenken. Mit Menasse jedenfalls macht das Spaß und erschöpft sich nicht an der formelhaften EU-Kritik, auch wenn man nicht zu allem, was er sagt, laut applaudieren möchte. Vielleicht ist es das Tröstliche der Lektüre: Der Streit über Europa, sein kulturelles Erbe, seine „Krisen“ und Grenzen, ist nicht neu, und so oft wie Europas Untergang bevorstand, hat es sich an vielen Orten wieder neu erfunden. Eines hat Europa in jedem Fall verdient: mehr Leidenschaft.
Helmut Schmidt : Mein Europa: Mit einem Gespräch mit Joschka Fischer. Hanser, 2013. 368 Seiten, 22,99 Euro.
Wolfgang Schmale : Mein Europa: Reisetagebücher eines Historikers. Böhlau, 2013. 278 S., 24,90 Euro.
Roman Herzog : Europa neu erfinden: Vom Überstaat zur Bürgerdemokratie. Siedler Verlag, 2014. 160 Seiten, 17,99 Euro.
Gesine Schwan , Robert Menasse, Hauke Brunkhorst: Weil Europa sich ändern muss. Ein Gespräch. Springer VS, 2014. 120 Seiten, 12.99 Euro.
Den Ausbau der EU
bezeichnete Helmut Schmidt als
„strategische Notwendigkeit“
Nach dem Ersten Weltkrieg
glaubten viele, dass die Türkei
bald zu Europa gehören würde
Roman Herzog hegt seine
Vorstellung von einer
„europäischen Nation“
Robert Menasse warnt davor,
den Begriff „Finanzkrise“
ganz ernst zu nehmen
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de
"In sieben Punkten listet Herzog auf, was sich ändern müsste. [...] Macht Europa einfacher, könnte man das nennen. Recht so." DER TAGESSPIEGEL, 16.04.2014

EU-Reform ist überfällig
Der schon lange stotternde Motor der Europäischen Union sei nicht mehr zu reparieren, sondern müsse von Grund auf neu konstruiert werden. Diese Ansicht vertritt Roman Herzog und entwickelt für eine solche Neukonstruktion ein weit in die Zukunft gerichtetes Konzept. Der frühere Bundespräsident fordert nichts weniger, als Europa neu zu erfinden. Er sieht zwischen dem Überstaat und seinen Bürgern eine immer bedrohlicher werdende Kluft, nicht zuletzt zwischen denen in den finanziell "gebenden" Staaten gegenüber den auf unabsehbare Zeit "begünstigten Ländern". Die Gemeinschaft von 28 Mitgliedstaaten könne die Herausforderungen gegenüber anderen, selbstbewusst gewordenen Teilen der globalisierten Welt nicht mehr bewältigen. Zu groß sei die Diskrepanz zwischen einer "überbordenden Bürokratie" und der Wirklichkeit, bedenklich auch die Wahl "immer schwächerer Figuren" in die Führungsorgane, ohne dass hier oder später Namen genannt werden.
Zu den Ursachen dieser Verwerfungen zählt Herzog das Übergewicht der Brüsseler Exekutivorgane mit ihren intransparenten Entscheidungsprozessen, das Fehlen einer "europäischen Öffentlichkeit" und einer klaren weltpolitischen Rolle der EU. Sie verfüge über keine gemeinsame Nation, Sprache und geschichtliche Erfahrung, besitze weder eine den Mitgliedstaaten vergleichbare Zentripetalkraft und Zivilgesellschaft noch ein gewachsenes Nationalbewusstsein und kulturelles Erbe. So sei die Frage berechtigt, ob sich eine "europäische Nation" in einem vage formulierten Staatenverbund ohne klare Grenzziehung schaffen lasse. Angesichts ihres erheblichen Demokratie-Defizits sei die EU "bestenfalls eine Teildemokratie". Den Vätern der Integration lastet der geschichtsbewusste Jurist, allerdings allzu gewagt, das Fehlen ausreichender Kenntnisse über historische Leitbilder transnationaler Verbindungen an. Für die Brüsseler Bürokratie sei die EU inzwischen ein Staat.
Nach diesen "theoretischen Fragestellungen" beschreibt Herzog die Grenzen der EU nach der "Umgestaltung der Welt". Europa könne sein Verständnis der Menschenrechte nicht weltweit durchsetzen. Es werde schon schwierig genug sein, die wirtschaftliche Prosperität, deren Fortbestand die Unionsbürger "wie selbstverständlich" erwarteten, zu erhalten und die politisch-kulturelle Identität zu wahren. Ein Strukturfehler der EU-Organisation sei die Aufnahme neuer Mitglieder ohne vergleichbare Homogenität. Hart kritisiert Herzog die Normen-Hypertrophie der EU-Bürokratie, die beitrittswillige Staaten erst einmal mit allen EU-Vorschriften im Umfang von 60000 bis 70000 Druckseiten konfrontiere. Auch wenn nicht mehr "nach den zehn Geboten regiert werden" könne, müsse die Hälfte reichen. Die Normenflut und die auf "irrationale Weise" entstandene Rechtsordnung führten zu Leerlauf und Autoritätsverlust ihrer Urheber. Das gelte ebenso für Erweiterungen von Kompetenzen und die Umwandlung von Richtlinien zu Gesetzen, aber auch für das Verfahren, Zuständigkeiten der EU einseitig zu erweitern sowie Verträge extensiv auszulegen.
Andere Verwerfungen sieht Herzog als Folge der Inhomogenität der Mitgliedstaaten. So sei der Verzicht auf Kompetenzverlust nicht mehr selbstverständlich, da die "vor kurzer Zeit freigewordenen Staaten" Ost- und Ostmitteleuropas Souveränitätseinbußen fürchteten. Bedenklich sei die Praxis von Mitgliedstaaten, Sparmaßnahmen der EU lieber durch deren Oktroi zu akzeptieren, als sie in ihren eigenen Parlamenten durchbringen zu müssen. Einen Finanzausgleich unter den Mitgliedstaaten zu erreichen, hält Herzog für ein fast unlösbares Problem, schon der bei uns geltende sei "ganz einfach höherer Irrsinn". Die Bürokratie der Mitgliedstaaten beherrsche das ungute "Spiel über die Bande", indem sie ihre Vorstellungen, die von den eigenen Regierungen abgelehnt worden seien, über den EU-Apparat aufnehmen ließe.
Als "Stich ins Wespennest" versteht Herzog sein Plädoyer für ein starkes Europa - mit mehreren Ebenen und verschiedenen Mitgliedergruppen, auch "unterschiedlichen Geschwindigkeiten". Allerdings sei mit der Preisgabe des Einstimmigkeitsprinzips im Ministerrat, eines "schwerwiegenden Konstruktionsfehlers" des Lissabon-Vertrags, kaum zu rechnen. Tröstlich sei hingegen, dass auch die "ausgefeilteste Jurisprudenz" nicht immer weiterhelfe. So hätten während der Euro-Krise alle Eurostaaten bestimmte Lösungen um Großbritannien "herumgebaut". Herzogs Vorschläge für die "alsbaldige" EU-Reform lauten: Präzisierung ihrer Zuständigkeiten, sparsame Zuweisung neuer Kompetenzen, "Überdenken" der Grundsätze für eine Erweiterung, stärkere Beachtung des Subsidiaritätsprinzips, in der Gesetzgebung Vorrang der Richtlinie vor der Verordnung, Reduzierung und "Verschlankung" ihrer Aktivitäten. Man darf gespannt sein, ob Herzogs Ruck-Ruf Europas Schlafwandler erreicht.
RUDOLF MORSEY
Roman Herzog: Europa neu erfinden. Vom Überstaat zur Bürgerdemokratie. Siedler Verlag, München 2014. 155 S., 17,99 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Der Rezensent zweifelt, ob der Ruf nach einer Neukonstruktion Europas Gehör findet. Was der frühere Bundespräsident Roman Herzog in seinem Buch an Brüsseler Gepflogenheiten kritisiert (Normenflut, Überstaat, fehlende klare weltpolitische Rolle), findet Rudolf Morsey hart bis gewagt, räumt aber ein, dass der Autor sein Plädoyer selbst als "Stich ins Wespennest" begreift. Gegen Herzogs Reformvorschläge (Beachtung des Subsidiaritätsprinzips, Verschlankung, Präzisierung von Zuständigkeiten etc.) hat Morsey offenbar nichts einzuwenden. Nur dass er auf der Empfängerseite taube Ohren vermutet.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH