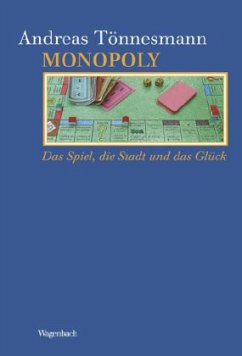Tausende spielen es täglich rund um die Welt, nahezu 200 Millionen Mal verkaufte
es sich seit seiner Patentierung vor 76 Jahren. Das blassgrüne Quadrat
des Spielbretts, das von bunten Straßen gesäumt wird, birgt vor allem für Jugendliche,
die strategischen Spielwitz und Glück auf sich vereinen, scheinbar
unerschöpfliche Möglichkeiten der Geldvermehrung. Erwachsene dagegen
betrachten
das Spiel oft mit Argwohn als Einübung in die Regeln eines vermeintlich
rüden, urtümlichen Kapitalismus. Kein Wunder, dass Monopoly in allen
sozialistischen Ländern streng verboten war - und als Schmuggelware stets
reißenden Absatz fand.
Andreas Tönnesmann setzt hinter diese vorschnelle Bewertung ein entschiedenes
Fragezeichen. Er entführt den Leser in die Entstehungszeit des Spiels
und erzählt die Glücksgeschichte seines Erfinders Charles Darrow. Und er zeigt,
dass Monopoly eine Stadt ist, in der sich widersprüchliche ökonomische Denkansätze
- Privateigentum und Preiskontrolle, staatliche Alimentierung und freie
Konkurrenz - zu einer einzigartigen Utopie, zu einem künstlichen Wirtschaftssystem
verbinden. Aber es ist auch Abbild eines geometrisch geordneten Gemeinwesens,
eine "Idealstadt", zu deren Ahnherren Thomas Morus, Albrecht Dürer,
Jules Verne oder Frank Lloyd Wright gehören.
es sich seit seiner Patentierung vor 76 Jahren. Das blassgrüne Quadrat
des Spielbretts, das von bunten Straßen gesäumt wird, birgt vor allem für Jugendliche,
die strategischen Spielwitz und Glück auf sich vereinen, scheinbar
unerschöpfliche Möglichkeiten der Geldvermehrung. Erwachsene dagegen
betrachten
das Spiel oft mit Argwohn als Einübung in die Regeln eines vermeintlich
rüden, urtümlichen Kapitalismus. Kein Wunder, dass Monopoly in allen
sozialistischen Ländern streng verboten war - und als Schmuggelware stets
reißenden Absatz fand.
Andreas Tönnesmann setzt hinter diese vorschnelle Bewertung ein entschiedenes
Fragezeichen. Er entführt den Leser in die Entstehungszeit des Spiels
und erzählt die Glücksgeschichte seines Erfinders Charles Darrow. Und er zeigt,
dass Monopoly eine Stadt ist, in der sich widersprüchliche ökonomische Denkansätze
- Privateigentum und Preiskontrolle, staatliche Alimentierung und freie
Konkurrenz - zu einer einzigartigen Utopie, zu einem künstlichen Wirtschaftssystem
verbinden. Aber es ist auch Abbild eines geometrisch geordneten Gemeinwesens,
eine "Idealstadt", zu deren Ahnherren Thomas Morus, Albrecht Dürer,
Jules Verne oder Frank Lloyd Wright gehören.

für den
Kapitalismus
Warum spielt bei „Monopoly“ Arbeit keine Rolle? Warum gibt es
Eigentum nur in Form von Geld und Immobilien? Und warum verfolgt die
Bank keine Gewinninteressen? Andreas Tönnesmann hat die Geschichte
des beliebtesten Gesellschaftsspiels der Welt in einen Gegenstand
der Ideen- und Kulturgeschichte verwandelt
Von Thomas Steinfeld
Ein Männchen kommt auf der Schachtel über das Banner mit dem Namen „Monopoly“ gesprungen. Es trägt einen Stresemann, den feinen Tagesanzug einer längst vergangenen Gesellschaft, einen Zylinder und einen gezwirbelten Schnurrbart. Die rechte Hand streckt es dem Betrachter wie zur Besiegelung eines Geschäfts entgegen, in der linken Hand schwingt es einen Gehstock. Dies ist, kein Zweifel, eine Figur aus einem historischen Stadium der freien Marktwirtschaft; und dies scheint auch, kein Zweifel, keine Gestalt zu sein, die man unbedingt ernst nehmen müsste. Denn sie gehört ja, wie jeder weiß, in ein Spiel. Andererseits ist „Monopoly“, wie auch jeder weiß, eben doch nicht nur ein Spiel wie „Mensch ärgere dich nicht“ oder Backgammon. Es steht für den Kapitalismus, für dessen innerstes Streben, nämlich das nach Kapitalvermehrung, in einer auf ein quadratisches Brett reduzierten Form. Deshalb wird man die ausgestreckte Hand des freundlichen Männchens mit einigen Vorbehalten wahrnehmen: Es hat das Zeug zum gemeinen Gremlin.
Die Geschichte des Spiels „Monopoly“ ist bekannt und wurde mehrmals aufgeschrieben: Seinen Anfang nimmt es in den ersten Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts, im Nordosten der USA, in Gestalt des „Landlord’s Game“, eines Spiels um den Erwerb und den Besitz von Immobilien. Seine Erfinderin war die Stenographin Elizabeth Magie Phillips (1866-1948), und ihre Schöpfung wanderte, hauptsächlich in Gestalt handgefertigter Kopien und oft variiert, viele Jahre lang durch die gebildeten Kreise, bis sie sich der Klempner Charles Darrow (1889-1967) aus Germantown in Pennsylvania zu eigen machte: Er vereinfachte das Spiel, passte es an die Erfordernisse der technischen Reproduktion an und begann mit der Serienfertigung. Vor allem aber gab er ihm den Namen „Monopoly“ (oder er lieh sich ihn aus), ließ sich das Urheberrecht erteilen und verkaufte das Spiel im März 1935 an die Parker Brothers, ein Unternehmen aus Salem in Massachusetts. Mehr als 275 Millionen Exemplare wurden von „Monopoly“ bis heute hergestellt, auf der ganzen Welt. Es ist das meistverkaufte Gesellschaftsspiel überhaupt – und neben Schach das beliebteste Brettspiel. Und weil Charles Darrow so klug war, seine Rechte nicht für einen festen Betrag abzutreten, sondern Tantiemen aushandelte, wurde der Heizungsbauer zu einem reichen Mann.
Der Zürcher Kunst- und Architekturhistoriker Andreas Tönnesmann erzählt nun diese Geschichte noch einmal. Zugleich aber verwandelt er die Entstehung und allmähliche Gestaltung des Spiels in einen Gegenstand der Ideen- und Kulturgeschichte. Er entfaltet ihn also in seinen historischen und systematischen Bezügen, beginnend mit dem Beruf des angeblichen Erfinders: Denn hatte nicht Adolf Loos, eine der Gründergestalten der Moderne in der Architektur, den „plumber“, den Klempner, im Jahr 1898 einen „Pionier der Reinlichkeit“ genannt und ihn zum „ersten Handwerker im Staate“ erhoben? Stammen die Straßennamen des amerikanischen Originals nicht aus Atlantic City, einem damals noch weitgehend neu errichteten Badeort, gut hundert Kilometer südöstlich von Philadelphia? Und entpuppt sich Charles Darrows angebliche Erfindung nicht schon deshalb als Plagiat, weil er beim Kopieren einen Schreibfehler im handgefertigten Exemplar des „Landlord’s Game“ seiner Bekannten Charles und Olive Todd (das zum „Atlantic City Game“ mutiert war) übernommen hatte?
Das Spiel „Monopoly“ gilt als zwar arg vereinfachte, aber höchst konsequente Übertragung kapitalistischen Handels in die Spielform. Es belohnt, wie Andreas Tönnesmann schreibt, das unternehmerische Verhalten. Es duldet, bestenfalls, den Sparer und Bewahrer. Und es bestraft den Konsumenten, den begeisterten Spieler, der allzu gern investiert. Es ist deswegen auch immer wieder zu pädagogischen Zwecken benutzt worden. Es sei, schrieb Elizabeth Magie Phillips in ihren Patentanträgen: „educational in its nature“. Und es durfte deswegen in die kommunistischen Staaten nicht eingeführt werden. Zuletzt wurde das Spiel, im Jahr 2001, indessen auch in China zugelassen.
Je tiefer sich aber nun Andreas Tönnesmann in die Hintergründe des Spiels hineinarbeitet, desto mehr verliert sich der Eindruck, man habe es hier tatsächlich mit der freien Marktwirtschaft in einer spielerisch überhöhten Form zu tun. Oder anders gesagt: Folgt man den Gedankengängen Andreas Tönnesmanns, gehen die Eigenheiten und Beschränkungen des Spiels weniger auf die Notwendigkeit zurück, es tatsächlich spielbar werden zu lassen, auf möglichst schnelle und spannende Weise. Vielmehr erkennt er lauter ideologische Vorgaben in diesem Spiel, und zwar vorzugsweise der kritischen Art. Deswegen komme Eigentum in diesem Spiel nur in Gestalt von Geld und Immobilien vor; dahinter verberge sich das Ideal einer „single tax“ auf Grundeigentum. Aus demselben Grund sei die Arbeit keine Kategorie, die sich bei „Monopoly“ auf irgendeinem Feld oder irgendeiner Ereigniskarte wiederfinde. Deswegen auch gebe es eine Art garantiertes Mindesteinkommen – die feste Summe, die jeder Spieler erhält, wenn er auf seinen Runden wieder über „Los“ kommt. Deswegen gebe es im Spiel keine Religion und keine Kulturindustrie (Elizabeth Magie Phillips war Quäkerin und duldete daher weder Kirchen noch Theater). Und deswegen verfolge die Bank kein eigenes Gewinninteresse. Führt man diese Motive an ihr Ende, muss der ursprüngliche, kritische Impuls des Spiels gebrochen erscheinen durch die Notwendigkeit, es unterhaltsam werden zu lassen: Es ist, als habe sich der reine Kapitalismus hier zumindest halb versehentlich durchgesetzt.
Jedem dieser Motive geht Andreas Tönnesmann mit großer Neugier nach. Und bald entfaltet sich vor dem Leser ein ganzes Tableau, dessen dramatischer Höhepunkt die Ehrenrettung des Plagiators Charles Darrow gegen seine Entlarver ist – und von letzteren gibt es viele. Sein Verdienst sei es gewesen, das Spiel in ein Produkt zu verwandeln, ihm Form und Farbe, Plastizität und Gebrauchstüchtigkeit zu verleihen – und, überhaupt, das Bild einer „zusammengehörigen und auch durchschreitbaren Stadt“ in „Monopoly“ geschenkt zu haben. Besonders ausführlich behandelt Andreas Tönnesmann dann auch, in einem eigenen Teil seines Buches, die Herkunft des Spiels aus dem Geist der urbanen, architektonischen Utopie. Denn selbstverständlich ist der Spielplan auch ein Stadtplan, und mit genügend Bildung und Phantasie lässt sich Vitruvs antike Idealstadt („ordinatio“ und „symmetria“) wie auch die „Broadacre City“ (1935) des Architekten Frank Lloyd Wright darin erkennen.
So gründlich werden die Motive verfolgt, dass der Leser ins Zweifeln gerät: Wenn in „Monopoly“ gar nicht freie Marktwirtschaft gespielt wird, sondern ein Kapitalismus, in dem Geschichte und Staat (in Gestalt von Regeln) von allen Seiten beschränkend eingreifen – wo kann dann noch der Reiz des Spieles liegen? In einer wirtschaftlichen und ästhetischen Utopie? In der Kritik, ganz so, als wäre „Monopoly“ nicht Gegenbild, sondern Illustration der Weltwirtschaftskrise in den dreißiger Jahren? In der Bloßstellung von Gier? Das Spiel lebt doch von der Vorstellung, dass es darin, im Grunde genommen, zugeht wie im wirklichen Leben. Ist es da nicht wahrscheinlicher, dass die Einschränkungen metaphorisch zu verstehen sind? Dass das Spiel also keine Reflexion auf den Kapitalismus darstellt, wie Andreas Tönnesmann ausführt, sondern dass es ein Dokument der Vorstellungen ist, die seine Anhänger von ihm hegen? Nur, dass diese auf das Wesentliche reduziert erscheinen.
Denn am Anfang sind ja, wie in der reinen Lehre der freien Marktwirtschaft, alle Spieler gleich. Jeder verfügt über das gleiche Kapital, und auch das Würfeln geht für alle gleich. Und so geht das Spiel voran, dem Bewegungsgesetz der Geldvermehrung folgend. Denn insgesamt gesehen, steigen die im Spiel repräsentierten Werte unaufhörlich. Nur dass der Ertrag (oder Verlust) dem Widerspiel von Geschick und Zufall unterworfen ist und sich dann jeweils sehr unterschiedlich darstellt. Für den Einzelnen produziert die ursprüngliche Gleichheit, wenn sie dem individuellen Vermögen und der Gewalt des Würfels unterworfen wird, also eine Ungleichheit nach der anderen. Und wenn die Maximalmieten höher sind als die Kaufpreise der Grundstücke, dann muss auch darin keine Gesellschaftskritik verborgen sein (für Tönnesmann Illustration des entfesselten Kapitalismus), sondern nur das Bedürfnis, dem Spiel mehr Dynamik zu verleihen. Denn es dauert auch schon so länger, als die meisten Spieler ertragen, bis am Ende nur einer übrigbleibt – der, im äußersten Fall, der Bank gefährlich nahekommt.
Die Bank trägt in „Monopoly“ im Übrigen einen falschen Namen, weil sie den „Partikularinteressen“ der Spieler systematisch entzogen ist (Andreas Tönnesmann vermutet darin eine Korrektur des Bankwesens, so wie es die Weltwirtschaftskrise verursachte). Sie ist also nicht das kommerziell ausgerichtete Unternehmen, das wir unter einer Bank verstehen. Vielmehr ist sie der Staat, der die Grundlage allen Wirtschaftens bildet, der das Geld schafft und zur Verfügung stellt und der die Verhältnisse der Spieler zueinander beaufsichtigt. Das Grundeigentum stellt, auf diesem Fundament, das Eigentum schlechthin dar. Und wenn in „Monopoly“ keiner arbeitet, also keiner eine produktive Leistung erbringt, sondern jeder von den finanziellen Tributen zu leben versucht, die der Handel mit Immobilien hervorbringt, so verbirgt sich darin die schlichte Wahrheit, dass Arbeit für den Unternehmer nicht als etwas Selbständiges oder Produktives erscheint, sondern als Bestandteil der Betriebskosten. Für die Eigenheiten und Beschränkungen des Spiels lassen sich also Erklärungen finden, die dem freien Wettbewerb immanent sind.
Und noch etwas lässt Andreas Tönnesmann aus, weil er sich so ganz auf die in diesem Spiel verborgene Kulturgeschichte konzentriert: Dass es in Nordamerika eine Art ursprünglicher Akkumulation gegeben hatte, die unmittelbar mit der Verwandlung von Land in Immobilien zu tun hatte. Nämlich die Besiedlung des Westens, darin eingeschlossen der „Homestead Act“ aus dem Jahr 1863, der jedem Siedler eine Parzelle von gut sechs Hektar zusprach. Diese Siedlungspolitik findet sich auf dem Spielbrett wieder. Und nicht nur dieses Element der ursprünglichen Akkumulation in den USA ist darauf wiederzuerkennen: Denn wenn es auf dem Spielbrett zwar ein Gefängnis gibt (dargestellt durch ein trauriges Gesicht hinter Gittern) und einen Polizisten, aber ansonsten keine Staatsgewalt, dann mag man darin durchaus den souveränen Sheriff des Wilden Westens mit seinem rohen Gehäuse vermuten.
Zu den völlig einleuchtenden Geschichten, die Andreas Tönnesmann über „Monopoly“ erzählt, gehört der Bericht, wie sich das Spiel über die Welt ausbreitete – und zwar nicht nur in seiner amerikanischen Form, sondern angepasst an die Verhältnisse des jeweiligen Landes. Gewiss, da ist von vornherein die soziale Hierarchie gegenwärtig, von der Badstraße bis zur Schlossallee. Aber die Symbole (die Hausformen, die Lokomotive, die Währungszeichen) ändern sich genauso wie die Namen, und während sich, abgesehen von Atlantic City in der amerikanischen Urform, zuerst die Geographie der Hauptstädte in „Monopoly“ spiegelt, setzt sich doch in vielen Ländern mit der Zeit ein Föderalismus oder Pluralismus durch, der am Ende in eine Nomenklatur der Landschaften oder in geographisch nicht mehr identifizierbare Räume führt. Das Spiel wird abstrakter – und vollzieht so die Entwicklung des Kapitalismus mit.
Zweierlei fällt in dieser Geschichte besonders auf: zum einen, dass (wenig überraschend) das Spiel eine lange Reihe von satirischen oder gesellschaftskritischen Varianten provoziert, vom „Anti-Monopoly“ (1973) des amerikanischen Wirtschaftswissenschaftlers Ralph Anspach bis zu einem deutschen Spiel namens „Klassenkampf“ (1978), an dessen Gestaltung sich der Journalist Martin E. Süskind und der Historiker Peter Brandt beteiligten. Keine kritische Variante aber setzt sich auch nur annähernd gegen das Original durch. Zum anderen, dass „Monopoly“ in Europa erst nach dem Zweiten Weltkrieg zu einem durchschlagenden Erfolg wird.
Das aber dürfte nicht nur, allgemein, daran liegen, dass sich die amerikanische Form des Kapitalismus in Europa erst nach dem Krieg vollends durchsetzt. Sondern auch daran, dass Europa erst nach 1945 die Voraussetzung dieses Spiels erreicht: Denn erst die restlose Kapitalisierung der Immobilie schafft die Voraussetzung dafür, die Immobilie als Sinnbild für Kapital schlechthin zu betrachten.
Andreas Tönnesmann
Monopoly. Das Spiel, die Stadt und das Glück
Verlag Klaus Wagenbach. Berlin 2011. 142 Seiten, 22,90 Euro.
„Rücken Sie vor
bis zur
Schlossallee!“
„Bankirrtum
zu Ihren
Gunsten“
Fotos: SZ
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de

Schulen gibt es dort zwar nicht, nur Immobilien und Gefängnisse. Der Kunsthistoriker Andreas Tönnesmann deutet Monopoly aber trotzdem als Spiel gewordene Variante einer Idealstadt.
Von Hannes Hintermeier
Monopoly spielen heißt zu wissen, dass es Stabilität und Verlässlichkeit gibt." Das behauptet der Autor gleich in der Einleitung, und man ist versucht ihm zu widersprechen. Stabil und verlässlich ist an "Monopoly" nur, dass es zeitraubend und nervenzerfetzend ist, dass die meisten Spieler am Ende gedemütigt herumsitzen - bis auf jenen Sieger, der seine Mitwelt in einem stundenlangen Zermürbungskampf in den Ruin getrieben hat. Damit ist klar: Nur Gewinnertypen haben eine Chance, Sparer und Konsumenten sind gezeichnet. So ist das eben im Kapitalismus?
Hier lauert gleich der nächste fundamentale Irrtum, der "Monopoly" wegen seiner Grundidee der Kapitalvermehrung als das exemplarische Spiel des Kapitalismus beschreibt. Mitten in der größten Staatsschuldenkrise kann man feststellen, dass diese mit "Monopoly" wenig zu tun hat. Vor allem die "Monopoly"- Bank gebärdet sich geradezu wie ein Instrument des Fürsorgestaats. Sie wirft ohne nachzufragen pro Runde viertausend Spielmark aus, prüft keine Kreditwürdigkeit, hat mithin mit den zeitgenössischen Instituten nur den Namen gemein.
Auch fehlen in der Stadt Monopoly Kirchen, Schulen, Kindergärten, Theater und Schwimmbäder. In der fiktiven Kommune mit ihrer blassgrünen, an der Farbgebung des Dollars orientierten Aufmachung, gibt es auf einem quadratischen Spielbrett nur eine Richtung, und die führt durch die soziale Schichtung. Von der Badstraße bis zur Schlossallee. Gearbeitet wird hier gar nicht, und das Gesetz scheint willkürlich zu sein, erinnert an den Wilden Westen mit einem allmächtigen Sheriff, weniger an einen Rechtsstaat: Man kommt ebenso zügig ins Gefängnis wie gegen einen vergleichsweise milden Obulus wieder heraus. Die Deckungsgleichheit mit dem wirklichen Leben ist zu vernachlässigen. Und doch hat der Zürcher Kunst- und Architekturhistoriker Andreas Tönnesmann mehrere Tiefenschichten ausgemacht, während er sich an die Spur dieses gut erforschten Geheimnisses der Spielewelt heftete.
Die Geschichte des "Monopoly"-Erfinders wird hier nicht zum ersten Mal erzählt. Der Heizungsbauer und Installateur Charles B. Darrow aus Germantown, Pennsylvania, erhielt am Silvestertag des Jahres 1935 das Urheberrecht für ein Spiel, das er selbst gar nicht erfunden, sondern nur marktgängig gemacht hatte. Dennoch hat man dem Plagiator weithin verziehen, dass er sich bei Elizabeth Magie Phillips bediente, die 1904 mit "Landlord's Game" die Vorlage von Monopoly zum Patent angemeldet hatte.
Phillips besaß freilich etwas, was dem Praktiker Darrow fehlte - geistigen Überbau. Sie hing der Lehre des Ökonomen Henry George an, der mit einer Single Tax ausschließlich Bodenbesitz besteuern wollte. Bei Darrow ist das Echo dieser Idee der Drang zu Immobilien- und Geldbesitz. Auch jenseits des Bretts: Er wollte das dreißig Jahre alte Spiel in der von ihm entwickelten gehobenen Ausstattung an Parker Brothers verkaufen. Die lehnten zunächst ab, beeilten sich dann aber, für fünfhundert Dollar Frau Phillips das Patent abzukaufen. Denn Darrow hatte das Spiel auf eigene Faust auf den Markt gebracht, indem er seine von Hand produzierten Spiele im größten Kaufhaus Philadelphias plazierte: Wanamaker's Department Store war ein Hochglanz-Tempel der Warenwelt, und vier Dollar für Monopoly waren keine Kleinigkeit.
Tönnesmann erzählt die Geschichte des Spielbretts, der Karten und Figuren und die seiner vielen Ländervarianten in großer Detailliertheit. Einmal mehr sind es die Schweizer, die den auffallendsten Sonderweg wählen. Aus achtzehn Städten des Landes kommen die Straßennamen auf dem Brett, die eidgenössischen Sprachgruppen sind prozentual korrekt verteilt. Israel glänzt gleich nach dem Zweiten Weltkrieg mit einer Raubkopie, im gesamten Ostblock ist das Spiel bis 1989 verboten, aber in vielen Exemplaren verbreitet; in China ist es erst seit zehn Jahren auf dem Markt. Mit 43 Länderausgaben und 275 Millionen verkauften Exemplaren ist Monopoly Weltrekordhalter.
Verankert sieht Tönnesmann das Spiel im Geiste der Wirtschaftskrise, welcher Präsident Franklin D. Roosevelt mit den Reformen des "New Deal" von 1933 an zu Leibe rückte, um der lahmenden Wirtschaft auf die Beine zu helfen und der hohen Arbeitslosigkeit Herr zu werden. Seine Infrastrukturmaßnahmen finden ihren Widerhall in den vier Bahnhöfen, dem Parkplatz sowie dem Wasser- und Elektrizitätswerk. Diese zeitgeschichtliche Grundierung weitet der Autor in eine sehr grundsätzliche geistesgeschichtliche Einordnung - indem er das Spielbrett als Stadtplan interpretiert.
Das geschieht zunächst anhand einer Geschichte der Idealstadt, beginnend bei Baumeistern der Renaissance wie Filarete, es folgen die politische Utopie des Thomas Morus, die städtebaulichen Visionen Albrecht Dürers bis hin zu Frank Lloyd Wrights weitläufige, auf Autoverkehr zugeschnittene Idealstadt Broadacre City. Wie diese verbinde Monopoly "die maximale Symmetrie des Kreises mit der Gerichtetheit des Vierecks". So hebt Tönnesmann das Spiel in gedankliche Höhen, ernennt es zum politischen Kommentar und zum Erbe der klassischen Idealstadt. "Monopoly" soll eine Allegorie auf die moderne Stadt sein, als kritischer Gegenwartskommentar gelesen werden.
Um argumentativ dorthin zu gelangen, bemüht er sich zu häufig der Möglichkeitsform. Anders als in allen Städten, gebauten wie erdachten, kann man im Spiel keine Abkürzungen nehmen. Sein Erfinder Charles Darrow würde sich wundern über solchen geistigen Ritterschlag. Um es ebenfalls mit einem Konditionalis zu sagen: Hätte er gewusst, dass "Monopoly"in den Augen seines Interpreten ein "Transporteur eines positiv verstandenen Gesellschaftsentwurfs" ist, hätte er bei Parker Brothers noch ein paar Prozente mehr Beteiligung herausgeschlagen.
Andreas Tönnesmann: "Monopoly". Das Spiel, die Stadt und das Glück.
Verlag Klaus Wagenbach, Berlin 2011. 142 S., geb., 22,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
Alexander Cammann hat sich von der Studie über das Spiel "Monopoly" vom Kunst- und Architekturhistoriker Andreas Tönnesmann nicht nur gut unterhalten lassen. Denn kurzweilig und in flüssigem Stil schreibt der Autor die Geschichte von "Monopoly", die mitten in der amerikanischen Wirtschaftskrise beginnt, und berichtet vom Erfinder des Spiels, der eigentlich ein "Plagiator" war, wie wir erfahren. Die Ausführungen haben laut Rezensent aber noch einen besonderen Clou, weil Tönnesmann überzeugend darlegt, dass das urkapitalistische Gesellschaftsspiel, dem man immer wieder mit moralisierender Kritik beizukommen suchte, einem "fundamentalen utopischen Prinzip" gehorcht. Wenn der Autor dann auch noch vom Stadtplan des Spielbretts auf die Ideengeschichte der Idealstadt von der Renaissance bis in die Gegenwart kommt, ist ihm die ungeteilte Aufmerksamkeit des sehr eingenommen wirkenden Rezensenten gewiss.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH