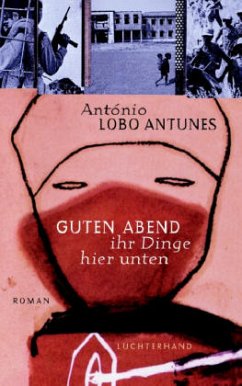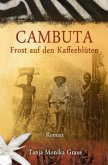Dieser Roman von Lobo Antunes ist nichts Geringeres als ein Porträt Angolas in den letzten vierzig Jahren, von der Kolonialzeit und ihrem Ende in einem blutigen Bürgerkrieg bis zu Korruption und Gewalt in der Gegenwart. Zu Wort kommen die Schwachen, die Betrogenen, die Verlassenen: eine Geschichte von unten in Lobo Antunes' einzigartiger Sprachmelodie.
27 Monate lang war António Lobo Antunes Anfang der sechziger Jahre als Militärarzt in Angola, immer wieder tauchte die persönliche, traumatische Kriegserfahrung in seinen Büchern auf. Lange hielt er es nicht für möglich, einen Roman »nur« über Angola zu schreiben. Nun liegt er vor. Eine Geschichte vom Ende der jahrhundertelangen Kolonialherrschaft Portugals in diesem Land im südwestlichen Afrika bis heute, eine Geschichte von Macht, Korruption und Gewalt, erzählt von den ewigen Verlierern, denen es nicht gelingt, sich zu bereichern, die fallengelassen, betrogen, getötet werden.
Angola ist für den portugiesischen Geheimdienst in ers
ter Linie wegen seiner Diamanten interessant, und daher reisen im Laufe der Jahre mehrere Geheimdienstagenten in das Kriegsgebiet, um gestohlene Diamanten nach Lissabon zu holen. Keinem von ihnen gelingt es, die Aufgabe zu bewältigen. Keiner von ihnen kehrt ins Heimatland zurück. Von ihren Erlebnissen, von Angola und Portugal erzählen Diamantenschmuggler, Agenten, Prostituierte und Soldaten, und in der Verschmelzung all dieser persönlichen Erfahrungen und Erinnerungen entsteht eine schonungslose, ergreifende Geschichte von unten.
Durch die Vielstimmigkeit, durch die fragmentarischen Sätze, die Melodien und Rhythmen bilden und sowohl zwischen Personen als auch zwischen Gegenwart und Vergangenheit springen, gewinnt dieser Roman jene einzigartige Musikalität, wie sie alle Werke Lobo Antunes' auszeichnet.
27 Monate lang war António Lobo Antunes Anfang der sechziger Jahre als Militärarzt in Angola, immer wieder tauchte die persönliche, traumatische Kriegserfahrung in seinen Büchern auf. Lange hielt er es nicht für möglich, einen Roman »nur« über Angola zu schreiben. Nun liegt er vor. Eine Geschichte vom Ende der jahrhundertelangen Kolonialherrschaft Portugals in diesem Land im südwestlichen Afrika bis heute, eine Geschichte von Macht, Korruption und Gewalt, erzählt von den ewigen Verlierern, denen es nicht gelingt, sich zu bereichern, die fallengelassen, betrogen, getötet werden.
Angola ist für den portugiesischen Geheimdienst in ers
ter Linie wegen seiner Diamanten interessant, und daher reisen im Laufe der Jahre mehrere Geheimdienstagenten in das Kriegsgebiet, um gestohlene Diamanten nach Lissabon zu holen. Keinem von ihnen gelingt es, die Aufgabe zu bewältigen. Keiner von ihnen kehrt ins Heimatland zurück. Von ihren Erlebnissen, von Angola und Portugal erzählen Diamantenschmuggler, Agenten, Prostituierte und Soldaten, und in der Verschmelzung all dieser persönlichen Erfahrungen und Erinnerungen entsteht eine schonungslose, ergreifende Geschichte von unten.
Durch die Vielstimmigkeit, durch die fragmentarischen Sätze, die Melodien und Rhythmen bilden und sowohl zwischen Personen als auch zwischen Gegenwart und Vergangenheit springen, gewinnt dieser Roman jene einzigartige Musikalität, wie sie alle Werke Lobo Antunes' auszeichnet.

„Guten Abend ihr Dinge hier unten”: Die große Kunst des António Lobo Antunes
Die meisten Bücher sind nachsichtig mit ihrem Publikum, nehmen es nicht übel, wenn die Tage ungelesen vergehen. Sobald die Neugier zurückkehrt, öffnen die Bücher freudig ihre Pforten, und alles ist wie ehedem. Die Figuren, die man vor zwei oder drei Wochen hinter sich ließ, stehen blitzblank und unlädiert wieder auf, nach wenigen Seiten weiß der Leser: Ja, so ist es gewesen. Die Bücher des António Lobo Antunes hingegen werben nicht um Aufmerksamkeit. Sie kommen spröde daher, verrätselt, herrisch; wer für einen Tag mit der Lektüre aussetzt, geht verloren im Gestrüpp der Zeiten, Figuren und Erzählstränge. Dennoch gibt es kaum ein aufregenderes Leseabenteuer als die Reise in diesen Kosmos der Niedertracht und der Ängste. Weshalb?
Auch auf den neuen 750 Seiten triumphiert der unverwechselbare Antunes-Sound, der das Entlegenste zusammenbindet und neue, innere Wirklichkeiten schafft: „Er steckte mir den lebenden Fisch seiner Hand entgegen, der gerade aus dem Eimer der Tasche herausgezogen worden war, sich wehrte, protestierte, sich beruhigte”. Auch in „Guten Abend ihr Dinge hier unten” erkennt man das Kapitelende daran, dass hier und nur hier ein Punkt den Satz beschließt, weshalb wir es, streng genommen, mit 32 Sätzen von jeweils rund 25 Seiten zu tun haben. Innerhalb der Kapitel wird das Komma nur geduldet. Einzig der Spiegelstrich sorgt für den Anschein von Ordnung, indem er die wörtliche Rede ankündigt.
An wen diese gerichtet ist, wer spricht und wer hört, ob überhaupt geredet und nicht nur gedacht wird, erschließt sich oft erst im Nachhinein, eine Zeile, eine Seite, vier Kapitel später. Allein nach Art musikalischer Leitmotive wiederkehrende Wendungen - „ich, ein Schwanz, ein felliges Auge, ein Horn”- geben zuverlässig Aufschluss, wessen Bewusstsein sich äußert. „Haben Sie keine Angst”, sagt Artur Seabra, der sich gerne mit einem Stier vergleicht, „das ist eine Wortgeschichte, alles erfunden, alles Lüge”. Auch ihm gilt die Mahnung des Geheimdienstchefs: „Sie brauchen so lange um eine Geschichte zu erzählen.”
Man mag streiten, ob es 750 Seiten sein müssen, doch deutlich kürzer, entschieden klarer lässt sich diese Geschichte, die die Geschichte Portugals ist und, darüber hinaus, die Geschichte der Menschheit, nicht erzählen. Seabra, dem melancholischen Ex-Geheimdienstmitarbeiter, ist der Schlüsselsatz auch dieses Romans aus der Ein-Mann-Werkstatt des Lobo Antunes zugeordnet: „Die Hölle besteht darin, dass wir uns die ganze Ewigkeit lang erinnern”. Seabra will sich nicht erinnern an die fünf Jahre auf einer Fazenda im damals noch portugiesischen Angola, die er okkupierte, indem er deren Vorbesitzer, einen Ex-Geheimdienstmitarbeiter, tötete. Auch Jaime Miguèis, Seabras Mörder im Auftrag des Geheimdienstes, fleht sein Opfer an: „Wann helfen Sie mir, mich an nichts mehr zu erinnern, nichts zu erkennen, mich um nichts zu scheren”. Vergessen will Miguèis „fünfundzwanzig Jahre harmonischer, ruhiger Ehe” nach dem Motto „keinerlei Vertraulichkeiten mit Frauen und Hunden”. Vergessen muss er den Krebstod der Tochter, die mit 37 Jahren starb und ihm den tieftraurigen Satz hinterließ: „Sie kennen von mir nur meinen Zorn.”
Das postmoderne Kainsmal
In den Jahren kurz vor und kurz nach der Unabhängigkeit Angolas anno 1975 lösen die Männer in ihrer erfolglosen Arbeit einander ab: der Geheimdienst schickt sie nach Luanda, damit sie „einem Kerl den Kopf zurechtrücken, der dem Dienst Schaden zufügt”, damit sie „die Reste eines Ihrer Kollegen wegräumen”, ihn töten. Bestraft werden soll das jedesmal identische Vergehen: In die eigene Tasche wirtschafteten Seabra und dessen Vorgänger. Sie sind dem Geheimdienst, der den Diamantenhandel kontrollierte, in die Quere gekommen, haben die kostbaren Steine gehortet, statt den Profit nach Lissabon weiterzuleiten. Keiner kehrt in die Heimat zurück. Der 61-jährige Miguèis tötet Seabra, ehe er dem jungen Major Morais zum Opfer fällt. Und Morais wünscht sich nur eins: nicht mehr zu sein, „in der Lücke zwischen den Sofakissen zu versinken”.
Wie beschädigt ist ein Leben, das nur der Traum von der Verlöschung am Dasein hält? Sind es private Defekte, die die Figuren so übel zugerichtet haben? Die Gier, die Triebe, die Einsamkeit? Zwei Phänomene von globalem Rang bildet das Werk des ewigen Nobelpreiskandidaten ab: die Unerzählbarkeit der Gegenwart und die seelische Überforderung der Gegenwartsmenschen - laut Lobo Antunes deren postmodernes Kainsmal. Diese Versager, Verdränger, Verächter sind keine landestypische Spezialität, wie sie nur Portugal hervorbringen konnte. Seabra, Miguèis, Morais leiden an den Demütigungen, die sie sich mit ihren eigenen Gedanken zufügen. Sie sind das Produkt des Bildes, das sie sich von der Welt und sich selbst machen.
Von Überforderung zu Überforderung stolpern die Missetäter, weil sie gefangen sind im Strudel der Selbstbezüglichkeit. Nervenreize sind die anderen, die Lust verschaffen oder Qual, niemals aber als autarke Subjekte wahrgenommen werden: lebende Fische, feixende Dinge allesamt. Der Nebenmensch ist das Ding gegenüber. Das selbstbezügliche Bewusstsein entstellt jedes Leben zur Sache, auch das eigene: „Ich bin so viele verstreute Dinge”, ahnt Major Morais, „bin zufrieden darüber, dass ich in mir nichts bin, ich Scheiben, die sich auflösen, eine der Scheiben der rechte Arm, der im Sofa steckt, und gleich darauf keine Scheibe mehr, ich ein Nichts das hört.”
Schließlich überleben die wahren Dinge die Dingmenschen, triumphieren Bügelbrett, Balkon und sogar das Symbol vollendeter Sinnlosigkeit, Morais Porzellankästchen, „das zu nichts weiter nützte, als einen Schlüssel zu verwahren, von dem wir nicht wussten, zu welchem Schloss er gehörte.” Miguèis endet als „Kadaver einer Möwe”, der müde Seabra muss sich an nichts mehr erinnern. Einzig Miguèis krebskranke Tochter verlässt das Buch und ihr Leben mit linderen Gedanken, „ich Flamingos, ich Seeschwalben.” Fast tröstlich klingt die Imagination ihres Todes. Sie sieht die brennende angolanische Fazenda vor sich und daneben die Kaffeeplantage, „auf der es jetzt ja Tag wird.” Dass es einmal wenigstens tagen wird: mehr Utopie gestattet sich und uns Lobo Antunes nicht.
ALEXANDER KISSLER
ANTÓNIO LOBO ANTUNES: Guten Abend ihr Dinge hier unten. Aus dem Portugiesischen von Maralde Meyer-Minnemann. Luchterhand Literaturverlag, München 2005. 750 Seiten, 24,90 Euro.
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Eine Dienstleistung der DIZ München GmbH

António Lobo Antunes entwirft in seinem Roman das Bild eines Kontinents und das Panorama einer Epoche
Dieser Roman von António Lobo Antunes ist beides zugleich, ein Meisterwerk und eine Zumutung - das diametrale Gegenteil des Unterhaltungswerts, den manche Kritiker an Büchern junger deutscher Autoren loben: Stichworte "lineares Erzählen" und "leichte Lesbarkeit". Statt dessen tritt die Handlung auf der Stelle oder dreht sich so lange im Kreis, bis dem Leser schwindlig und schwarz vor Augen wird und er die wechselnden Protagonisten kaum noch voneinander unterscheiden kann. Die Verunsicherung ist gewollt, ebenso die sprachliche Redundanz und der Wiederholungszwang des Textes, denn es geht nicht um eine chronologisch erzählte Geschichte, die Anfang und Ende hat, sondern um das Eintauchen in eine verdrängte Vergangenheit, deren spiralförmiger Sog den Erzähler - und mit ihm den Leser - immer tiefer in seinen Strudel zieht: ein Sprach- und Bewußtseinsstrom, genauer gesagt ein innerer Monolog, wie man ihn von Faulkner und Uwe Johnson kennt oder auch aus den Romanen von Claude Simon. Am Ende addiert sich die Vielfalt einander überschneidender oder ins Wort fallender Stimmen, flirrender Einzelbeobachtungen und irritierender Details zu einem pointillistischen Gemälde, aus dessen verschwimmenden Konturen dem Leser das Bild eines Kontinents und das Panorama einer Epoche vor Augen treten.
Es geht um Portugals faschistische Vergangenheit, auf deren Ruinen nach der sogenannten Nelkenrevolution von 1974 eine Europa zugewandte, moderne Demokratie entstand, die sich vom Schmuddelkind zum Musterschüler der Europäischen Union entwickelt hat. Wie Dante und Vergil in der Unterwelt nimmt der Autor den Leser an der Hand und führt ihn durch die Katakomben der portugiesischen Kolonialgeschichte, in deren Labyrinth nicht nur Akten, sondern auch Tote lagern, die es nach offizieller Lesart nie gegeben hat. Die Leiche im Keller heißt Angola, und im Originalton des Autors hört sich das so an: "Ich wurde darum gebeten, daß wir dieses Problem in Angola lösen, und wir haben es gelöst, indem wir zuerst die Neger zerstörten, uns den übriggebliebenen Negern anboten, damit sie uns zerstörten, bis für die Amerikaner, die dann kommen würden, nur noch Bailundos übrig waren, die auf ihren Tod wartend dasitzen, nur noch ich, der ich auf meinen Tod warte, und eine Mulattin, die uns alle mit dem Palmstrohfächer vor den Fliegen schützt . . ."
António Lobo Antunes' Roman schildert das Geschehen nicht aus auktorialer Zentralperspektive, sondern aus der Froschperspektive nicht selbst handelnder, sondern vom Handeln anderer betroffener Personen, über die der Orkan der Geschichte hinwegfegt ohne Rücksicht auf die Individuen. Das Auge des Sturms, will sagen, der allwissende Erzähler von einst mutiert zum Geier, der den Worten eines verwundeten Soldaten, es gehe ihm gut, keinen Glauben schenkt und langsam näher hüpft, während dieser den Knieverband fester zurrt. Aber kein Schnabelhieb macht ihm den Garaus, sondern ein Kolbenschlag ins Genick, mit dem ein Vorgesetzter oder Kamerad ihn von seinen Qualen erlöst.
Was in Angola geschah, war kein schmutziger kleiner Kolonialkrieg, der mit der Entlassung in die Unabhängigkeit endete, denn danach fing das Morden erst richtig an. Es gab drei rivalisierende Befreiungsarmeen, die sich in wechselnden Allianzen bekämpften: Agostinho Netos marxistisch orientierte MPLA, Holden Robertos an der Nordgrenze operierende FNLA und Jonas Savimbis antikommunistische Unita. Die Nachbarländer Zaire (Mobutu) und Südafrikas Apartheidsregime mischten sich ein, und mit brüderlicher Hilfe der DDR führte die Sowjetunion einen Stellvertreterkrieg gegen die Vereinigten Staaten auf dem Boden Angolas, wo südafrikanische und kubanische Söldner sich gegenseitig massakrierten. Hauptopfer aber war die zwischen den Fronten steckende Zivilbevölkerung, auf deren Rücken der Konflikt ausgetragen wurde, und wie im Kongo erwies sich der natürliche Reichtum des Landes als Fluch, der den sich selbst finanzierenden Krieg endlos in die Länge zog: "Das waren nicht einmal die Amerikaner, es hieß, anfangs hätten sie Ölplattformen in Cabinda gebaut und sich dann für andere Dinge interessiert, als sie begriffen hatten, daß die anderen Dinge ihnen auch Geld brachten, das Kupfer, die Baumwolle, der Kaffee, die Waffen, mit denen die Neger sich gegenseitig umbrachten, und über die Waffen kamen sie zu den Diamanten, selbstverständlich nicht direkt, ein paar Holländer, ein paar Russen . . ."
Um Diamanten geht es auch hier, genauer gesagt um eine zynische Geheimdienstintrige, deren Ziel und Zweck sich dem Leser, wie in einem Thriller von John le Carré, erst allmählich, im Lauf der Lektüre, erschließt. In einer als Fabrik getarnten Dienststelle des portugiesischen Geheimdienstes wird ein junger Mann, der zuerst Seabra, später Migueis und dann Morais heißt, von Lissabon nach Luanda in Marsch gesetzt, um im Auftrag seiner Vorgesetzten eine Routineangelegenheit zu regeln, die in vier, fünf Tagen erledigt sein soll, in Wahrheit aber Monate oder Jahre dauert und mit dem Tod der "Zielperson" endet, die kein anderer ist als der Agent selbst. Die Diamanten, mit denen Portugals Geheimdienst im Zusammenspiel mit der CIA verdeckte Operationen finanziert, werden denen zum Verhängnis, die zu ihrer Beschaffung ausgesandt wurden, und die Jäger des verlorenen Schatzes bringen sich gegenseitig um, während das Objekt ihrer Begierde unauffindbar bleibt. Dieses aus Abenteuerromanen bekannte Modell dient dem Autor als Vehikel, um eine ganz andere Geschichte zu erzählen, die wenig mit Diamanten zu tun hat, aber um so mehr mit Portugal, das seine deklassierte Landbevölkerung in die Kolonien exportiert, wo die ungelösten Widersprüche sich dann gewaltsam entladen. Jeder Protagonist des Romans schleppt das Übergepäck einer unbewältigten Vergangenheit mit sich herum, die Kindheit in einem tristen Vorort von Lissabon, den Selbstmord der Mutter oder den sexuellen Mißbrauch durch einen katholischen Pater, und der Traum vom schnellen Reichtum in den Kolonien wird zum Albtraum, in dem nach Angola verschickte Mädchen für den Rückflug nach Lissabon sparen und ihr als Prostituierte verdientes Geld am Strand vergraben.
Anders als John le Carré erzählt António Lobo Antunes nicht bloß eine Spionagegeschichte, sondern macht das Schreiben selbst zum Thema ("Wie schwierig dieser Roman doch ist, er gehorcht nicht"), und es überrascht nicht, daß und wie er gegen die politische Korrektheit verstößt und, statt Afrika schönzureden, die titelgebenden "Dinge da unten" beim Namen nennt: "Als nach der Unabhängigkeit, will heißen, nach Gesängen und Getrommel und ausgeweideten Läden und verlassenen Banken niemand wußte, wo die Angestellten waren, die Polizei unsichtbar war, während Tausende Weiße auf dem Kai zwischen Bündeln, Säcken, Koffern verzweifelten, die die Neger Tag für Tag plünderten, während die Kubaner und die Russen allmählich ankamen, und der Direktor, wütend auf mich, rief den Präsidenten, die Fahne als Zeugen an . . . "
António Lobo Antunes: "Guten Abend, ihr Dinge hier unten". Roman. Aus dem Portugiesischen übersetzt von Maralde Meyer-Minnemann. Luchterhand Literaturverlag, München 2005. 752 S., geb., 24,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension
Rezensent Thomas Laux beobachtet, dass bei diesem Roman ein Thema dominiert, das in Antonio Lobo Antunes' bisherigen Büchern vor allem im Subtext vorkam - nämlich die Erfahrungen, die er als Psychiater in den frühen siebziger Jahren machte, als Portugal in Angola den letzten Kolonialkrieg ausfocht: "Zum ersten Mal dringt Antunes zu diesem verschatteten Kern seiner eigenen Biografie vor." Doch allzu einfach ist die Sinnstiftung nicht. Wer in dem Roman nach einer eindeutigen Botschaft sucht, wird nach Meinung des Rezensenten enttäuscht: Kritik am politischen System finde sich nämlich nicht. Eine konkrete Handlung gibt es kaum, erfahren wir. Dementsprechend bedauert es Laux, dass die Zeiten vorbei scheinen, als "Plot und Diktion" bei Antunes "noch zur Deckung kamen". Der Krieg werde zum "diffusen Echo". Dem Rezensenten hat die Lektüre keinen "genuinen Erkenntniszugewinn" gebracht. Antunes, bedauert er, hat ein spannendes Thema verschenkt.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
"Höchste literarische Kunst." Süddeutsche Zeitung