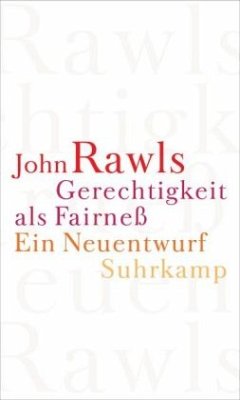Politische Gerechtigkeit muß fair sein. Dies war die Kernaussage von John Rawls Versuch einer Erneuerung der Theorie vom Gesellschaftsvertrag aus dem Jahre 1971. Binnen weniger Monate avancierte sein Werk zu den meistdiskutierten moral- und staatsphilosophischen Programmen der neueren Zeit. Rawls? Gerechtigkeitspostulate und der Aspekt ihrer Durchführbarkeit in bezug auf Institutionen wie auch die Ansprüche an den einzelnen sind als Entwurf einer Gesellschaft, in der das Rechte zugleich als das Gute anerkannt wird, noch immer in der Diskussion.
32 Jahre nach der Veröffentlichung seines fulminanten vertragsrechtlichen Gedankenexperiments, Eine Theorie der Gerechtigkeit, erscheint nun der Neuentwurf, in dem Rawls auf Einwände und Fragen seiner Kritiker reagiert. Er wendet sich darin vor allem dem Begriff der »Justice as Fairness« zu und präsentiert ihn anstelle einer weit ausgreifenden moralischen Doktrin »als eine politische Konzeption der Gerechtigkeit«. Diese Umorientierung macht die Vorführung der Ausgangsideen in veränderter Bedeutung und Signifikanz ebenso nötig wie die Integration vollkommen neuer Aspekte. Rawls Ziel: die realistischere Vorgabe eines gut geordneten Gemeinwesens.
32 Jahre nach der Veröffentlichung seines fulminanten vertragsrechtlichen Gedankenexperiments, Eine Theorie der Gerechtigkeit, erscheint nun der Neuentwurf, in dem Rawls auf Einwände und Fragen seiner Kritiker reagiert. Er wendet sich darin vor allem dem Begriff der »Justice as Fairness« zu und präsentiert ihn anstelle einer weit ausgreifenden moralischen Doktrin »als eine politische Konzeption der Gerechtigkeit«. Diese Umorientierung macht die Vorführung der Ausgangsideen in veränderter Bedeutung und Signifikanz ebenso nötig wie die Integration vollkommen neuer Aspekte. Rawls Ziel: die realistischere Vorgabe eines gut geordneten Gemeinwesens.
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
Ob man nun für "Umbau, Abbau oder Ausbau" sei, ausnahmslos alle Beteiligten am Diskurs um Sozialreformen argumentieren für die unterschiedlichsten Positionen mit dem "Verweis auf Gebote der Gerechtigkeit". So scheint es für Rainer Forst an der Zeit zu sein, den Philosophen John Rawls zu lesen, um endlich zu erfahren, was "politische und soziale Gerechtigkeit" denn eigentlich heißt. Bei dem vorliegenden Band handele es sich um eine Neufassung Rawls' "Theorie der Gerechtigkeit" von 1971, die er zeit seines Lebens weiterentwickelte. Rawls' zentrale Idee sei, "dass die Gesellschaft ein faires System der Kooperation sein solle, das von allgemein geteilten Prinzipien geregelt wird." Diese Prinzipien bedeuten aber nicht bloße "Umverteilung", sondern sollen Strukturen "reiner Hintergrund-Verfahrensgerechtigkeit" herstellen können. Wesentliche Unterschiede zwischen der philosophischen Theorie und politischer Realität sieht Forst darin, dass Rawls verlangt, "wenn Güter ungleich verteilt werden, dann darf dies nur so geschehen, dass es den am schlechtesten Gestellten den größtmöglichsten Vorteil bringt." Gleichzeitig fühle sich Rawls aber auch nicht dazu berufen ein "praktisches Rezept für die Reform des Sozialstaats" zu liefern, aber nach der Lektüre sei einem auf jeden Fall "klarer", wann eine "Art der Politik das Prädikat 'gerecht'" verdiene, resümiert Forst.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Ein ausgeträumter Traum: John Rawls alteuropäische Utopie „Gerechtigkeit als Fairness”
Der im letzten Jahr verstorbene Moraltheoretiker John Rawls gehört zu der verschwindend kleinen Gruppe von Philosophen, die ihr Leben lang im Grunde nur an einem Buch schreiben. So ist denn auch ein autobiografisches Bekenntnis überliefert, wonach Rawls 1955 mit der Arbeit an einem Buch begann, das er glücklicherweise 1971 habe abschließen können. In diesem Jahr erschien „A Theory of Justice”, eine in sechzehn Jahren begrifflicher Mühe ausgefeilte Abhandlung über Gerechtigkeit als Fairness. Mittlerweile zählt die Schrift zu den modernen Klassikern politischer Philosophie.
Das Buch schlug wie eine Bombe ein. Rawls hatte es gewagt, eine materiale Gerechtigkeitstheorie vorzulegen. Bei ihm war wieder von moralischen Vermögen die Rede, von ethischen Werten, vom Guten und Rechten, obwohl sich die philosophische Innung darauf verständigt wähnte, Moralphilosophie könne ernsthaft nur noch als Metaethik betrieben werden. Jahrzehntelang hatte man in der Höhenluft logischer Analyse steiflippige Kontroversen über vertrackte Moralbegründungsprobleme geführt.
Die zweite Provokation, die der in Harvard lehrende Rawls einer irritierten Leserschaft zumutete, bestand darin, dass er seine Gerechtigkeitsauffassung im direkten Widerspruch zum Utilitarismus entwickelte, zu der mächtigsten Strömung in der angloamerikanischen Tradition der Moralphilosophie. Dass der Nettonutzen für das Glück der Meisten die vernünftigste Antwort sei, die sich auf die uralte Frage nach einer gerechten Gesellschaftsordnung formulieren lasse, wollte Rawls nicht einleuchten. Er schrieb, als gälte es, Nietzsches mokante Behauptung zu widerlegen, nur die Engländer strebten nach dem Glück.
Selbstverständlich zog der große Wurf scharfsinnige Kommentare und Einwände auf sich. Aber Rawls wäre nicht der ebenso skrupulös, wie zielstrebig argumentierende Philosoph, als der er weltberühmt wurde, hätte er sich seinen Kritikern gegenüber taub gestellt. Fast vierzig Jahre nach dem ersten Buch erscheint unter dem Titel „Justice as Fairness” ein zweites. Es dokumentiert den Versuch, klarer zu sagen, was unter Gerechtigkeit als Fairness zu verstehen sei. Und weil absolute Klarheit ein hohles Ideal philosophischer Analyse ist, thematisierte Rawls zugleich jene Grenzen, die politischer Philosophie gezogen sind, will sie von Belang für die öffentlichen Angelegenheiten sein. Insofern klärt und kritisiert das letzte Buch von John Rawls zugleich die Geltungsansprüche des ersten. Drastisch werden sie dort zurückgeschnitten, wo „Eine Theorie der Gerechtigkeit” mehr zu sein beanspruchte als ein praktisch-politisches Plädoyer für einen egalitär akzentuierten Liberalismus. Eine von metaphysischen Überzeugungen heimgesuchte Gerechtigkeitsauffassung findet sich in eine explizit politische überführt. Wie eine gerechte Gesellschaft verfasst ist, muss im Ausgang von Ideen expliziert werden, die der historisch gewachsenen, demokratischen Kultur entstammen. Dieser eher hermeneutische Ansatz des späten Rawls hinterlässt Spuren in fast allen Grundbegriffen seiner ursprünglichen Theorie. Eine sehr gute Übersetzung dieser umfassenden Revision erscheint im kommenden Monat auf deutsch, was dem hiesigen Publikum das seltene, übrigens auch ästhetische Vergnügen beschert, ein Buch studieren zu können, wo jeder Satz argumentativen Scharfsinn, systematische Strenge und bürgerschaftliches Ethos versöhnt.
Was Rawls zum Fürsprecher des politischen Liberalismus gemacht hat, ist die Anerkennung dessen, was er „Faktum des vernünftigen Pluralismus” nannte; der Umstand, dass in Gesellschaften Meinungsverschiedenheiten auftreten, die sich vor dem „Richterstuhl der Vernunft” nicht auflösen lassen. Solche Differenzen bedrohen die „soziale Einheit”, begreift man Gesellschaft – wie es Rawls im Geiste der Vertragstheorie tut – als vernünftiges System zwischenmenschlicher Kooperation, zu dem sich die Bürger zusammenschließen, indem sie sich als freie und gleiche Personen achten.
Die Bereitschaft, innerhalb einer Gesellschaft dauerhaft miteinander zu kooperieren, steht und fällt mit zwei Voraussetzungen: Es muss einem jeden ermöglicht werden, den eigenen ethischen Überzeugungen gemäß existieren zu können. Ein Institutionengefüge, eine Verfassung und eine Eigentumsordnung sind notwendig, die alle dafür unabdingbaren Freiheiten garantieren. Darüber hinaus müssen die sozialen Bedingungen gesellschaftlicher Kooperation so eingerichtet sein, dass sie den Gerechtigkeitssinn der Bürger nicht verletzten. Den so geschürzten Knoten soll der Gesellschaftsvertrag entwirren. Und die dafür zentrale Idee bildet jenes Theoriestück, das Rawls die wohl schärfsten Einwände beschert hat. Sein Gedanke ist der, hypothetisch einen „Urzustand” anzunehmen, in dem sich die Mitglieder der Gesellschaft unter Wahrung ihrer Eigeninteressen auf eine institutionelle Ordnung einigen, die ihnen ein Dasein als moralische Personen in der Gesellschaft verbürgt. Soll der gewünschte Konsens angesichts faktischer Ungleichheiten und faktischer Meinungsverschiedenheiten herbeigeführt werden, ist nach Rawls eine „Methode der Vermeidung” fällig. Die Diskussionsteilnehmer sollen sich unter einem „Schleier des Nichtwissens” einigen. Sie dürfen weder um ihre Begabungen, Privilegien oder Benachteiligungen wissen, noch ihr Geschlecht, ihre Konfession oder Glücksvorstellungen kennen. Auch sind ihnen Zwangsmittel verwehrt, mit denen sie womöglich Einfluss auf den Gang des Gesprächs ausübten. Nur so kann es zu einer fairen Verständigung über das institutionelle Arrangement kommen.
Die Pointe der Rawlsschen Überlegung dürfte einsichtig sein. Es sind die fairen Modalitäten des Gesprächs, kraft dessen über eine gesellschaftliche Ordnung entschieden wird, die verbürgen, dass die im Gesprächsverlauf erzielten Resultate gerecht sind. Die Kritik am Utilitarismus hat Rawls zu einem kantischen Konstruktivisten gemacht. So wie in Kants Erkenntnistheorie die Bedingungen der Möglichkeit, Gegenstände zu erkennen, zugleich die Bedingungen der Möglichkeit dieser Gegenstände überhaupt sind, so liest Rawls den konsensermöglichenden Bedingungen eines Gesprächs über eine gerechte Ordnung ab, was wir vernünftigerweise unter Gerechtigkeit überhaupt verstehen können. Aus der Fairness des Verfahrens datiert die Gerechtigkeit des Gesellschaftsvertrags.
Obwohl wir als sterbliche Individuen zu unserem gesellschaftlichen Sein verurteilt sind, lässt sich hier und jetzt ein Vertrag konzipieren, der uns öffentliche Kriterien für die Frage an die Hand gibt, ob die Gesellschaft, in der wir leben, gerecht ist. In die Ausarbeitung dieser Kriterien hat Rawls sein gesamtes intellektuelles Leben investiert. Gerecht ist letztinstanzlich nur diejenige Gesellschaft, deren soziale Wirklichkeit die Selbstachtung ihrer Bürger ermöglicht. Wer so denkt, hat sich einer alteuropäischen Utopie verschrieben, die menschliches Glück und soziale Existenz verwebt. Vieles spricht dafür, dass dieser Traum ausgeträumt ist. Nicht nach Freiheit und Gleichheit, also nach Gerechtigkeit im Rawlsschen Sinne, scheinen die Bürger der westlichen Welt zu verlangen. Ihre größte Sorge gilt gegenwärtig der kollektiven und individuellen Sicherheit. So ist nicht der milde John Rawls, sondern der trockene Thomas Hobbes der Mann der Stunde.
MARTIN BAUER
JOHN RAWLS: Gerechtigkeit als Fairness. Ein Neuentwurf. Suhrkamp Verlag, Frankfurt/M. 2003. 320 S., 24, 90 Euro.
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.diz-muenchen.de

John Rawls' Gerechtigkeitstheorie in letzter Fassung
Der Ruhm der Gerechtigkeitstheorie des kürzlich verstorbenen John Rawls ist erstaunlich, besteht diese doch aus einem einzigen Grundgedanken. Nichts anderem dient die immer noch einflußreichste politische Ethik als der Ausarbeitung einer "Gerechtigkeit als Fairneß", später um die methodische Klarstellung ergänzt: "politisch, nicht metaphysisch".
Dreißig Jahre nach der bahnbrechenden "Theorie der Gerechtigkeit" (1971, deutsch 1975) und knapp zehn Jahre nach der korrigierenden Ergänzung "Politischer Liberalismus" (1993, deutsch 1998) liegt nun eine aus Vorlesungen hervorgegangene Neufassung ("Restatement") vor. Im Deutschen als "Neuentwurf" übersetzt, läßt sie freilich größere Veränderungen erwarten, als Rawls sie tatsächlich vornimmt. Der von Erin Kelly herausgegebene Text soll lediglich gravierende Mängel der Theorie beheben und die Theorie zugleich mit den seither veröffentlichten Abhandlungen zu einer einheitlichen Darstellung verbinden, also so wichtige Neuerungen des Politischen Liberalismus wie die Gedanken der öffentlichen Rechtfertigung und des übergreifenden Konsenses aufnehmen.
Rawls' Grundgedanke und zugleich Titel seiner letzten Buchveröffentlichung "Gerechtigkeit als Fairneß" (zuerst Harvard, 2001) klingt schön, ist aber wenig aussagekräftig. Der erklärende Ausdruck "Fairneß" ist nämlich noch unklarer als die zu erklärende "Gerechtigkeit". Denn für sie fallen einem sogleich zwei unstrittige Momente ein: die Gleichheit, als negativer Kern das Willkürverbot und zusätzlich die Wechselseitigkeit. Bei der Fairneß dagegen sieht man sich zwar an den Sport verwiesen, ohne auf Anhieb sagen zu können, was der Ausdruck dort genau bedeutet. Daß man sich bei einem Spiel an die Regeln zu halten hat, ist ebenso wenig gemeint wie die Strategien, mit denen man zu siegen hofft.
Bei Rawls' Fairneß wird nicht innerhalb von Regeln, sondern um Regeln gespielt, genauer um höherstufige Regeln, die Prinzipien, die die Grundverfaßtheit der Gesellschaft ausmachen. Mit der Maßgabe, dieses Spiel unter "fairen" Bedingungen zu spielen, dreht sich jedoch die Argumentation im Kreis: Um sich auf Gerechtigkeitsprinzipien einigen zu können, muß das Spiel schon selber gerecht strukturiert sein. Das Gerechtigkeitsergebnis des Spiels spiegelt also die Gerechtigkeit der Spielbedingungen, gewissermaßen eine Vorab- oder Proto-Gerechtigkeit, wider. Rawls gibt sich zudem erstaunlich bescheiden. Die gesuchten Prinzipien sollen nicht für jedwede Gesellschaft gelten, sondern lediglich für eine liberale Demokratie, unter der ein faires System der Kooperation von Bürgern verstanden wird, die sich gegenseitig als freie und gleiche Personen anerkennen. In dieser Wechselseitigkeit, die an Aristoteles' Bestimmung der Polis als "Gemeinschaft von Freien und Gleichen" erinnert, liegt die gemeinte Fairneß.
Der Philosoph gibt sich deshalb konzeptuell bescheiden, weil er von einer Wirklichkeit ausgeht, die in der Tat nicht alle Gesellschaften auszeichnet. Nur in liberalen Demokratien, namentlich dem "Modell" Vereinigte Staaten, herrscht ein Pluralismus von durchaus vernünftigen, aber einander widerstreitenden "Weltanschauungen", deren Streit sich vor dem "Richterstuhl der Vernunft" nicht schlichten lasse. Nur in Klammern: Hier wäre ein Blick auf die antike Polis spannend. Denn wenn man an die Gerechtigkeitsansichten denkt, die Platon in der Politeia gegeneinander auftreten läßt, darf man sich die damalige Gesellschaft nicht als "weltanschaulich" schlicht homogen vorstellen.
Rawls spricht von "umfassenden Lehren" (comprehensive doctrines), was nicht ganz glücklich als "Globallehren" übersetzt wird. Merkwürdigerweise versteht Rawls darunter nicht nur Religionen oder Ideologien, sondern auch die Philosophie, obwohl es deren argumentativem Anspruch widerspricht, insbesondere der Bereitschaft, sich dem Richterstuhl der Vernunft zu unterwerfen. In der Klarstellung "nicht metaphysisch" klingt nun der Verzicht auf umfassende Lehren an. Und die positive Ergänzung "politisch" verweist auf eine demokratiefunktionale Theorie. Denn nach Rawls hat die Politische Philosophie vier Aufgaben zu erfüllen, die allesamt im Dienst einer liberalen Demokratie stehen: Sie soll konkurrierende Ansprüche wie Freiheit und Gleichheit gegeneinander abwägen, über Ziele und Zwecke einer historisch gewachsenen Gesellschaft orientieren, mit der prima facie enttäuschenden Wirklichkeit versöhnen, nicht zuletzt eine realistische Utopie entwerfen. Überraschenderweise fehlt eine fünfte Aufgabe, obwohl sie dem Selbstverständnis liberaler Demokratien und darüber hinaus ihrer Herkunft aus der Aufklärungsepoche entspricht: Für ihre Kernelemente beanspruchen liberale Demokratien eine kulturübergreifende Gültigkeit; namentlich in den Menschenrechten und der Volkssouveränität meinen sie, dem Anspruch auch gerecht zu werden.
Überzeugender dürfte daher ein Gegenentwurf sein, der universalistische Kernelemente mit einem Recht auf Besonderheit verbindet. Ohnehin bleibt Rawls' konzeptuelle Bescheidenheit insofern verbal, als sie weder zu den Menschenrechten und der Volkssouveränität noch zu der sie begründenden Fairneß-Konzeption eine Alternative für erwägenswert hält. Statt dessen wiederholt sich die trockene Versicherung: Wir brauchen keine moralische Globaltheorie, sondern die politische Konzeption der Personen als freier und gleicher Wesen, mit der Fähigkeit zur vollen Kooperation in der Gesellschaft.
Die kriteriologische Kraft dieser Konzeption darf man allerdings nicht unterschätzen. Auf die viel erörterte Frage beispielsweise, was denn unter jene Grundgüter fällt, für die ein Gemeinwesen Verantwortung trage, antwortet Rawls mit all dem, was freie und gleiche Personen als Bürger brauchen und sie überdies befähigt, sich für zulässige Vorstellungen eines lebenswerten Lebens einzusetzen. Dieses Kriterium wendet sich gegen eine primär materiell-ökonomische Bestimmung, läßt die Grundgüter statt dessen mit den institutionellen Rechten und Freiheiten der Bürger beginnen und faire Chancen folgen. Erst am Ende kommen Einkommen und Vermögen, aber auch dann nicht sie selbst, sondern die vernünftigen Aussichten auf sie. Zugleich wird der Einwand des Nobelpreisträgers für Wirtschaftswissenschaften, Amartya Sen, entkräftet, Rawls' Gerechtigkeitsprinzipien samt Grundgüterkatalog seien notgedrungen zu unflexibel.
Eine andere klärende Veränderung, die Neuformulierung des ersten Gerechtigkeitsprinzips, wurde durch Einwände des vor zehn Jahren gestorbenen britischen Rechtsphilosophen Herbert Lionel Adolphus Hart erforderlich. Gegen das Mißverständnis, der Freiheit als solcher werde ein Vorrang eingeräumt, "deduziert" Rawls die gleichen Grundfreiheiten nicht, sondern bestimmt sie ausdrücklich nur mit Hilfe einer Liste. Sie soll die aus der Geschichte der Demokratie bekannten verfassungsmäßigen Garantien enthalten, also etwa Gedanken- und Gewissensfreiheit, politische Freiheiten, das Versammlungsrecht und die Unverletzlichkeit der Person. Die Liste wird aber nicht ideen- und verfassungsgeschichtlich, sondern "analytisch" gewonnen, abermals nach Maßgabe der Frage einer Vorab- oder Proto-Gerechtigkeit: Was sind die politischen und sozialen Bedingungen für die Entwicklung und den Einsatz jener zwei moralischen Vermögen, die für freie und gleiche Personen als wesentlich gelten, für die Anlage zum Gerechtigkeitssinn und für die Fähigkeit, sich eine Vorstellung vom Guten zu machen?
Eine dritte Klarstellung liegt in der Zuständigkeit der Gerechtigkeitsprinzipien für das Innenleben von Organisationen und Verbänden jedweder Art. Während andere politische Philosophen zu dem Thema lieber schweigen, scheut sich Rawls nicht, jenen "fundamentalistischen" Strömungen in Synagogen, Kirchen oder Moscheen entgegenzutreten, die eine tätige Intoleranz praktizieren, Ketzerei als Verbrechen behandeln und ihren Mitgliedern den Austritt verbieten. Ebenfalls gelten die Gerechtigkeitsprinzipien für die Basisinstitution der politischen Gesellschaft, die Familie. Die Gleichheit etwa, die den Frauen zu gewähren sei, verlange bei einer Scheidung, der Ehefrau als Ausgleich für das "Gebären, Erziehen und Versorgen der Kinder" (man muß ergänzen: wenn es sie denn gibt!) die Hälfte des während der Ehe angefallenen Vermögenszuwachses zuzusprechen.
Zieht man Bilanz, so muß man dem englischen Untertitel ohne weiteres recht geben: Die eher kleineren Veränderungen, die man findet, belaufen sich auf nichts mehr als eine "Neuformulierung", geschrieben in Rawls' Stil: Ohne literarische Ambitionen, außer dem Ehrgeiz zu einer klaren, differenzierten, oft scharfsinnigen Argumentation nimmt der Autor in Kauf, gelegentlich pedantisch-skrupulös zu werden.
OTFRIED HÖFFE
John Rawls: "Gerechtigkeit als Fairneß". Ein Neuentwurf. Aus dem Englischen von Joachim Schulte. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2003. 316 S., geb., 24,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
"Ihm war vergönnt, was in der Welt des Geistes eine äußerste Seltenheit ist: zu Lebzeiten ein Klassiker zu werden, ja auf seinem Gebiet, der politischen Philosophie, eine Epoche zu prägen." (Frankfurter Rundschau)