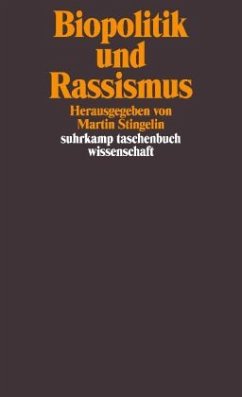Im Zusammenhang mit der Sozialhygiene des Gesellschaftskörpers, der gereinigt und freigehalten werden soll von degenerierten und degenerierenden Kräften, hat Foucault in der letzten Sitzung seiner Vorlesung Il faut défendre la société eine Bestimmung des Rassismus geprägt, die auch das aktuelle Begehren hinter der Präimplantations- und der pränatalen Diagnostik, geistig oder körperlich behinderte Kinder gar nicht erst zur Welt kommen zu lassen, in ein grelles Licht rückt: »Was ist der Rassismus letztendlich? Zunächst ein Mittel, um in diesen Bereich des Lebens, den die Macht in Beschlag genommen hat, eine Zäsur einzuführen: die Zäsur zwischen dem, was leben soll, und dem, was sterben muß.« Im Licht dieser Entscheidung verliert der Begriff »Biopolitik« die Unschuld der Neutralität, mit der er - ohne Wissen um seine Bedeutung im Werk Foucaults - zunehmend gebraucht wird. In exemplarischen historischen Fallstudien, deren Fluchtpunkt jeweils in der Gegenwart liegt, zeichnen die Autoren die Geschichte der Entscheidung darüber, »was leben soll und was sterben muß«, nach.

Martin Stingelin lädt zur Bio-Politik / Von Michael Jeismann
Lange hat es nicht gedauert nach dem großen Aufatmen von 1989, bis neue Zwänge und neues Zwangsdenken sich breit machten. Soviel war mit dem Ostblock zu Ende gegangen, daß man schon vom Ende der Ideologien oder gar dem Ende der Geschichte zu sprechen begann. Es kam bekanntlich anders.
Man schaute rückwärts: Die großen Gegenwartsdebatten der neunziger Jahre waren Vergangenheitsdebatten, und von heute aus betrachtet scheint es so, als habe die Erinnerung noch einmal die Schreckensgeschichte des zwanzigsten Jahrhunderts von der Judenvernichtung bis zur Vertreibung sich vor Augen halten müssen. Am Beispiel des umstrittenen Zentrums für Vertreibungen kann man verfolgen, wie diese politische Erinnerung sich nach und nach unter vielerlei Kämpfen justiert und ausbalanciert. Während dieser Prozeß noch im Gang ist, ist im Rücken dieser Vergangenheitsklärung eine Zukunft heraufgezogen wie eine grollende Gewitterwand. Und wer genau hinschaut, sieht darin Energien, die sich aus anderen Vergangenheiten herleiten, aus weniger beachteten Nebengeschichten, ja aus dem Abseitigen des achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts.
Man schaut vorwärts, merkt indessen, daß man wiederum rückwärts schauen muß, aber mit einem anderen Blickwinkel als bisher, um auch nur irgend etwas erkennen zu können. Das trifft für viele Lebens- und Wissensgebiete zu, von der Kommunikation über die Migration bis hin zu den politischen Grundbegriffen von Demokratie und internationalisierter Konfliktlösung. Wenn nicht mehr das Gegeneinander von Ost - West, von Sozialismus versus Kapitalismus das grundlegende Ordnungsschema ist, was tritt dann an seine Stelle? Unwahrscheinlich jedenfalls, daß der Platz leer bleibt: Wenn alle Geschichte die Geschichte von Unterscheidungen ist, dann muß die Frage lauten: Welche neuen Unterscheidungen werden nun neue Geschichten antreiben? Nach der Entschlüsselung des genetischen Codes und mit den Fortschritten der Reproduktionsmedizin ist absehbar, daß bei diesen Unterscheidungen biologische Kriterien eine bedeutende Rolle spielen werden. Dies kündigt sich in einem ganzen Schub von Begriffsgeläufigkeiten an, der nach und nach die Begriffe gesellschaftlichen und individuellen Selbstverständnisses umformt.
Wir stehen vor der Fortsetzung einer alten Geschichte mit neuen Mitteln. Man kann es auch so sagen wie Martin Stingelin, der Herausgeber des Bandes "Biopolitik und Rassismus": Was leben soll und was sterben muß, das ist eine Frage, der man nicht mehr ausweichen kann, weil die Technik sie möglich macht. Sie beantworten zu wollen unter den neuen Bedingungen der Biotechnik berührt eine solche Menge grundsätzlicher Fragen, daß zu befürchten steht, es könnte am Ende allein die schiere Macht zu entscheiden schon die Antwort sein. Einer der wenigen Geisteswissenschaftler, der sich früh für die untergründigen Diskurse, für die Vertäfelung des sozialen Lebens interessiert hat, war der 1984 gestorbene französische Philosoph und Historiker Michel Foucault.
Im Medium seiner Schriften und inspiriert durch ihn betrachten in diesem Band eine Reihe ausgewiesener Wissenschaftler verschiedener Fakultäten den Körper als Schauplatz der Historie. Das Spektrum reicht von "Wert und Unwert des Lebens" bei Nietzsche (Hubert Thüring) über "Die Geburt der modernen Reproduktionsmedizin" bis hin zu Erörterung der Begrifflichkeit bei Foucault und der "Gegenwart der Eugenik". Am Kern der Verbindung operiert Philipp Sarasin, indem er die Frage aufwirft, ob es denn zweierlei Rassismus geben könne: einen traditionellen, der zum Beispiel Schwarze oder Asiaten ablehnt, und einen anderen, positiven Rassismus, der scheinbar harmlos nur das Beste für die Menschen will, Fehlbildungen vermindern oder vermeiden, das genetische Material zu verbessern sucht. Sarasin argumentiert überzeugend, daß man sich gefaßt zu machen hat auf neue Definitionen des Fremden und Minderwertigen: die genetische Wahrscheinlichkeit, bestimmte Krankheiten zu bekommen, bestimmte Eigenschaften zu haben oder nicht zu haben, zu jung oder zu alt zu sterben und vieles mehr. All diese Unterscheidungen - noch nicht ihr politischer Gebrauch - sind ihrerseits nicht zu entfernende Bestandteile jeder Biotechnik.
Das heißt, ein solcher Rassismus müßte gar keine unmittelbare Verbindung mehr zu den Axiomen und Begrifflichkeiten des traditionellen Rassismus haben, sondern die schlichte Tatsache, daß Menschen verschieden sind, mit Hilfe einer biologischen Optimierungsskala politisch aufladen. Welche Dynamik aus solchen Unterscheidungen sich historisch-politisch im konkreten Fall entwickeln wird, ist nicht abzusehen. Im Hintergrund all dieser möglichen Unterscheidungen und ihrer Geschichten aber steht das Begriffspaar, das absolute Souveränität und absoluten Zwang ausübt. Es ist die Unterscheidung von Mensch und Unmensch.
Martin Stingelin (Hrsg.): "Biopolitik und Rassismus". Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2003. 274 S., br., 11,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Ein Sammelband erforscht Michel Foucaults „Biopolitik”
Nicht selten fällt in der Debatte über die Gentechnologie der Begriff „Biopolitik”. Doch nicht jeder, der diesen Terminus gebraucht, weiß, dass sich dahinter ein philosophisches Theorem verbirgt. Als „Biopolitik” bezeichnet der französische Philosoph Michel Foucault das Gegengewicht zur „Bio-Macht”, worunter er wiederum die vielfältigen „Zugriffe der Macht” auf das menschliche Fortpflanzungsverhalten versteht. Die „politische Anatomie”, die in Foucaults Frühwerk an den unterschiedlichsten Disziplinierungen des Körpers (Einsperren, Erziehen, Therapie) aufgezeigt wird, ist die eine Seite der Medaille, die „Bio-Politik”, die auf die Grundlagen des Lebens selbst sowie auf dessen Kontrolle und Reglementierung abzielt, die andere. Die souveräne Macht, die für sich in Anspruch nahm, über Leben und Tod zu entscheiden, wird nach Foucault „abgelöst von einer Macht, Leben zu machen oder in den Tod zu stoßen”. Wer denkt hier nicht gleich an die ethische Problematik der Präimplantationsdiagnostik?
Dass sich dieser Begriff auch dazu eignet, den modernen Rassismus zu verstehen, erfährt man aus einer Aufsatzsammlung, die dem Leser allerdings einiges an Theoriekenntnissen abverlangt. So hätte man sich mehr Beiträge gewünscht, die weniger die Brauchbarkeit des Foucaultschen Ansatzes für die philosophische Analyse gegenwärtiger Debatten um die Gentechnologie als für die historische Forschung aufgezeigt hätten.
Zu den Autoren, die Foucaults Interesse an der Geschichte ernst nehmen, gehört Jörg Marx, der sich mit den Anfängen der Reproduktionsmedizin befasst. So erfährt man beispielsweise, dass der Begriff „Biopolitik” keine Foucaultsche Wortschöpfung ist, sondern nationalsozialistischem Sprachgebrauch entspringt. In einem Buch aus dem Jahre 1934 findet man beispielsweise den Satz: „Biopolitisch sind uns die Völker an unserer Ostgrenze durch ihre viel höhere Geburtenzahl überlegen.” Wie Marx zeigt, ging es den Nationalsozialisten nicht zuletzt darum, die Fortpflanzung „einerseits von den sozialen Fesseln der Ehe, Familie und Sexualität ebenso zu befreien wie von allem, was nicht als völkisch und damit als nicht ‚fortpflanzungwürdig‘” galt. Foucault sei jedoch wegen der oft absurd erscheinenden nationalsozialistischen Geburtenpolitik zu einer Fehleinschätzung gekommen und habe so Entwicklungen, die erst später an Bedeutung gewannen, verkannt.
Fortpflanzung beim Fronturlaub
In diesem Zusammenhang bringt Marx das Beispiel, wie der Gynäkologe Hermann Knaus, an den heute noch die Knaus-Ogino-Methode zur Verhütung ungewollter Schwangerschaften erinnert, es schaffte, die Politik in seinem Sinne zu biologisieren, in dem er den Nationalsozialisten seine reproduktionsmedizinischen Erkenntnisse über die fruchtbaren Tage der Frau andiente. Er hatte damit bekanntlich Erfolg: 1943 befahl Himmler seinen SS-Männern, den Heimaturlaub nach dem Menstruationskalender ihrer Frauen zu planen, damit diesen Ehen „die so gewünschten und notwendigen Kinder entsprießen.” Hatten die Nationalsozialisten sein Buch „Die periodische Fruchtbarkeit und Unfruchtbarkeit des Weibes” (1934) zunächst verboten, so machten sie es später wieder zugänglich, als sie in der von Knaus erkannten Gesetzmäßigkeit eine Geburtenregel im Sinne einer positiven Bevölkerungspolitik sahen.
Dass Biopolitik nicht notwendigerweise mit Rassismus verknüpft sein muss, macht der Zürcher Historiker Philip Sarasin in seinem theoretisch und quellenmäßig gleichermaßen fundierten Beitrag deutlich. Er weist nach, dass die Selektion, die nach Foucault das Wesen der Biopolitik ausmacht, als solche nicht unbedingt „rassistisch” genannt werden kann, da ansonsten der Begriff des Rassismus von jedem konkreten Inhalt entkleidet würde. Im Zeitalter der fast unbegrenzten gentechnologischen Möglichkeiten hat der „traditionelle Rassismus”, wie ihn Sarasin nennt, an Bedeutung verloren. „Jedenfalls ist auffällig”, so der Autor weiter, dass in der Gegenwart „der Kranke, der Andere, der Fremde nicht mehr mit dem ‚Fremdrassigen‘ konnotiert wird.”
Zu den lesenswerten Beiträgen, die diese „schöne neue Welt” der heutigen „Biopolitik” kritisch mit dem Foucaultschen Begriffsinstrumentarium beleuchten, gehört Clemens Pornschleges Darstellung eines Rechtsstreits, der an Nietzsches Überzeugung erinnert, dass es das größte Glück sei, niemals geboren worden zu sein, das zweitgrößte jedoch, möglichst bald zu sterben. Gemeint ist der Fall von Nicolas Perruche, dessen Eltern sich aufgrund einer ärztlichen Fehldiagnose der Möglichkeit zu einer Abtreibung des schwerbehinderten Kindes beraubt sahen.
ROBERT JÜTTE
MARTIN STINGELIN (Hrsg.): Biopolitik und Rassismus. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2003. 274 S., 11 Euro.
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.diz-muenchen.de
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Robert Jütte erinnert bei der Besprechung des Bandes über Biopolitik und Rassismus daran, dass der Begriff Biopolitik, der heute in keiner Gentechnik-Debatte fehlt, einem "philosophisches Theorem" von Michel Foucault entspringt. Der Sammelband widmet sich diesen philosophischen Grundlagen und erprobt dessen Instrumentarium zur Untersuchung des "modernen Rassismus", erklärt der Rezensent. Allerdings verlangt das Buch von seinen Lesern "einiges an Theoriekenntnissen", warnt er. Außerdem hätte er sich "mehr Beiträge gewünscht, die weniger die Brauchbarkeit des Foucaultschen Ansatzes für die philosophische Analyse gegenwärtiger Debatten um die Gentechnologie als für die historische Forschung aufgezeigt hätten". Dennoch ist Jütte insgesamt angetan von den verschiedenen Aufsätzen. Besonders den Beitrag von Philip Sarasin, der argumentiert, dass Biopolitik nicht notwenig Rassismus bedeute, lobt Jütte als "theoretisch und quellenmäßig fundiert. Besonders lesenswert findet unser Rezensent Clemens Pornschlegels Darstellung eines Rechtsstreits, in dem Eltern, die ein schwerstbehindertes Kind bekamen, wegen der ärztlichen Fehldiagnose klagten, aufgrund derer sie eine Abtreibung nicht in Erwägung gezogen hatten. Hier fand Jütte heute relevante biopolitische Fragen mit Foucaults "Begriffsinstrumentarium" erörtert.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH