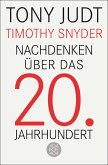Ob es um Deutschlands Rolle in Europa geht oder um das Bröckeln des neoliberalen Konsens - ein Wort hat derzeit Konjunktur: Hegemonie. Seit der griechischen Antike bezeichnet dieser Begriff eine Beziehung zwischen Staaten (etwa in der Theorie der Internationalen Beziehungen) oder Klassen (z. B. bei Antonio Gramsci), die von einer bestimmten Mischung aus Freiwilligkeit und Zwang geprägt ist. Indem Perry Anderson die Geschichte des Konzepts in verschiedenen Kulturen nachzeichnet, zeigt er zugleich, dass seine jeweiligen Konnotationen stets ein politisches Barometer für sich wandelnde Machtverhältnisse sind.
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Eine Ideengeschichte des Begriffs "Hegemonie" - Rezensent Thomas Steinfeld hat das mit Interesse, aber auch Vorbehalten gelesen. Er lässt sich von Perry Anderson erklären, wie stark sich die Bedeutung des Begriffs Hegemonie verändert hat: Ursprünglich stand er für eine freiwillig übertragene, zweckgebundene Führungsrolle. Im Laufe der Jahrhunderte wurde er immer negativer besetzt und gilt heute oft als schönfärberische Beschreibung gewaltsam durchgesetzter Abhängigkeitsverhältnisse . Steinfeld lernt auch, wie wacklig die Position eines Hegemons ist, eines liberalen ebenso wie eines offen drohenden a la Donald Trump. So weit so gut, nur wenn der Autor versucht, die Weltgeschichte seinen geschichtsphilosophischen Theorien anzupassen, geht Steinfeld nicht mehr mit.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Ambition, Selbstherrlichkeit und falsches Pathos: Perry Andersons kurze Geschichte des Hegemoniegedankens
Dass man auf Bajonetten nicht sitzen kann, ist eine alter Spruch. Jede Macht bedarf, will sie sich nicht in ständiger Überwachung - und Überwachung der Überwacher - aufreiben und durch ständiges gewaltbereites Drohen erschöpfen, einer gewissen Zustimmung durch die Befehlsempfänger. Würde außerdem bei jeder Entscheidung erst ausgiebig gerechnet, wem sie wie sehr nützt, käme gar keine politische Ordnung zustande.
Der irische Historiker Perry Anderson legt eine Geschichte des Begriffs "Hegemonie" vor, der diesen Tatbestand erfassen soll. Als hegemonial wird nämlich seit langem eine Staatsmacht bezeichnet, die andere nicht zuletzt mit dem Argument dominiert, eine gemeinsame Sache am kräftigsten durchsetzen zu können: Athen unter den griechischen Stadtstaaten, Preußen im Kleindeutschen Bund, die Bolschewiken bei der Abschaffung der russischen Monarchie, die Vereinigten Staaten lange in Bezug auf die westliche Demokratie und ihren Ressourcenbedarf. Ohne Armeen ging es nie, aber ohne die Produktion von wahrgenommenen Vorteilen für viele eben auch nicht. Das Zulassen von Importüberschüssen seitens des Hegemonen etwa, das Ausräumen wichtiger Gegner, Friedenserhaltung in ausgewählten Regionen, die Ergänzung von militärischen Bündnissen durch ökonomische Verträge oder die Verbreitung eines Lebensstils, gegen dessen Sicherung die Dominierten politische Freiheiten abgeben.
Anderson scheint so gut wie jedes Buch gelesen zu haben, das seit Mitte des neunzehnten Jahrhunderts den Hegemoniebegriff diskutiert. Die indische Gramsci-Rezeption wird ebenso referiert wie die Weltmachttheorie Giovanni Arrighis, der konfuse akademische Populismus von links, der Politik nur als Wille und Diskurs kennt, genauso wie die außenpolitischen Debatten in den Beratungsabteilungen amerikanischer Universitäten. Dem Autor steht dabei dieselbe Kenntnis politischer Lagen aller möglichen Länder zu allen möglichen Zeitpunkten zu Gebote, die auch seine großen Essays über die Türkei und Europa, die Ideologie Ghandis, die deutsch-französische Konstellation, den Palästina-Konflikt oder die italienische Malaise auszeichnet.
Um mit Anderson zu diskutieren, gibt es darum eigentlich nur zwei Wege. Entweder es kommt ein ganzes Departement an Länderexperten, oder man konzentriert sich auf die Prämissen des Hegemoniebegriffs. Prominent ist hier die Theorie des italienischen Kommunisten Antonio Gramsci. Er entwickelte sie als politischer Gefangener Mussolinis, um zu erklären, weshalb die prognostizierte Verelendung der Arbeiterschaft offenbar nicht ausreichte, um die Hegemonie des Kapitalismus zu brechen. Dass Gramsci dazu "das" Kapital als einen handlungsfähigen politischen Akteur behandeln musste, scheint für Anderson unproblematischer zu sein als die Verlegung des revolutionären Kampfplatzes in den Bereich der Ideologie. Es seien, so Gramsci, die Demokratie und die Öffentlichkeit, die Kirchen und die Schulen, durch die zur Macht des Kapitals auch noch das Einverständnis der Unterdrückten mit ihr hinzukomme. Heute müsste man von einer Verschwörung sprechen, die noch dazu die Eigenschaft hat, dass die an ihr Beteiligten (Bischöfe, Lehrer, Bankiers, Fernsehleute, Einzelhändler) gar nichts davon wissen, eine unbewussten Verschwörung also.
Eine ganz andere Ausdehnung des Begriff der Hegemonie liegt vor, wenn Deutschland als hegemoniale Macht "wider Willen" in Europa bezeichnet wird. Anderson, den man sich nicht als Humoristen vorstellen darf, hält kaum mit Spott zurück, wenn er aus Selbstbeschreibungen der Zahl- und Zuchtmeister Europas zitiert: "Im Dienste ihrer Selbstverherrlichung bedient sich die Macht stets des ihr gemäßen - selbstmitleidigen oder selbstbeweihräuchernden - Pathos." Er vermisst gewissermaßen die Trockenheit Machiavellis, wenn in Deutschland jemand - und das geschieht ständig - die Übernahme von "Verantwortung" für Europa anmahnt, ohne den Exportüberschuss mitzuerwähnen. Das ist für Anderson genau so scheinheilig wie die Tatsache, dass dem ersten Präsidenten der Vereinigten Staaten, der zwei volle Amtszeiten lang ununterbrochen Feldzüge im Ausland führte, vorab der Friedensnobelpreis verliehen worden war.
Hegemonie, so könnte man darum resümieren, liegt vor, wenn Macht erfolgreich und mit überregionaler Wirkung so überhöht wird, dass die Nebenfolgen ihres Gebrauchs vielen hinnehmbar erscheinen. Perry Anderson, der heute achtzig Jahre alt wird, analysiert seit mehr als fünfzig Jahren insistent, wie politische Eliten die Nebenfolgen ihres Handelns sich und anderen schönreden. Rat hat er keinen, außer den trostlosen, sich und sie wenigstens in Kenntnis davon zu setzen.
JÜRGEN KAUBE
Perry Anderson: "Hegemonie". Konjunkturen eines Begriffs.
Aus dem Englischen von Frank Jakubzik. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2018. 249 S., br., 18,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Der britische Historiker Perry Anderson schreibt eine Ideengeschichte der „Hegemonie“. Sie ist eine unsichere Angelegenheit
Als der britische Historiker Perry Anderson im Herbst 2016 sein neues Werk über „Hegemonie“ abschloss, ließ er es mit einem Zitat aus Diodors „Universalgeschichte“ enden. Wer führen wolle, erklärt darin der spätgriechische Historiograf, erwerbe sich seine Position durch Tapferkeit, Verstand, Wohlwollen und Freundlichkeit. Gesichert aber werde der Rang durch „Furcht und Schrecken“. Bezogen war diese Referenz auf den amerikanischen Präsidenten und Friedensnobelpreisträger Barack Obama, der während seiner zwei Amtszeiten unablässig Krieg führte – zuletzt sieben offene oder verdeckte Kriege zur selben Zeit.
Vermutlich erwartete Perry Anderson damals einen Wahlsieg Hillary Clintons. Unter ihrem Oberbefehl wäre es womöglich ebenso freundlich wie schrecklich weitergegangen. Aber es kam anders: zu einer Präsidentschaft nämlich, die weitaus mehr zu „Furcht und Schrecken“ tendiert als zu „Wohlwollen“ und „Freundlichkeit“.
Unter „Hegemonie“, schreibt Perry Anderson, sei eine Herrschaft zu verstehen, die auf Konsens wie auf Zwang setze, wobei es darauf ankomme, in welchem Verhältnis die beiden Kräfte zueinander stünden. Vom Wandel dieser Verhältnisse handelt sein Buch, das im engeren Sinn eine Begriffsgeschichte ist. Sie beginnt bei den alten Griechen und führt bis in eine jüngst vergangene Gegenwart, die, wie der von Perry Anderson zitierte amerikanische Politologe John J. Mearsheimer meint, „inhärent expansionistisch“ sei, auch wenn sie sich als „liberale Hegemonie“ darstelle.
Er zählt auf: die Expansion der Nato bis an die Grenzen Russlands, die Kriege in Kosovo und im Irak, die von Kriegen begleiteten und gescheiterten Versuche, im Nahen und Mittleren Osten demokratische Staaten aufzubauen. Am besten wäre es, so Mearsheimer, man konzentrierte sich, bewusst zurückhaltend, auf die Oberhoheit zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Das Verhältnis von Konsens und Zwang würde sich dann eher dem Einverständnis zuwenden. Da Perry Anderson die historische Argumentation seines Werkes mit diesem Gedanken abschließt, ist anzunehmen, dass er diese Perspektive teilt.
Die jüngsten Ereignisse in der Geschichte der amerikanischen „Hegemonie“ erscheinen dementgegen nicht nur als Radikalisierung des Expansionismus. Sie fordern vielmehr dazu auf, das Verhältnis von Konsens und Gewalt grundsätzlich anders zu betrachten. Donald Trump duldet keinen Zweifel daran, dass es ihm nicht ausreicht, über die militärische „Oberhoheit“ zu verfügen. Dass es mit China eine möglicherweise bald konkurrierende Weltmacht gibt, dass Russland sich der Degradierung zur Regionalmacht widersetzt, dass Nordkorea oder Iran nicht erkennen wollen, dass die einzige Form des „Konsenses“ die unbedingte Anpassung an den Willen der Vereinigten Staaten ist – Trumps Antwort auf diese Widerstände besteht darin, die USA zum Monopolisten der staatlichen Gewalt zu machen, auf jedem Terrain, in jeder Waffengattung, auf jedem Niveau, so dass jede potenzielle Konfrontation mit den USA für das betreffende Land zu einem nicht mehr zu kalkulierenden Risiko werden muss. Daher die angebliche Unberechenbarkeit dieses Präsidenten.
Seit fast 2500 Jahren, seit Herodot und dem Beginn der Geschichtsschreibung, gibt es den Begriff der „Hegemonie“. Zumeist war damit eine „Führungsrolle“ bezeichnet, die „die Mitglieder eines Bündnisses einem aus ihren Reihen aus freien Stücken einräumten, allerdings als zweckgebundene Vollmacht, nicht als generelle Vollmacht“. Unter den Stadtstaaten der griechischen Antike, im Fall von Athen und später von Sparta, mag es solche Verhältnisse gegeben haben, zu gewissen, vor allem kriegerischen Zeiten, doch nie als gesetzte Ordnung. Deswegen verliert die Kategorie mit dem Aufstieg des Römischen Reichs ihre Bedeutung. Zur „Hegemonie“ gibt es also einen Gegenbegriff, nämlich das „Imperium“, das „Ergebung“ verlangt. So gründlich aber scheint sich das Prinzip der Ergebung mit dem Römischen Reich durchzusetzen, dass es danach aus dem Register der politischen Kategorien verschwindet – um erst im 19. Jahrhundert wiederzukehren, zur Beschreibung des Verhältnisses zwischen Preußen und den anderen deutschen Staaten.
Seitdem aber gehört es zur Grundausstattung aller Staatswissenschaft, stets begleitet von der Frage, ob „Hegemonie“ nicht eigentlich nur ein Euphemismus ist, dem etwas schlicht Elementares, nämlich Gewalt, zugrunde liegt: War das britische Empire nicht ein vor allem brutales Unternehmen? Oder lagen dieser Herrschaft nicht auch Geld (womöglich auch eine Erscheinungsform von Gewalt), Wissenschaft und Technik zugrunde, ähnlich wie der globalen Dominanz der Vereinigten Staaten seit dem Zweiten Weltkrieg? Perry Anderson bemerkt, dass das Wort „Hegemonie“ im späten 19. Jahrhundert oft kritisch benutzt wird, als Ausdruck für eine abzulehnende, womöglich bald überwundene Herrschaft – Japans, Deutschlands, Italiens oder wessen auch immer. Zugleich erweitert sich der Wortgebrauch: Den russischen Revolutionären gilt er als Beschreibung eines wünschenswerten Verhältnisses zwischen Arbeitern und Bauern. Der italienische Kommunist Antonio Gramsci entfaltet um diese Kategorie herum eine Theorie bürgerlicher Herrschaft. Und zuletzt: wird nicht Deutschland immer wieder als wenn nicht tatsächlicher, so doch zukünftiger Hegemon Europas beschworen?
Ein Motiv, das sich durch das Buch zieht, ist die Erkenntnis, dass „Hegemonie“ eine höchst unsichere und instabile Angelegenheit ist – und mit ihr die Idee einer wohlmeinenden, „liberalen“ Herrschaft. Der Gedanke wird oft wiederholt, und die begrifflichen Schleifen verweisen darauf, dass Perry Andersons Ideengeschichte der „Hegemonie“ damit an das Ende ihrer Möglichkeiten gerät. Denn so interessant es sein mag, die Weltgeschichte aus der Perspektive eines einzigen Gedankens, also geschichtsphilosophisch, zu entwickeln, so wenig ist doch die Weltgeschichte dazu da, dafür zu sorgen, dass ein solcher Gedanke entsteht, sich entfaltet oder in Vergessenheit gerät. Das Verhältnis zwischen der Kategorie und der Wirklichkeit, die sie erklären soll, steht bei Anderson zuweilen auf dem Kopf, sodass die Wirklichkeit für die Geltung des Gedankens einzustehen hat.
Ist nun die Art von Weltherrschaft, die gegenwärtig von den Vereinigten Staaten verfolgt wird, das Ende der „Hegemonie“, im praktischen wie im theoretischen Sinn und damit auch die Widerlegung einer Geschichtsphilosophie, die sich dieser Kategorie verschreibt? Sie ist es nicht. Denn so sehr Donald Trump auch seine Vorgänger verachten mag, weil diese es angeblich zuließen, dass die Vereinigten Staaten von der Welt, und vornehmlich von den engsten Verbündeten, ausgeplündert wurden, so wurde doch in eben dieser Welt, in der die Vereinigten Staaten „nur“ Hegemon waren, die absolute militärische Übermacht geschaffen, mit der Donald Trump nun drohen kann – um nicht auch noch mit der Durchsetzung der amerikanischen Währung als dem Kreditgeld der Welt anzufangen, die es ohne militärische Übermacht nicht gegeben hätte. Wenn die Vereinigten Staaten nun die hegemonialen Verhältnisse zu ihrem Vorteil beendet sehen wollen, so stellen sie zugleich die Grundlagen ihres eigenen Reichtums und ihrer eigenen Macht infrage. Auch eine absolute imperiale, und das heißt: absolut kriegerische Herrschaft wird diesen Widerspruch nicht auflösen.
THOMAS STEINFELD
Perry Anderson: Hegemonie. Konjunkturen eines Begriffs. Aus dem Englischen von Frank Jakubzik. Suhrkamp Verlag, Berlin 2018. 250 Seiten, 18 Euro.
Vielleicht ist Hegemonie
ein Euphemismus , dem
schlicht Gewalt zugrunde liegt
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de
»So wie es ein elektrisierendes Vergnügen ist, Roger Federer beim Tennisspielen zu beobachten, so stimulierend für die eigenen Neuronen ist es, Perry Anderson beim Denken über die Schulter zu schauen: Hier kann man lernen, was begriffliche Klarheit im Verbund mit großer Quellenkenntnis, vorangetrieben durch ein polemisches Temperament und in Schwung gehalten durch einen klassisch trockenen Stil, vermag.« Ijoma Mangold DIE ZEIT 20181115