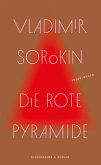TUSITALA: Auf dem Schiff, mit dem der niederländische Admiral Roggeveen 1721 aufbrach,
um das Südland zu finden, reist der schottische Arzt Dr. Clark mit Freunden und Verwandten
des Dichters nach Samoa, er will Robert Louis Stevenson besuchen. Ereignisse des 19. und des 18. Jahrhunderts spiegeln sich geheimnisvoll ineinander. TORNIAMO A ROMA: Winckelmann in Italien. Auf dem Vesuv "brieten wir Tauben an dem feurigen Flusse und nahmen unsere Abendmahlzeit nackt ein". CONCERT SPIRITUEL: "Stationen im Leben des Komponisten Antonio Rosetti - sein Requiem wurde bei der Trauerfeier für Mozart in Prag aufgeführt - in Wallerstein, Ludwigslust und leider nur beinahe in Berlin."
Die drei Erzählungen gehen ohne Sentimentalität und falsches Tremolo auf das Ende dreier Leben zu. Schädlichs Stil ist fast noch konziser geworden, kein Prunk, kein falscher Schmuck, kein Kokettieren mit dem Leser - klare, gute Sprache. Kein Zweifel, Schädlich ist einer der wichtigsten heute schreibendendeutschen Autoren.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
um das Südland zu finden, reist der schottische Arzt Dr. Clark mit Freunden und Verwandten
des Dichters nach Samoa, er will Robert Louis Stevenson besuchen. Ereignisse des 19. und des 18. Jahrhunderts spiegeln sich geheimnisvoll ineinander. TORNIAMO A ROMA: Winckelmann in Italien. Auf dem Vesuv "brieten wir Tauben an dem feurigen Flusse und nahmen unsere Abendmahlzeit nackt ein". CONCERT SPIRITUEL: "Stationen im Leben des Komponisten Antonio Rosetti - sein Requiem wurde bei der Trauerfeier für Mozart in Prag aufgeführt - in Wallerstein, Ludwigslust und leider nur beinahe in Berlin."
Die drei Erzählungen gehen ohne Sentimentalität und falsches Tremolo auf das Ende dreier Leben zu. Schädlichs Stil ist fast noch konziser geworden, kein Prunk, kein falscher Schmuck, kein Kokettieren mit dem Leser - klare, gute Sprache. Kein Zweifel, Schädlich ist einer der wichtigsten heute schreibendendeutschen Autoren.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Eine Wieder-Entdeckungsreise
Knapper Stil, große Kunst: Hans Joachim Schädlichs Erzählungsband „Vorbei”
Scheint das Glück nah, steht Wunscherfüllung bevor, und glaubt man wenigstens zu wissen, wie man leben sollte, dann ist es meist zu spät und man muss gehen. Kalendersprüche, Schlagerverse und kitschig-komische Geschichten berichten davon. In der Braut, die vor dem Altar verstirbt, wie im Bettler, der in dem Augenblick, da er im Lotto gewann, einem Herzinfarkt erliegt, erkennen wir Bilder der conditio humana. Aber sie taugen nicht viel, sind zu grob und zugleich zu saftig. Nur sentimentale Gemüter oder larmoyante Köpfe erfreuen sich an derlei Schicksalsschlägen in pompöser Kostümierung. Sie sind für schwache Stunden. Literatur aber, die in bester Kitschvermeidungsabsicht über solche Erfahrungen schweigt, wird läppisch, Journalismus, S-Bahn-Lektüre.
„Vorbei” heißt das neue Buch des großen Romanciers Hans Joachim Schädlich. Der Titel ruft den Tod als ewigen Refrain des Lebens ebenso herauf wie er an das Verfehlen des Ziels erinnert. Für diese drei Erzählungen gibt man leichten Herzens zwei Dutzend „spannender”, „abgründiger”, „unterhaltsamer”, „brillant geschriebener” Romane hin. Die erste handelt von einer Reise in die Südsee, die zweite vom bestialischsten Mord der deutschen Geistesgeschichte, die dritte vom Leben und Sterben des Komponisten Antonio Rosetti, dessen einstiger Ruhm zu Unrecht verblasste.
Prinzen kamen zu ihm nach Rom
Schädlichs Helden haben wirklich gelebt, manches von dem, was sie sagen, ist Briefen und Reiseberichten entnommen. So beliebt historische Miniaturen und historische Romane auch sind, so gefährlich bleibt es für einen Autor, aus Quellen zu zitieren, der Sprache vergangener Zeiten ihr Recht werden zu lassen. Er holt sich damit die Konkurrenz in den eigenen Text. Viele erliegen ihr oder suchen den Unterschied zu verkleistern, mal durch das Pathos der Einfühlung, mal durch einen pseudo-historischen Sprachgestus oder die Allzweckwaffe gegenwartsstolzer Ironie.
Daher nimmt der Leser gerade die zweite Erzählung, „Torniamo a Roma”, skeptisch, unwillig beinahe, zur Hand. Eigentlich kann das nur schief gehen. Über das Ende Johann Joachim Winckelmanns, der am 9. Juni 1768 in Triest niedergestochen wurde, sind wir durch Gerichtsakten gut informiert, deren Präzision wenig Raum für literarische Phantasie lässt. Die Briefe des ermordeten Kunsthistorikers gehören zum schönsten, was je auf deutsch geschrieben wurde, körnichte Sätze, die man sich von keinem neueren Skribenten verwässern lassen will.
Schädlich aber besteht die Konkurrenz, indem er seine Prosa vollständig in den Dienst der Mitteilung stellt. Winckelmann, als Schusterssohn in Stendal geboren, ist als „päpstlicher Antiquar, Gesellschafter des Kardinals Albani” eine europäische Berühmtheit. Friedrich II. ruft ihn nach Berlin, aber man kann sich über das Gehalt nicht einigen. Schädlich braucht nur wenige Worte, um ein Bild der Lage zu entwerfen: „Zu seinen eigenen Studien kam Winckelmann kaum. Der Ärger über die Berliner Absage verflog. Er war nicht zu seiner Majestät nach Berlin gegangen. Durchlauchtige deutsche Prinzen kamen zu ihm nach Rom.” So berichtet, wer seiner Geschichte vertraut, wer sie nicht anpreisen muss und daher auf jeden Halt im Meinungshaften, auf werbende Effekte verzichten kann. Verstand und Einbildungskraft des Lesers erhalten auf diese Weise Freiraum und Material genug. Er steht vor dem Geschriebenen wie vor einer zweiten Wirklichkeit, die Sinn verspricht, aber auf die Frage „Wozu?” doch schweigt.
Viele Freunde des Antiquars werden in der Erzählung erwähnt, „sogar Lamprecht”, der Schüler, den Winckelmann aussichtslos liebte, ohne auf seine Werbungen aus Rom auch nur eine Antwort zu erhalten. Winckelmann reiste 1768 dann doch nach Deutschland, auch um Freunde zu treffen, kehrte aber, „von Schwermut befallen”, bald wieder um, und begegnete auf der Rückreise seinem Mörder Arcangeli. Dieser gestand die Tat und versuchte einen Teil der Schuld auf den Ermordeten abzuwälzen. Winckelmann habe seine Habgier geweckt, als er ihm wertvolle Münzen, Geschenke der Kaiserin Maria Theresia, zeigte, „und Freundschaft mit mir geschlossen hat”.
Der als Genie der Freundschaft galt, ihrer fähig und bedürftig, fiel eben dieser Gabe zum Opfer. Man kann solche Vermutungen anstellen, um den Schrecken zu domestizieren. Schädlich erzählt lediglich, was gewesen. Er zieht den Leser sanft in das Geschehen hinein und meidet Wertungen. Er betreibt eine Kunst, die nicht überreden will.
„Concert spirituel” liest sich wie eine knappe Schilderung aus dem Leben des Musikers Antonio Rosetti, der 1773 beim Fürsten zu Öttingen-Wallerstein angestellt wird, nach einer Paris-Reise zu einem der beliebtesten Komponisten avancierte, der besseren Bezahlung wegen nach Ludwigslust ging, schließlich ein verlockendes Angebot des preußischen Königs, Friedrich Wilhelms II. erhielt und vor dem Gipfel seiner Karriere verstarb: „Am 27. Juni mochte Rosetti nicht mehr essen. Am 28. Juni mochte Rosetti nicht mehr trinken. Am 29. Juni sagte er leise: ,Gott hat mich geschlagen. Die Anfälle bringen mich um den Sinn meines Lebens.’ Am 30. Juni morgens, drehte er sich zur Wand. Um sieben Uhr abends wurde ihm ums Herz leicht.”
Das ist zweifelsohne ein Schicksal aus dem 18. Jahrhundert. Wie unbequem, beschwerlich das Reisen in der Kutsche war, wird ausführlich beschrieben. Dennoch schwindet der Unterschied zwischen den Zeiten.
Zu spät in der Südsee
In der ersten seiner drei Meistererzählungen lässt Schädlich eine seltsame Gruppe in die Südsee aufbrechen, um dort Robert Louis Stevenson zu besuchen, der von den Einheimischen „Tusitala”, Geschichtenerzähler, genannt wird. Zu den Reisenden gehören der Arzt Dr. Clark, aber auch Carl Friedrich Behrens, der nur in der Traumzeit Literatur 1894 noch verreisen konnte, hatte er doch 1722 bereits die Osterinsel betreten. Man fährt auf dem Segelschiff, das damals die große Entdeckungsfahrt unternommen hatte. Die Gäste des 19. Jahrhunderts hadern mit den Sitten des 18. und kommen obendrein zu spät. Stevenson ist verstorben, als sie endlich ihren Bestimmungsort erreichen. Nun haben sie dort nichts mehr zu tun. Vergeblich, vorbei.
Literatur hat viele Konkurrenten, die gleichfalls versprechen, die Wirklichkeit des Menschen zu zeigen: Geschichtsschreibung, andere Künste, Journalismus, die Fülle der Bilder. Schädlich nimmt diesen Wettkampf auf und besteht in ihm durch Askese, durch den kunstvollen Verzicht aufs Üppige, „Künstlerische”. Er inszeniert „Wieder-Entdeckungsreisen”, erobert längst Beschriebenes, Gedeutetes zurück. Es wird wieder aufregend: „,Ach, wissen Sie’”, beginnt der Band, „Erzählen Sie doch nichts. Was verstehen Sie davon. Ich ein Abenteurer?” Der Tod ist die Grenze allen Sinns, aber nicht des Erzählens. JENS BISKY
HANS JOACHIM SCHÄDLICH: Vorbei. Drei Erzählungen. Rowohlt Verlag, Reinbek 2007. 160 Seiten, 16,90 Euro.
Robert Louis Stevenson (rechts) 1889 in Samoa Foto: Getty Images
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Eine Dienstleistung der DIZ München GmbH
Knapper Stil, große Kunst: Hans Joachim Schädlichs Erzählungsband „Vorbei”
Scheint das Glück nah, steht Wunscherfüllung bevor, und glaubt man wenigstens zu wissen, wie man leben sollte, dann ist es meist zu spät und man muss gehen. Kalendersprüche, Schlagerverse und kitschig-komische Geschichten berichten davon. In der Braut, die vor dem Altar verstirbt, wie im Bettler, der in dem Augenblick, da er im Lotto gewann, einem Herzinfarkt erliegt, erkennen wir Bilder der conditio humana. Aber sie taugen nicht viel, sind zu grob und zugleich zu saftig. Nur sentimentale Gemüter oder larmoyante Köpfe erfreuen sich an derlei Schicksalsschlägen in pompöser Kostümierung. Sie sind für schwache Stunden. Literatur aber, die in bester Kitschvermeidungsabsicht über solche Erfahrungen schweigt, wird läppisch, Journalismus, S-Bahn-Lektüre.
„Vorbei” heißt das neue Buch des großen Romanciers Hans Joachim Schädlich. Der Titel ruft den Tod als ewigen Refrain des Lebens ebenso herauf wie er an das Verfehlen des Ziels erinnert. Für diese drei Erzählungen gibt man leichten Herzens zwei Dutzend „spannender”, „abgründiger”, „unterhaltsamer”, „brillant geschriebener” Romane hin. Die erste handelt von einer Reise in die Südsee, die zweite vom bestialischsten Mord der deutschen Geistesgeschichte, die dritte vom Leben und Sterben des Komponisten Antonio Rosetti, dessen einstiger Ruhm zu Unrecht verblasste.
Prinzen kamen zu ihm nach Rom
Schädlichs Helden haben wirklich gelebt, manches von dem, was sie sagen, ist Briefen und Reiseberichten entnommen. So beliebt historische Miniaturen und historische Romane auch sind, so gefährlich bleibt es für einen Autor, aus Quellen zu zitieren, der Sprache vergangener Zeiten ihr Recht werden zu lassen. Er holt sich damit die Konkurrenz in den eigenen Text. Viele erliegen ihr oder suchen den Unterschied zu verkleistern, mal durch das Pathos der Einfühlung, mal durch einen pseudo-historischen Sprachgestus oder die Allzweckwaffe gegenwartsstolzer Ironie.
Daher nimmt der Leser gerade die zweite Erzählung, „Torniamo a Roma”, skeptisch, unwillig beinahe, zur Hand. Eigentlich kann das nur schief gehen. Über das Ende Johann Joachim Winckelmanns, der am 9. Juni 1768 in Triest niedergestochen wurde, sind wir durch Gerichtsakten gut informiert, deren Präzision wenig Raum für literarische Phantasie lässt. Die Briefe des ermordeten Kunsthistorikers gehören zum schönsten, was je auf deutsch geschrieben wurde, körnichte Sätze, die man sich von keinem neueren Skribenten verwässern lassen will.
Schädlich aber besteht die Konkurrenz, indem er seine Prosa vollständig in den Dienst der Mitteilung stellt. Winckelmann, als Schusterssohn in Stendal geboren, ist als „päpstlicher Antiquar, Gesellschafter des Kardinals Albani” eine europäische Berühmtheit. Friedrich II. ruft ihn nach Berlin, aber man kann sich über das Gehalt nicht einigen. Schädlich braucht nur wenige Worte, um ein Bild der Lage zu entwerfen: „Zu seinen eigenen Studien kam Winckelmann kaum. Der Ärger über die Berliner Absage verflog. Er war nicht zu seiner Majestät nach Berlin gegangen. Durchlauchtige deutsche Prinzen kamen zu ihm nach Rom.” So berichtet, wer seiner Geschichte vertraut, wer sie nicht anpreisen muss und daher auf jeden Halt im Meinungshaften, auf werbende Effekte verzichten kann. Verstand und Einbildungskraft des Lesers erhalten auf diese Weise Freiraum und Material genug. Er steht vor dem Geschriebenen wie vor einer zweiten Wirklichkeit, die Sinn verspricht, aber auf die Frage „Wozu?” doch schweigt.
Viele Freunde des Antiquars werden in der Erzählung erwähnt, „sogar Lamprecht”, der Schüler, den Winckelmann aussichtslos liebte, ohne auf seine Werbungen aus Rom auch nur eine Antwort zu erhalten. Winckelmann reiste 1768 dann doch nach Deutschland, auch um Freunde zu treffen, kehrte aber, „von Schwermut befallen”, bald wieder um, und begegnete auf der Rückreise seinem Mörder Arcangeli. Dieser gestand die Tat und versuchte einen Teil der Schuld auf den Ermordeten abzuwälzen. Winckelmann habe seine Habgier geweckt, als er ihm wertvolle Münzen, Geschenke der Kaiserin Maria Theresia, zeigte, „und Freundschaft mit mir geschlossen hat”.
Der als Genie der Freundschaft galt, ihrer fähig und bedürftig, fiel eben dieser Gabe zum Opfer. Man kann solche Vermutungen anstellen, um den Schrecken zu domestizieren. Schädlich erzählt lediglich, was gewesen. Er zieht den Leser sanft in das Geschehen hinein und meidet Wertungen. Er betreibt eine Kunst, die nicht überreden will.
„Concert spirituel” liest sich wie eine knappe Schilderung aus dem Leben des Musikers Antonio Rosetti, der 1773 beim Fürsten zu Öttingen-Wallerstein angestellt wird, nach einer Paris-Reise zu einem der beliebtesten Komponisten avancierte, der besseren Bezahlung wegen nach Ludwigslust ging, schließlich ein verlockendes Angebot des preußischen Königs, Friedrich Wilhelms II. erhielt und vor dem Gipfel seiner Karriere verstarb: „Am 27. Juni mochte Rosetti nicht mehr essen. Am 28. Juni mochte Rosetti nicht mehr trinken. Am 29. Juni sagte er leise: ,Gott hat mich geschlagen. Die Anfälle bringen mich um den Sinn meines Lebens.’ Am 30. Juni morgens, drehte er sich zur Wand. Um sieben Uhr abends wurde ihm ums Herz leicht.”
Das ist zweifelsohne ein Schicksal aus dem 18. Jahrhundert. Wie unbequem, beschwerlich das Reisen in der Kutsche war, wird ausführlich beschrieben. Dennoch schwindet der Unterschied zwischen den Zeiten.
Zu spät in der Südsee
In der ersten seiner drei Meistererzählungen lässt Schädlich eine seltsame Gruppe in die Südsee aufbrechen, um dort Robert Louis Stevenson zu besuchen, der von den Einheimischen „Tusitala”, Geschichtenerzähler, genannt wird. Zu den Reisenden gehören der Arzt Dr. Clark, aber auch Carl Friedrich Behrens, der nur in der Traumzeit Literatur 1894 noch verreisen konnte, hatte er doch 1722 bereits die Osterinsel betreten. Man fährt auf dem Segelschiff, das damals die große Entdeckungsfahrt unternommen hatte. Die Gäste des 19. Jahrhunderts hadern mit den Sitten des 18. und kommen obendrein zu spät. Stevenson ist verstorben, als sie endlich ihren Bestimmungsort erreichen. Nun haben sie dort nichts mehr zu tun. Vergeblich, vorbei.
Literatur hat viele Konkurrenten, die gleichfalls versprechen, die Wirklichkeit des Menschen zu zeigen: Geschichtsschreibung, andere Künste, Journalismus, die Fülle der Bilder. Schädlich nimmt diesen Wettkampf auf und besteht in ihm durch Askese, durch den kunstvollen Verzicht aufs Üppige, „Künstlerische”. Er inszeniert „Wieder-Entdeckungsreisen”, erobert längst Beschriebenes, Gedeutetes zurück. Es wird wieder aufregend: „,Ach, wissen Sie’”, beginnt der Band, „Erzählen Sie doch nichts. Was verstehen Sie davon. Ich ein Abenteurer?” Der Tod ist die Grenze allen Sinns, aber nicht des Erzählens. JENS BISKY
HANS JOACHIM SCHÄDLICH: Vorbei. Drei Erzählungen. Rowohlt Verlag, Reinbek 2007. 160 Seiten, 16,90 Euro.
Robert Louis Stevenson (rechts) 1889 in Samoa Foto: Getty Images
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Eine Dienstleistung der DIZ München GmbH

Hans Joachim Schädlich hat es immer schon meisterhaft verstanden, aus Dokumenten, Berichten und den Klängen fremder Stimmen literarische Funken zu schlagen. In seinen neuen Erzählungen spürt er den Lebensgeschichten von Stevenson, Winckelmann und Rosetti nach. Eindringlich erzählt Schädlich vom lauernden Tod und seiner Sinnlosigkeit.
Von Peter von Matt
Ein kostbares Buch. Eine Prosasonate in drei Sätzen, erzählt in Hans Joachim Schädlichs ganz und gar eigentümlicher Weise. Diese ist weit musikalischer, als ihr auffälligstes Merkmal vermuten lassen könnte. Ganz unübersehbar nämlich ist bei Schädlich das Arbeiten mit Dokumenten und Tatsachen, mit Zeugnissen, Berichten, Protokollen. Der nüchterne Ton solcher Nachrichten stellt wohl den äußersten Gegensatz zu dem dar, was man sich unter musikalischer Prosa vorstellt. Aber wie die verschrobene Syntax amtlicher Erlasse aus den Kanzleien des späten achtzehnten Jahrhunderts unter Kleists Händen zu einem betäubenden Rhythmus fand, so gewinnt das trocken Registrierte und Referierte im Erzählen Schädlichs unverwechselbaren Klang und Zug. Zitat und Autorrede nähern sich einander dergestalt an, dass sie nicht mehr zu unterscheiden sind. Die vorwärtsdrängende Energie der Erzählrede erfasst auch die nüchternen Berichte; die kahlen Faktenreihen aber bändigen den Überschwang und verhindern das Dekorative, das jede Prosa so rasch altern lässt.
Die Sprache der Überwacher.
Der Stachel in Schädlichs Seele ist die politische Überwachung, dieser schleichende Verrat des Staates an seinen Bürgern, der Freunde an Freunden, in seinem Fall sogar des Bruders am Bruder. Von Anfang an galt sein Hass der Obrigkeit, welche die Menschen ausspäht, sie aushorcht mit Hilfe technischer und menschlicher Wanzen. Die Sprache der Überwacher trägt Schädlich immer mit sich herum. Er hat sie gleichsam verschluckt, in einem Akt der Abwehr und des Banns, so wie Canetti täglich ein wenig Cognac der Marke "Napoleon" trank, um den verhassten Menschenschlächter täglich ein wenig zu vernichten.
Die Sprache der Überwacher ist als Zitat, als giftiger Klang, ein Teil von Schädlichs Schreiben geworden. In seinem Meisterwerk "Tallhover" von 1986 führt er nicht nur den ewigen Spitzel vor, der sein Handwerk im Vormärz so unverdrossen treibt wie in wilhelminischen Zeiten, unter den Nazis so eifrig wie in der DDR, sondern er macht auch die immer gleiche Spitzelsprache hörbar und lässt die Infamie der Abhörprotokolle zu einem stilistischen Ereignis werden. Der gelernte Sprachwissenschaftler und Dialektforscher Schädlich hat ein extrem geschärftes Ohr für die Sprachformen, die Ausdruck nicht eines Einzelnen sind, sondern bestimmter Gruppen, Berufe oder Ämter. Er nimmt die O-Töne auf und integriert sie in sein Erzählen. Dieses bewegt sich damit in einer schwankenden Balance zwischen Dokument und Fiktion. Das freie Erzählen wird armiert mit der Unbestreitbarkeit authentischer Zeugnisse, behält dabei aber seine eigentümliche Dynamik. Und ganz genau wissen wir beim Lesen denn auch nie, was nun Zitat aus Dokumenten ist und was sich dem freien Erzählspiel verdankt. Hans Joachim Schädlich redet in Zungen, seiner eigenen und vielen anderen, und zuletzt ist trotzdem alles Einklang. Das können nur wenige. Keiner wie er.
Diese Kunst prägte schon Schädlichs Erstling, "Versuchte Nähe" von 1977, ein Buch, das sich den harmlosen Untertitel "Prosa" gab und das doch, mehr als ein Jahrzehnt vor der Wende, ein gnadenloses Gericht über die DDR war. Gegen Anfälle von DDR-Nostalgie ist dieser Band, der in jenem missratenen Staat entstand, dort aber nicht veröffentlicht werden durfte, das beste Heilmittel. Und überdies darf er auch nach dreißig Jahren noch als eine kleine Schule der modernen Prosa gelten.
Schädlichs neues Buch handelt für einmal nicht von der Belauerung unbescholtener Bürger durch den Staat, nicht vom lautlosen Würgegriff der politischen Polizei am Hals freiheitlicher Geister. Es handelt vom lauernden Tod und von der Sinnlosigkeit, mit der er zuschlägt. Da wird aber nicht von Schicksal geraunt. Das Ende eines Lebens rückt nicht in den Machtbereich eines geheimnisvollen Waltens. In jeder Geschichte stirbt ein berühmter Mann, stirbt vorzeitig, aber ohne dass sich daraus eine Lehre ziehen ließe. Es hat sich so ergeben. Eines Tages ist es eben vorbei. Und so heißt denn auch das Buch: "Vorbei".
Das Gericht der Anständigen.
Ein bisschen traurig ist das und auch ein bisschen komisch, aber kein Anlass zu Empörung. Dass die latente Wut fehlt, das aufständische Moment, die Bezichtigung der Fieslinge und Schurken, macht den Band anders als Schädlichs berühmte Bücher. Als wollte der Autor sagen: Seht her, ich bin kein geborener Ankläger. Ich kann mich mit dem Zufälligen unserer Existenz abfinden. Wenn die Welt einmal so eingerichtet ist, sei's drum. Und unterschwellig fährt er fort: Aber die Niedertracht, die nicht sein muss, die nicht in der Natur der Dinge liegt, sondern aus der Machtgier stammt und aus der Schlechtigkeit der Einzelnen, die ist etwas anderes; die muss nicht sein, und daher soll man sie beim Namen nennen und vor das Gericht der Anständigen ziehen.
Robert Louis Stevenson, immer schon kränklich, stirbt 1894 im Alter von vierundvierzig Jahren auf der Südseeinsel Samoa, wohin er sich um seiner Gesundheit willen geflüchtet hat. Anders als in seinem Welterfolg, der "Schatzinsel", findet er nach abenteuerlicher Seefahrt nicht das große Gold, sondern den frühen Tod. "Tusitala" nennen ihn die Eingeborenen; so klingt das Wort "Storyteller" in ihrer Sprache. Aber Stevenson ist nicht der Held der Geschichte, er löst sie bloß aus. Eine Gruppe von schottischen Freunden möchte ihn besuchen und organisiert dazu ein Schiff. Dieses ist ein uralter Kahn aus der kleinen Flotte des Seefahrers Jakob Roggesen, der 1722 die Osterinsel und den Samoa-Archipel entdeckt hat. Selbst der Kapitän des Schiffs ist noch derselbe. Was zwar nicht möglich ist, aber ein schönes Erzählspiel abgibt.
Jene erste Expedition verschmilzt in Schädlichs Bericht mit der zweiten, gewissermaßen in einer Aufhebung der linearen Zeit, die an die Unsterblichkeit des ewigen Spitzels Tallhover erinnert. Die Reisenden wissen allmählich nämlich selbst nicht mehr, wann sie eigentlich leben. Umso gnadenloser trifft sie dann, endlich am Ziel angekommen, das Faktum, dass Stevenson kurz zuvor gestorben ist. Da kann auch der Erzähler nichts mehr machen, obwohl er ein Tusitala ist wie der Tote und die Wirklichkeit nach Belieben aufzumischen versteht. Die phantastische Verwirrung der Epochen tritt in dieser Geschichte neben die nüchternen Berichte aus der ersten Expedition. Diese gelten zwar jetzt auch für die zweite Meerfahrt und sind so selber Teil eines surrealen Diskurses; sie bewahren dabei aber den stilistischen Gestus eines Protokolls und ermöglichen dem Autor die Polyphonie des Zitierens im Erzählen.
Das gilt, obschon auf andere Art, auch von der zweiten, der eindringlichsten Geschichte. Johann Joachim Winckelmann wird 1768 in Triest ermordet. Von einem Ganoven. Schädlich macht daraus keine Strichjungenaffäre und aus dem Ende des großen Antikenfreundes kein Pasolini-Schicksal. Er greift einzig auf die überlieferten Gerichtsakten zurück, lässt diese reden und redet selbst in ihnen und mit ihnen. Die Sachlichkeit des Dokuments gewinnt durch diesen Eingang in die Erzählerstimme eine Intensität, die beklemmender ist als das Finale eines Kriminalromans von Rang. Jedes Detail, registriert mit der kalten Überpräzision der Gerichtsmedizin, gewinnt die Gegenwärtigkeit eines brennenden Zeichens, wird vieldeutig wie bei einem Autor, der überlegt seine Symbole setzt.
Die dritte Geschichte, sie handelt von Leben und Tod des Komponisten Antonio Rosetti, reicht nicht an das Bedrängende der Winckelmann-Erzählung heran. Sie besitzt allerdings einen eigentümlichen Nachklang, der lange haftenbleibt. Dieser Rosetti, Hofkomponist an kleinen deutschen Höfen, stirbt, als sich vor ihm endlich die große Karriere im Berliner Schloss auftut. Das ist traurig, aber nicht mehr. Sein Tod gerät indessen in eine merkwürdige Verbindung mit Mozart und dessen frühem Sterben. Dem großen Requiem, das nach Mozarts Tod in Prag zelebriert wurde, lag Musik von Rosetti zugrunde. Ein halbes Jahr später war auch er begraben. Einen Schluss ziehen kann man aus dieser Koinzidenz nicht. Solches geschieht halt. Und so würde sich Rosettis kurzer Lebensgang auch für keine literarische Erzählung eignen, wenn der Autor nicht wiederum den Stimmen der zeitgenössischen Berichte Raum und Recht einräumte. Diese sagen nun, dass es so war, sagen, wie jung beide starben und wie der eine noch die Musik für die Totenmesse des andern liefern konnte, bevor er selbst hingemäht wurde. Das bringt man lange nicht aus dem Kopf, obwohl man nicht weiß, warum.
- Hans Joachim Schädlich: "Vorbei". Drei Erzählungen. Rowohlt Verlag, Reinbek 2007. 160 S., geb., 16,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Knapper Stil, große Kunst: Hans Joachim Schädlichs Erzählungsband „Vorbei”
Scheint das Glück nah, steht Wunscherfüllung bevor, und glaubt man wenigstens zu wissen, wie man leben sollte, dann ist es meist zu spät und man muss gehen. Kalendersprüche, Schlagerverse und kitschig-komische Geschichten berichten davon. In der Braut, die vor dem Altar verstirbt, wie im Bettler, der in dem Augenblick, da er im Lotto gewann, einem Herzinfarkt erliegt, erkennen wir Bilder der conditio humana. Aber sie taugen nicht viel, sind zu grob und zugleich zu saftig. Nur sentimentale Gemüter oder larmoyante Köpfe erfreuen sich an derlei Schicksalsschlägen in pompöser Kostümierung. Sie sind für schwache Stunden. Literatur aber, die in bester Kitschvermeidungsabsicht über solche Erfahrungen schweigt, wird läppisch, Journalismus, S-Bahn-Lektüre.
„Vorbei” heißt das neue Buch des großen Romanciers Hans Joachim Schädlich. Der Titel ruft den Tod als ewigen Refrain des Lebens ebenso herauf wie er an das Verfehlen des Ziels erinnert. Für diese drei Erzählungen gibt man leichten Herzens zwei Dutzend „spannender”, „abgründiger”, „unterhaltsamer”, „brillant geschriebener” Romane hin. Die erste handelt von einer Reise in die Südsee, die zweite vom bestialischsten Mord der deutschen Geistesgeschichte, die dritte vom Leben und Sterben des Komponisten Antonio Rosetti, dessen einstiger Ruhm zu Unrecht verblasste.
Prinzen kamen zu ihm nach Rom
Schädlichs Helden haben wirklich gelebt, manches von dem, was sie sagen, ist Briefen und Reiseberichten entnommen. So beliebt historische Miniaturen und historische Romane auch sind, so gefährlich bleibt es für einen Autor, aus Quellen zu zitieren, der Sprache vergangener Zeiten ihr Recht werden zu lassen. Er holt sich damit die Konkurrenz in den eigenen Text. Viele erliegen ihr oder suchen den Unterschied zu verkleistern, mal durch das Pathos der Einfühlung, mal durch einen pseudo-historischen Sprachgestus oder die Allzweckwaffe gegenwartsstolzer Ironie.
Daher nimmt der Leser gerade die zweite Erzählung, „Torniamo a Roma”, skeptisch, unwillig beinahe, zur Hand. Eigentlich kann das nur schief gehen. Über das Ende Johann Joachim Winckelmanns, der am 9. Juni 1768 in Triest niedergestochen wurde, sind wir durch Gerichtsakten gut informiert, deren Präzision wenig Raum für literarische Phantasie lässt. Die Briefe des ermordeten Kunsthistorikers gehören zum schönsten, was je auf deutsch geschrieben wurde, körnichte Sätze, die man sich von keinem neueren Skribenten verwässern lassen will.
Schädlich aber besteht die Konkurrenz, indem er seine Prosa vollständig in den Dienst der Mitteilung stellt. Winckelmann, als Schusterssohn in Stendal geboren, ist als „päpstlicher Antiquar, Gesellschafter des Kardinals Albani” eine europäische Berühmtheit. Friedrich II. ruft ihn nach Berlin, aber man kann sich über das Gehalt nicht einigen. Schädlich braucht nur wenige Worte, um ein Bild der Lage zu entwerfen: „Zu seinen eigenen Studien kam Winckelmann kaum. Der Ärger über die Berliner Absage verflog. Er war nicht zu seiner Majestät nach Berlin gegangen. Durchlauchtige deutsche Prinzen kamen zu ihm nach Rom.” So berichtet, wer seiner Geschichte vertraut, wer sie nicht anpreisen muss und daher auf jeden Halt im Meinungshaften, auf werbende Effekte verzichten kann. Verstand und Einbildungskraft des Lesers erhalten auf diese Weise Freiraum und Material genug. Er steht vor dem Geschriebenen wie vor einer zweiten Wirklichkeit, die Sinn verspricht, aber auf die Frage „Wozu?” doch schweigt.
Viele Freunde des Antiquars werden in der Erzählung erwähnt, „sogar Lamprecht”, der Schüler, den Winckelmann aussichtslos liebte, ohne auf seine Werbungen aus Rom auch nur eine Antwort zu erhalten. Winckelmann reiste 1768 dann doch nach Deutschland, auch um Freunde zu treffen, kehrte aber, „von Schwermut befallen”, bald wieder um, und begegnete auf der Rückreise seinem Mörder Arcangeli. Dieser gestand die Tat und versuchte einen Teil der Schuld auf den Ermordeten abzuwälzen. Winckelmann habe seine Habgier geweckt, als er ihm wertvolle Münzen, Geschenke der Kaiserin Maria Theresia, zeigte, „und Freundschaft mit mir geschlossen hat”.
Der als Genie der Freundschaft galt, ihrer fähig und bedürftig, fiel eben dieser Gabe zum Opfer. Man kann solche Vermutungen anstellen, um den Schrecken zu domestizieren. Schädlich erzählt lediglich, was gewesen. Er zieht den Leser sanft in das Geschehen hinein und meidet Wertungen. Er betreibt eine Kunst, die nicht überreden will.
„Concert spirituel” liest sich wie eine knappe Schilderung aus dem Leben des Musikers Antonio Rosetti, der 1773 beim Fürsten zu Öttingen-Wallerstein angestellt wird, nach einer Paris-Reise zu einem der beliebtesten Komponisten avancierte, der besseren Bezahlung wegen nach Ludwigslust ging, schließlich ein verlockendes Angebot des preußischen Königs, Friedrich Wilhelms II. erhielt und vor dem Gipfel seiner Karriere verstarb: „Am 27. Juni mochte Rosetti nicht mehr essen. Am 28. Juni mochte Rosetti nicht mehr trinken. Am 29. Juni sagte er leise: ,Gott hat mich geschlagen. Die Anfälle bringen mich um den Sinn meines Lebens.’ Am 30. Juni morgens, drehte er sich zur Wand. Um sieben Uhr abends wurde ihm ums Herz leicht.”
Das ist zweifelsohne ein Schicksal aus dem 18. Jahrhundert. Wie unbequem, beschwerlich das Reisen in der Kutsche war, wird ausführlich beschrieben. Dennoch schwindet der Unterschied zwischen den Zeiten.
Zu spät in der Südsee
In der ersten seiner drei Meistererzählungen lässt Schädlich eine seltsame Gruppe in die Südsee aufbrechen, um dort Robert Louis Stevenson zu besuchen, der von den Einheimischen „Tusitala”, Geschichtenerzähler, genannt wird. Zu den Reisenden gehören der Arzt Dr. Clark, aber auch Carl Friedrich Behrens, der nur in der Traumzeit Literatur 1894 noch verreisen konnte, hatte er doch 1722 bereits die Osterinsel betreten. Man fährt auf dem Segelschiff, das damals die große Entdeckungsfahrt unternommen hatte. Die Gäste des 19. Jahrhunderts hadern mit den Sitten des 18. und kommen obendrein zu spät. Stevenson ist verstorben, als sie endlich ihren Bestimmungsort erreichen. Nun haben sie dort nichts mehr zu tun. Vergeblich, vorbei.
Literatur hat viele Konkurrenten, die gleichfalls versprechen, die Wirklichkeit des Menschen zu zeigen: Geschichtsschreibung, andere Künste, Journalismus, die Fülle der Bilder. Schädlich nimmt diesen Wettkampf auf und besteht in ihm durch Askese, durch den kunstvollen Verzicht aufs Üppige, „Künstlerische”. Er inszeniert „Wieder-Entdeckungsreisen”, erobert längst Beschriebenes, Gedeutetes zurück. Es wird wieder aufregend: „,Ach, wissen Sie’”, beginnt der Band, „Erzählen Sie doch nichts. Was verstehen Sie davon. Ich ein Abenteurer?” Der Tod ist die Grenze allen Sinns, aber nicht des Erzählens. JENS BISKY
HANS JOACHIM SCHÄDLICH: Vorbei. Drei Erzählungen. Rowohlt Verlag, Reinbek 2007. 160 Seiten, 16,90 Euro.
Robert Louis Stevenson (rechts) 1889 in Samoa Foto: Getty Images
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Eine Dienstleistung der DIZ München GmbH
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Jens Bisky preist den jüngsten Band mit Erzählungen von Hans Joachim Schädlich als meisterhaft und sieht den Autor vor allem durch kluge Zurückhaltung bestehen. Der Rezensent findet es immer riskant, wenn sich ein Autor historischer Realitäten annimmt, wie es Schädlich in jeder Erzählung dieses Bandes tut. Gerade angesichts der zweiten Geschichte, die vom Mord am Kunsthistoriker Johann Joachim Winckelmann handelt, ist die Gefahr, gegenüber den historischen Figuren zu verblassen, besonders groß, wird aber vom Autor, indem er sich auf den sachlichen Bericht beschränkt, vorzüglich bewältigt, preist Bisky. Nur wenige Sätze brauche der Autor, um Szenarien zu entwerfen, und überlasse den Lesern die Wertung. So liegt für den begeisterten Rezensenten die große Kunst Schädlichs im asketischen Verzicht auf Ausschmückung und Deutung und dafür lässt er nach eigenem Bekunden jeden Roman, der sich der Üppigkeit und der Spannung verschrieben hat, liegen.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH