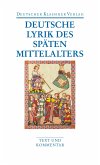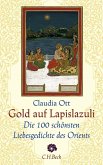Diese besondere Anthologie ist ein hehres Liebesbekenntnis der Dichter der Gegenwart zu ihren großen Vorfahren im Mittelalter. Lyriker wie Monika Rinck oder Joachim Sartorius, Durs Grünbein oder Nora Gomringer haben Minnelieder aus dem Mittelhochdeutschen übertragen. Die Herausgeber Jan Wagner und Tristan Marquardt laden damit ein, alle großen Dichter des Hochmittelalters kennenzulernen. In diesen Gedichten betreten wir nicht nur ein über achthundert Jahre altes Neuland, eine Welt, deren Begehren uns nah und fremd zugleich erscheint. Die fantastisch unterschiedlichen Übersetzungsweisen durch über sechzig heutige Dichter zeigen darüber hinaus, was für Ideen die Gegenwartslyrik heute prägen.

Jan Wagner und Tristan Marquardt baten 68 Dichter, mittelalterliche Lyrik zu übersetzen: Ein Wettkampf mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen
Achtundsechzig mehr oder weniger bekannte deutsche Dichterinnen und Dichter sind für diesen Band der Einladung der Herausgeber, des Mediävisten Tristan Marquardt und des Lyrikers Jan Wagner, gefolgt, mittelhochdeutsche Gedichte ins Deutsche zu übersetzen. Im Vorwort versprechen diese beiden Veranstalter eine Auseinandersetzung mit dem „literarischen Erbe, das wir alle, die wir heute Gedichte schreiben, teilen“. Das Erbe erstreckt sich vom Falkenlied des Kürnbergers (um 1150) bis zum Tausendsassa Oswald von Wolkenstein, der 1445 starb. Es bringt also 300 Jahre Lyrik auf den Nenner der „Unmöglichen Liebe“.
Die „unmögliche Liebe“ ist eine griffige Formel für das sogenannte Minneparadox, den Widerspruch, der im Zentrum des Minnesangs steht: „Seiner Logik zufolge liebt, singt und wirbt ein männliches Ich um eine Frau, weil sie die Beste und die Schönste ist – doch kann sie genau wegen dieser Eigenschaften seine Liebe nicht erwidern.“ Welch glücklicher Umstand, dass dieses männliche Ich immer ein Poet ist, eben ein Minnesänger! Das Minneparadox ist ein durch und durch lyrisches Phänomen.
Tristan Marquardt stellt in seiner kurzen Einführung in den Minnesang diese befremdliche Logik ins Zentrum und entwirft den Hintergrund des großen Bildes, welches unsere Dichterinnen und Dichter mit ihren Geschöpfen beleben werden. Was dabei zu kurz kommt, ist die Welt, in der diese Kunstübung einen Sinn hatte. Das esoterische Phantasma des Minnesangs bearbeitet ja unablässig den bitteren Ernst des Feudalismus. Die Wörter „dienest“, „lôn“, „triuwe“, „genâde“, „frouwe“ haben ebenso wie „minne“ keine neuhochdeutsche Entsprechung. Sie bezeichnen etwas, das es nicht mehr gibt. Das Minneparadox ist ein sozialpsychologisches Meisterstück: die Libido zum moralischen Garanten gesellschaftlicher Machtverteilung zu nutzen. Kann man sich einen besseren Vasallen wünschen, als einen, der treu dient – gegen nichts als eine bloße Hoffnung auf „Lohn“? Der Ernst dieser Konstellation erstreckt sich auch in die Religion: Gottesminne, Christusliebe, Marienverehrung borgen nicht erst jetzt, aber jetzt erst recht, ihre psychische Unbedingtheit von der Erotik: Liebe in Treue für einen immer aus Gnade zu gewährenden Lohn – im Jenseits.
Dass mit dieser Sublimierung ein Opfer und ein Verlust einhergehen, spürt die Gesellschaft. Und wir, besonders unsere Dichterinnen und Dichter, aus sicherer, jahrhundertelanger Entfernung, bemerken und schätzen darum unverhohlen die Sänger, die das Minneparadox untergraben. Das Desiderat, eine dauerhafte menschliche Bindung, ist freilich immer noch akut. „Die minne erzeige ich mit der minne / das ich ûf minne minne minne“, bekannte der Minnesänger, grimassierend und reimstotternd, und sein Übersetzer macht’s ebenso gut: „zum sex sag ich: sex, ich sex dich. /... / ich zersex, weil sex ein must ist, / mit sex ihre sexyness.“
Die Herausgeber betonen, „dass ein übersetztes Gedicht auch in der Zielsprache vor allem dies sein muss, eben: ein Gedicht“. Darauf nimmt das Layout Rücksicht: Die neuen Gedichte sind, mit großer Initiale und abgesetzten Strophen, auch als Gedichte erkennbar, die alten müssen auf die visualisierte Form verzichten; sie sind wie Prosa in kleinerer Type angefügt. Diese ästhetische Botschaft heißt: man kann sie lesen wie das Kleingedruckte im Mietvertrag. Wie mühsam, eine bestimmte Stelle des neuen Gedichts im alten zu suchen! Die Texte selber folgen strikt der Fassung einer einzigen handschriftlichen Quelle, meistens der Heidelberger (Manessischen). Das ist philologisch korrekt, mehr nicht. Nach diesem Prinzip steht denn auch ausgerechnet Heinrichs von Morungen berühmtes Narzisslied unter „Reinmar der Alte“, weil die Würzburger Handschrift es so will. Aber die Zuschreibung an Morungen und die kritische Fassung dieses Liedes (etwas in Ingrid Kastens Lyrik des Mittelalters) ist kein Auswuchs „spekulativer Unterfangen“, sondern schlicht das Ergebnis von vielen klugen und nachvollziehbaren Überlegungen. An diesem Punkt greift das Werk zu kurz.
Wolf Biermann hatte in den Neunzigern „Zehn Gebote zum gediegenen Dolmetzschen“ verkündet, von denen das erste lautet: Du sollst die Sprache lernen, die du schon kannst: die eigene. So richtig das ist, so bedeutet das Gebot nicht: Du musst zeigen, dass du die Sprache nicht kannst, aus der du gerade übersetzt! Tristan Marquardt zitiert in seiner Einführung zwei Verse von Reinmar, um das Minneparadox zu erklären: „Ich hab da so ein Ding, das vor mir liegt, es streitet innen mit Gedanken, mir im Herzen.“ Dem dichterischen Übersetzer wollen wir alle Freiheit gönnen, welche die endlich auf den Punkt gebrachte moderne Übersetzungstheorie ihm einräumt: Die Qualität einer Übersetzung misst sich an ihrem Zweck. Wenn es also dem Nachdichter darum ging, einen coolen Reinmar zu vermitteln, dann ist seine Übersetzung ohne Zweifel gelungen. Aber dessen „dinc“ ist nicht „so ein Ding“, sondern eine causa, eine Rechtssache, eine Streitfrage. Wenn wir ihn also zum Zeugen für ein Kulturphänomen aufrufen, sollten wir ihm nicht das Wort im Munde umdrehen. In der akademischen Übersetzung von Margherita Kuhn heißt es darum auch korrekt und verlässlich: „Ich habe mir eine Frage vorgelegt“.
Wolf Biermann hatte, nicht nur um Entgleisungen vorzubeugen, sein drittes Gebot so formuliert: Du darfst alle sprachbegabten und hochgebildeten Freunde als Zuarbeiter ausbeuten. Eine Gruppe von Mediävistinnen und Mediävisten wollte sich gerne ausbeuten lassen, und die Herausgeber danken ihnen dafür, dass mehrere Übersetzerinnen und Übersetzer ihren Rat in Anspruch genommen haben. Aber offensichtlich haben andere diese Hilfe verschmäht. Der im Mittelhochdeutschen weniger bewanderte Übersetzer trifft ja fast nur „falsche Freunde“! Immer mal wieder gelingt es ihnen, sich dichterisch einzuschleichen. Eine Dichterin öffnet uns sogar ihre Werkstatt und lässt uns freimütig zuschauen, wie sie mit den Anfangsgründen des Mittelhochdeutschen ringt und immer wieder stolpert. Das hat etwas Rührendes, ist aber auch peinlich.
Es fällt auf, dass sich viele Dichterinnen und Dichter, vielleicht sogar die meisten, nicht darauf eingelassen haben, eine Übersetzung im üblichen Sinne des Wortes zu versuchen. Das Ergebnis gibt ihnen recht, wenn man ihre Gedichte an der Spannung misst, die sie beim Leser auslösen. Den Minnesang im Modus der Parodie wahrzunehmen, trifft einen Nerv seines Wesens und eröffnet eine Chance, Biermanns sechstes Gebot zu erfüllen: „Keine Übersetzung kann so gut werden wie das Original. Also versuche wenigstens, sie besser zu machen.“ Die Übersetzung als Kunst des ironischen Überbietens: ein dankbares Geschäft. Aber es zwingt die Dichter, mit verstellter Stimme zu sprechen.
Der frühe Dietmar von Aist raunt nichts vom Minneparadox, wenn er in einem sogenannten Wechsel die Frau für heutige Leser singen lässt: „... Manneye. 1000 Jahre her / will es mir scheinen, dass ich im Arm des Liebsten lag./ ... /Seitdem war meine ganze Freude (das ist ER!) / super short und mein sorrow waaaaaaay too long.“ Diese Frustrierte kann's noch besser: „du da: wir high. du weg: du high für zwei, ich - down ... dead... alle.“ Das Englische bietet sich oft an, es durchtränkt hier ohnehin Slang oder Mundmische: „Halligalli halligalli sei die happiness / halligalli der funvolle frühling ... well well halligalli forever!“ singt Gottfried von Neifen. Das ausgefallenste Stück ist aber ein stupendes Pop-Patchwork über vier Strophen Heinrichs von Morungen mit nichts als zitierten Versatzstücken: „I was born to sing I live to tell“. Ja, das übersetzt wörtlich „wan ich dur sanc bin ze der welte geborn“ („denn zum Singen bin ich in diese Welt geboren“. Wer überträgt hier wen? Oder übertragen die Modernen allesamt nur Fetzen desselben geheimen Liedes, das jedem Dichter von einer Frau Minne ins Ohr gesummt wird, wenn er anfängt zu dichten?
Bei der Lektüre all dieser so verschiedenen Annäherungs- und Absetzungsversuche stellen sich ungezählte poetologische Fragen von selbst. Eine sei noch erwähnt: Was tun mit der fast obsessiven Reimkunst des Minnesangs, besonders in seiner späteren Zeit? Einerseits erwarten wir von der Poesie keine Reime mehr, andererseits sind wir überempfindlich, wenn Reime auftauchen. In sehr vielen Übertragungen haben sich die Autoren um die Wiedergabe der Reime bemüht, meistens mit einer Lockerung des Reimschemas und mit raffinierten Abweichungen. Die formale Forderung ist zwar nur eine Spielregel, sie funktioniert trotzdem wie ein Fetisch: ein unreiner oder fehlender Reim fällt immer noch oder wieder auf wie eine Zahnlücke.
Wolf Biermann hatte auch noch gefordert: Du sollst nur Meisterwerke übersetzen, die du liebst und bewunderst. Für Walthers „Vokalspiel“ hatte Peter Rühmkorf weder Liebe noch Bewunderung und meinte, dass es wohl unübersetzt bleiben sollte: „artistisch verpfriemeltes Kunstgewerbe“, meinte er. Das sehen viele Dichter seit dem Dada anders. Besonders der späte Minnesang hätte da auf dem Rücken der Intention auch noch etwas zu sagen.
Rühmkorf bemerkte allerdings auch – und das ist irritierender –, dass gerade die geistliche Dichtung und schon Walthers Leich „Got, dîner trinitâte“ dieselben Vorwürfe verdient. Obwohl „Unmögliche Liebe“ auch Texte enthält, die nicht im engeren Sinne zum Minnesang gehören, fehlt hier die geistliche Lyrik ganz, die doch dem Minneparadox viel enger verbunden geblieben ist als die parodistische Tradition. Liebt und bewundert sie keiner mehr?
Ein Fazit? Diese Anthologie hat etwas von einem sportlichen Wettkampf: die Athleten der alten und der neuen Zeit machen sich’s gegenseitig nicht leicht. Beide werden dabei ein wenig lädiert: unsere Dichterinnen und Dichter werden manchmal zum Sackhüpfen gezwungen, wo sie sich doch für Sprinter halten, und die Minnesänger erscheinen manchmal gebeutelt und betastet, wo man glaubte, sie seien unantastbar. Gewinner bei diesem Turnier sind wir Leserinnen und Leser, und wer immer sich auch nur von ferne für Lyrik interessiert, sollte sich das Spektakel nicht entgehen lassen.
HANS-HERBERT RÄKEL
Tristan Marquardt, Jan Wagner (Hrsg.):
Unmögliche Liebe. Die Kunst des Minnesangs in neuen Übertragungen. Zweisprachige Ausgabe. Carl Hanser Verlag München 2017. 304 S., 32 Euro.
Gibt es einen besseren Vasallen
als den, der nur um
einer Hoffnung willen dient?
Von wegen reimlose Zeiten:
Ein unreiner Reim
fällt auf wie eine Zahnlücke
Das Geheimnis der Minne: Die Frau anbeten, wissend, dass man sie nicht bekommt.
Foto: picture alliance/ullstein bild
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de

Wenn das mal nicht die Liebe ist: Siebzig deutsche Lyriker der Gegenwart wenden sich den Minneliedern des Mittelalters zu - und dichten sie nach.
Von Tilman Spreckelsen
Kann mir einer sagen, was Liebe ist? / Ich weiß davon, doch wüsste gerne mehr. / Wer besser als ich sich hier auskennt, / erkläre mir, warum nur sie so brennt. / Liebe ist Liebe, wenn sie Balsam ist. / Ich nenn sie nicht Liebe, brennt sie sehr, / und weiß nicht, wie dann sie heißen soll." Die Antwort bleibt der Dichter Joachim Sartorius bis zum Ende - es folgen noch vier weitere Strophen - schuldig, auch wenn seine Versuche, die Liebe positiv zu bestimmen, recht hartnäckig sind. Er spricht von Gleichheit des Gefühls auf beiden Seiten, sonst sei es eben keine Liebe, und während man sich noch über diesen Idealismus die Augen reibt, fährt er, nun an die Geliebte gewandt, fort: Seinem öffentlichen Lob ihrer Vorzüge verdanke sie doch überhaupt nur, dass auch andere sie bewunderten, und ob ihre offensichtliche Kälte daher nicht eigentlich schnöder Undank sei?
Sartorius ist einer von knapp siebzig Autoren, die mit je einem bis fünf Gedichten in "Unmögliche Liebe" versammelt sind, darunter Durs Grünbein, Marcel Beyer, Monika Rinck oder Nico Bleutge, und so mag man den Sammelband mit einigem Recht als eine Art Schaufenster der deutschen Gegenwartslyrik bezeichnen. Zugleich aber erlaubt er auch den Blick auf eine längst vergangene Zeit, da sämtliche hier versammelten Texte Nachdichtungen mittelhochdeutscher Lyrik sind, von Texten also, die zwischen etwa 850 und 570 Jahre alt sind - Sartorius etwa wählte sich "Saget mir ieman, waz ist minne?" zur Vorlage, ein Lied Walthers von der Vogelweide.
Es gehe darum, den mittelalterlichen Gedichten "nicht nur dem Wortsinn" nach treu zu bleiben, "sondern auch der Sprachmusik, dem Esprit des Originals", schreibt der Lyriker Jan Wagner, einer der beiden Herausgeber des Bands, in seinem Vorwort, der Peter Rühmkorfs Leistungen auf diesem Gebiet lobt und die Dieter Kühns seltsamerweise verschweigt. Was "Esprit" in diesem speziellen Fall heißen kann, führt Wagners Mitherausgeber, der Lyriker und studierte Mediävist Tristan Marquardt in einer kurzen Einführung in den Minnesang aus: "In der besungenen Frau vereinen sich die höchsten Werte der Gesellschaft und alle Gründe für Begehren", schreibt Marquardt, dadurch sei die Dame aber auch unerreichbar, und so erkläre sich die "Unmögliche Liebe", der Titel des Bandes. Ein beträchtlicher Anteil der hier abgedruckten Lieder illustriert das sehr anschaulich.
Dass dies allerdings kein ehernes Gesetz, sondern ein Konzept ist, von dem aus sich auch inhaltliche Varianten bis hin zum schieren Gegenteil des keuschen Anschmachtens und Besingens entwickeln lassen, wird spätestens beim Blick auf die mittelalterlichen wie neuzeitlichen Texte dieses Bandes deutlich: Etwa in einem, wiederum von Walther von der Vogelweide gedichteten, Lob der Frau von niederem Stand - "was sie auch sagen, dir bin ich hold / und nehme deinen gläsernen ring als einer königin gold", bringt Ulrike Draesner Walthers Lied in heutiges Deutsch. Oder in den sogenannten Tageliedern, die morgendliche Gespräche zwischen Liebenden wiedergeben, die sich nach der Liebesnacht darüber verständigen, ob es schon Zeit sei, sich zu trennen. In Walthers berühmtem "Unter der linden", in dem ein Mädchen das Geheimnis ihrer Liebeserfüllung nur mit ihrem Freund und der Nachtigall ("Tandaradei") teilt. Oder im Lied "Sol ich disen sumer lang" eines Gottfried von Neifen, in dem eine junge Frau lieber tanzen gehen als sich um ihr Kind kümmern will, woraus Nora Gomringer dann den lustigsten Beitrag des ganzen Bandes macht.
Weil das Buch zweisprachig ist, lässt sich die Spannung zwischen der mittelhochdeutschen und der modernen Fassung jederzeit ermessen - manchmal ist das ein Segen, wenn nämlich die heutigen Dichter sich meilenweit von der Vorlage entfernen, wenn sie anbiedernd Vokabeln wie "loser", "posten" oder "dissen" verwenden und damit ihrem eigenen Werk den Verfallsstempel schon jetzt auf die Stirn drücken. Oder wenn sie schlicht so dunkel in ihrer Sprache sind, dass nur der Blick ins Original aus dem dreizehnten Jahrhundert zu verstehen hilft, was unser Zeitgenosse meint: "Du irgend mein, ich dir / Verlass, Verlass sei dir. / In meine Brust / beschlossen, / Schlüsselchen - ists hin. / Wirst noch und je darin." Die Vorlage ist das anonym überlieferte, zauberhafte Liebesgedicht "Du bist mîn, ih bin dîn".
Die Nachdichter widmen sich hingebungsvoll auch den weniger bekannten Minnesängern - wer hätte schon von Gottfried von Neifen gehört, Eberhard von Cersne, Otto von Botenlauben? Von Autoren mit so aparten noms de plume wie "Der Taler", "Der wilde Alexander", "Der Marner" oder "Muskatblut"? Dass eine ganze Reihe nahezu kanonischer Werke der mittelhochdeutschen Lyrik fehlen, wird man darüber leicht verschmerzen. Schade ist höchstens, dass hier, wenn es in der Sammlung schon so ausdrücklich um Liebe, gar um auf Werben, Zurückweisen und Entsagen gebaute höfische Liebeskonzepte geht, ein geradezu entlarvendes Lied des Kürenbergers fehlt, den man darin als frühesten Macho der deutschen Literatur kennenlernt. "Wîp unde federspil", so heißt das Lied, "Frauen und Vögel", die nämlich eines gemeinsam hätten: Wenn sich der Mann darauf verstehe, sie abzurichten, dann täten sie ihm seinen Willen. Er, der Sänger, erinnere sich jedenfalls an eine entsprechende Geschichte, und das lasse ihm das Herz noch immer höher schlagen. Derlei erotische Prahlereien erklären ganz gut, warum die Diskretion in den Minnegedichten sonst so groß geschrieben wird.
Nicht immer geht es um Liebe, immer aber geht es in den Gedichten, die uns noch heute treffen, um etwas Grundsätzliches, um Erfahrungen, die völlig zeitlos sind: "Weh, wo sind entschwunden alle meine Jahr? / Hab mein Leben ich geträumt oder ist es wahr?", so beginnt ein Lied des hier zu Recht umfangreich vertretenen Walters von der Vogelweide, in dem ein alter Mensch kaum noch Zugang findet zum eigenen, jüngeren Ich, von dem ihm nur eine schemenhafte Erinnerung geblieben ist. Und wenn die Jugend tatsächlich nur ein Traum war? "Nun bin ich aufgewacht", das wenigstens steht fest, es unterbricht den Vers wie ein Donnerhall: "Und mir ist unbekannt / was mir so vertraut war wie meine andre Hand. / Leut und Land, darinnen ich Kind gewesen bin / sind mir fremd geworden wie es Lügen sind. / Meine Spielgefährten sind träge nun und alt: Das Feld, es ist bestellt, gerodet ist der Wald."
Kaum glaublich, dass man dies jemals ungerührt lesen könnte, dieses leise zitternde Unbehagen des Sängers an einer gewandelten Welt, die er nicht mehr versteht, während er die Zeichen des Verfalls nur an den anderen wahrnimmt, den träg gewordenen Genossen. Alt, ich? Einen solchen Text muss niemand groß aktualisieren, selbst wenn das Gedicht wie dieses achthundert Jahre alt ist, und die Übertragung von Richard Pietraß stellt sich mit ruhiger Gewissheit in den Dienst der Vorlage.
Dabei kommt es gar nicht darauf an, die vorgefundene Form sklavisch zu kopieren, wenn man sie etwa - wie Ulf Stolterfoht in der Nachdichtung von "ich zôch mir einen valken" - produktiv abwandelt. Denn der moderne Autor verkürzt die letzte Zeile der ersten Strophe just in dem Moment, in dem der geliebte Falke nach Jahren der Ausbildung nun festlich geschmückt aufsteigt, der Blick ihm sehnsüchtig folgt und schließlich ebenso ins Leere geht wie der Rhythmus des Gedichts.
Wovon aber ist die Rede, warum steht das Falkenlied in dieser Sammlung, in der es doch ausdrücklich um Liebe gehen soll? Nicht nur wegen der letzten Zeile, in der es heißt, dass Gott die getrennten Liebenden zusammenführen möge, sondern weil schon zuvor der Falke leicht als ein stolzer Ritter zu identifizieren ist, der ausgebildet und herausgeputzt wird, damit er dann "in anderiu lant" Ruhm und Ehre erwerben kann. Aber wem? Sich selbst, natürlich, zugleich soll er auch denjenigen Ehre machen, die ihn da jahrelang zu dem formten, der er nun ist.
Das rührt an einen zentralen Punkt im mittelalterlichen Liebeskonzept, der in der Einleitung des Bandes etwas unterbelichtet bleibt: Denn der liebende Ritter, dem die erotische Erfüllung versagt bleibt, profitiert von seiner Hinwendung, indem ihn diese zu einem besseren, "höfischeren" Menschen macht.
In einem Gedicht Albrechts von Johansdorf fragt deshalb ein kläglich jammernder Ritter seine Dame, ob ihm seine jahrelange Hingabe denn gar keinen Lohn eintrüge? Doch, sagt sie, und Hans Thill dichtet die Antwort nach: "Ihr habt nun viel gelernt und seid dabei noch guter Dinge." Hier allerdings ist das Original einmal präziser und schöner: "Das ir dest werder sind dâ bî hôhgemuot."
Tristan Marquardt, Jan Wagner (Hrsg.): "Unmögliche Liebe". Die Kunst des Minnesangs in neuen Übertragungen.
Hanser Verlag, München 2017. 304 S., geb., 32,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
"... wer immer sich auch nur von ferne für Lyrik interessiert, sollte sich das Spektakel nicht entgehen lassen." Hans-Herbert Räkel, Süddeutsche Zeitung, 21.10.17
"Es ist ein großes Abenteuer, die Elementartexte der deutschen Dichtung zu erkunden und sich von dieser vorzüglichen, an Entdeckungen überreichen Anthologie zu den Quellen der modernen Dichtkunst führen zu lassen. Die Poesie des Mittelalters und die Lyrik der Gegenwart geraten hier in ein außerordentlich lebhaftes Gespräch, in dem sämtliche Möglichkeiten dichterischen Sprechens durchbuchstabiert werden." Michael Braun, ZEIT online, 01.10.17
"Es ist ein großes Abenteuer, die Elementartexte der deutschen Dichtung zu erkunden und sich von dieser vorzüglichen, an Entdeckungen überreichen Anthologie zu den Quellen der modernen Dichtkunst führen zu lassen. Die Poesie des Mittelalters und die Lyrik der Gegenwart geraten hier in ein außerordentlich lebhaftes Gespräch, in dem sämtliche Möglichkeiten dichterischen Sprechens durchbuchstabiert werden." Michael Braun, ZEIT online, 01.10.17