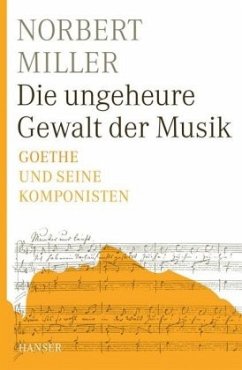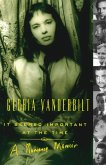Mozart erschloss sich ihm spät, Beethoven blieb ihm fremd, Schubert nahm er nicht zur Kenntnis - und doch war Musik für Goethe eine das Leben bestimmende Macht. Die frühen Gedichte sind Lieder, die für Herder gesammelten Volkslieder aus dem Elsass versah er mit Melodien, und seine Sturm-und-Drang-Hymnen sang der Dichter Wind und Wetter entgegen. Gemeinsam mit Jugendfreund Philipp Kayser, später mit den Komponisten Johann F. Reichardt und Carl F. Zelter verfolgte Goethe die Vision einer sich in Musik vollendenden Dichtkunst. Norbert Miller erzählt die ungewöhnliche Geschichte dieser Utopie: ein Panorama der musikalischen Lyrik im goldenen Zeitalter der Dichtung in Deutschland.

Sanglich, natürlich: Norbert Miller verteidigt Goethes Musikverständnis
Lange Zeit hat man von Goethes Musikverständnis nicht viel gehalten. Berlioz hatte er abgelehnt, Schubert nicht zur Kenntnis genommen, sich gegen Beethoven reserviert gezeigt. Selbst das hohe Lob der „Entführung aus dem Serail”, das in der „Italienischen Reise” gespendet wird, ist eine nachgeholte Einsicht, der erste Kontakt mit dem Werk in Weimar 1785 verlief zäh. „Um die Mitte des 19. Jahrhunderts spätestens verwandelte sich das Kopfschütteln seiner (nämlich Goethes) Zeitgenossen in die philisterhafte Missbilligung, die dem Dichter mit dem Talent für die Musik auch jedes Urteilsvermögen absprach.” So resümiert der Berliner Philologe Norbert Miller in seinem Buch „Die ungeheure Gewalt der Musik. Goethe und seine Komponisten” das gängige Urteil, um diesem eine neue Sicht entgegenzustellen.
Schon mit dem Titel wird angedeutet, dass Goethe der Musik höchsten Rang zugesprochen habe. Nicht gerade gewaltig ist allerdings der künstlerische Anlass für den Ausruf: „Nun aber doch das eigentlich Wunderbarste! Die ungeheure Gewalt der Musik auf mich in diesen Tagen!” In Marienbad hatte Goethe im August 1823 die Sopranistin Anna Milder-Hauptmann vier polnische Lieder, die Pianistin Maria Szymanowska vier kurze Klavierstücke, Salonpiecen, vortragen hören. Wenn ihn das so tief ergriff, so hatte es mit seiner leidenschaftlich aufgewühlten Stimmung zu tun: der Sommer 1823 war der des Ulrike von Levetzow-Erlebnisses. (Das Gedicht „Aussöhnung”, der Szymanowska ins Stammbuch geschrieben und später den Schluss der „Trilogie der Leidenschaft” bildend, endet mit der Zeile „Das Doppelglück der Töne wie der Liebe”.)
Und, das zeigte sich immer wieder: Goethe reagierte stark auf die einzelne Aufführung und auf die ausübenden Musiker (den „Zauber der Person”, wie es Miller nennt), das aufgeführte Werk tritt dahinter zurück. Am deutlichsten wird das bei seiner musikalisch substantiellsten Begegnung, der mit dem jungen Felix Mendelssohn-Bartholdy. Er bewunderte, ja liebte ihn als Pianisten im Haus am Frauenplan, den Komponisten nahm er nur beiläufig zur Kenntnis.
Eine ganze Weile versuchte Goethe, in der Gattung des Singspiels etwas zu erreichen. Als er 1786 nach Italien aufbrach, hatte er auch die Manuskripte der unfertigen Singspiele im Gepäck, um daran weiterzuarbeiten. Ausführlich beschreibt Miller Goethes Zusammenarbeit mit den Komponisten Philipp Christoph Kayser und Johann Friedrich Reichardt. Das zweite musikalische Feld, auf dem er große Hoffnungen hegte, war das des Liedes. Bis in die Ausgabe letzter Hand eröffneten die „Lieder” und „Geselligen Lieder” als eigene Abteilung die Lyrik. Sein Ideal der Vertonung ging auf einfache Sanglichkeit und Natürlichkeit. Verzierungen der Gesangslinie und aufwendige instrumentale Begleitung störten – wie auch „die Volksweise und das antikisierende Idyll” für ihn „die beiden der Musik ursprünglich zugewandten Sphären der Musik” waren.
Dieses Ideal der Einfachheit verstärkte sich. Miller diagnostiziert die sich im Laufe des Briefwechsels mit Zelter verfestigende Überzeugung, „jedes zum Singen bestimmte Gedicht habe nur eine ihm angemessene, in seinem Innersten klingende Melodie, nach der die beiden wahlverwandten Künstler in ihrer Einbildungskraft suchen und die sie, oft erst nach mancherlei Zwischenstufen, im vollendeten Kunstgebilde beglückt wiedererkennen.”
Abwehr und Bewunderung
Das meint, so Miller, nicht die radikale Unterwerfung des Musikers unter die Poesie. Aber der Vorrang des Dichters oder der Dichtung ist doch unverkennbar. Am deutlichsten erkennt man ihn in Goethes Abneigung gegen durchkomponierte Lieder. Strophische Gedichte wollte er strophisch vertont hören, so wird er für die Erlkönig-Vertonung, die ihm Franz Schubert über Mittelsmänner zugesandt hatte, kein Verständnis gehabt haben. „Verwerflich” nennt Goethe diese Kompositiontechnik, weil „der allgemeine lyrische Charakter ganz aufgehoben und eine falsche Teilnahme am einzelnen gefordert und erregt wird”. Es ist eine Argument aus klassischem Geist, das die Stabilität der vorgegebenen metrischen Form auch musikalisch gewahrt wissen will, ein Verdikt gegen das neue Verständnis musikalischen Rechts.
Dieser neue Anspruch der Musik, eine Kunst zu sein, nicht geringer als irgendeine andere und jedenfalls mehr als ein Hilfsmittel zur Steigerung sprachlich erzeugter Eindrücke, artikulierte sich um 1800 und wurde von vielen als eine Anmaßung verstanden. Vorkämpfer dieses Selbstgefühls ist Beethoven, sein Herold E.T.A. Hoffmann. Beethoven liebte es, sich als „Tondichter” zu bezeichnen, auf das Titelblatt der Namensfeier-Ouvertüre setzte er den Vermerk „Gedichtet von Ludwig van Beethoven”. Goethe reagierte auf solchen Anspruch der Musik zurückhaltend. „An den Beethoven wollte er gar nicht heran”, berichtet Mendelssohn-Bartholdy im Sommer 1830 aus Weimar. Und schildert dann, wie in Goethe Abwehr und Bewunderung miteinander kämpfen, als ihm der Gast den ersten Satz der V. Symphonie vorspielt. „,Das ist sehr groß, ganz toll, man möchte fürchten, das Haus fiele ein; und wenn das nun alle Menschen zusammenspielen!’”
Später, bei Tisch, fing Goethe wieder davon an. Es muss ein großer Eindruck gewesen sein, doch einer, den er abwehrte und früher schon abgewehrt hatte. Das Aufkommen der Instrumentalmusik, den „neuen Weg” im musikalischen Formdenken, wie es bei Beethoven heißt, hat Goethe ignoriert. Überraschen muss das nicht, es gehört zur seelischen Ökonomie des Künstlers, Welt und künstlerische Welt selektiv wahrzunehmen. Musste die neue Idee autonomer Musik nicht dem „realistische Tic” Goethes, seinem „anschaulichen Denken” fremd bleiben?
Eine blinde Stelle bleibt es aber. Norbert Miller möchte in seinem Buch die Kritik des 19. Jahrhunderts an Goethes Musikverständnis als philisterhaft erweisen, und gewiss hat die dahinterstehende Bewunderung des „Titanentums” Beethovens oft philisterhafte Züge. Aber das Material, das Miller dann mit geschäftiger Hand ausbreitet, bestätigt den sachlichen Befund, gegen dessen Bewertung er vorgeht. „Offen für jede Erweiterung seiner Einsichten” sei Goethe gewesen, meint Miller, um fortzufahren, dass dessen „Umgang mit den kompositorischen Entwicklungen der Zeit” von den Zielen seiner frühesten Jugend bestimmt gewesen sei. Das zog die Grenzen der Goetheschen Anerkennungsbereitschaft eng, gerade in jenem Moment, in dem über Instrumentalmusik neu und größer gedacht wurde. STEPHAN SPEICHER
NORBERT MILLER: Die ungeheure Gewalt der Musik. Goethe und seine Komponisten. C. Hanser Verlag, München 2009. 448 Seiten, 24, 90 Euro.
Verunglücktes Treffen: Das Gemälde von Carl Röhling zeigt Ludwig van Beethoven und Johann Wolfgang von Goethe in Teplitz, 1811 Abb.: Blanc Kunstverlag / SZ Photo
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.sz-content.de

Ein Konservativer war Goethe in Sachen Musik gewiss. Doch sein Ideal einer Vertonung war hochgesteckt: Norbert Miller hat dem Dichter und seinen Komponisten ein hinreißendes Buch gewidmet.
Dass Goethe sich gegenüber der "modernen" Musik seiner Zeit, der doch die Zukunft gehören sollte, distanziert, ja ablehnend verhielt, ist eine Binsenweisheit. Niemand wird jedoch aus dieser Tatsache heute noch Schlussfolgerungen ziehen wie jener Goethe-Verehrer in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, der glaubte konstatieren zu müssen, "der Größte der Großen" habe nur "sehr platonische Beziehungen" zu Musik gepflegt, "und wo er sie knüpfte, tat er es am falschen Ort". Und doch ist der Schatten von Goethes Verweigerung nie ganz verschwunden.
Wenn nun ein seit langem wegen geglückter Grenzüberschreitungen gefeierter Germanist seine Gelehrsamkeit Goethes Komponisten widmet, diese Formel aber nur als Untertitel verwendet und darüber Goethes eigenes Wort von der ungeheuren Gewalt der Musik setzt, darf man weit mehr erwarten als ein fast nebenbei sich erledigendes Wegräumen von Restbeständen langgehegter Vorurteile.
Wer freilich, vom Doppeltitel angezogen, auf eine Lektüre von jener Art hofft, wie sie mit den Publikationen zu Goethe-Schiller-et-cetera-Jubiläen stets termingerecht geboten werden, wird schwerlich auf seine Kosten kommen. Von dergleichen saisonalen Veröffentlichungen unterscheidet sich Millers meisterlich komponiertes Buch grundlegend. Denn obwohl der Autor nicht nur ein hochgelehrtes Haus ist, sondern auch ein genuiner Schriftsteller, bietet er keine anstrengungsfreie Bildungsvermehrung, mit der sich trefflich konversieren ließe. Vielmehr stellt er Kenntnisse und Schreibvermögen ganz in den Dienst der komplizierten Sache, die verfehlt, wer sie simplifiziert. So geht den Hauptkapiteln über die Komponisten eine detaillierte Darstellung "Lied und Lyrik nach 1750" voraus.
Behagliche Hofluft atmen.
Da Goethe eine Art kopernikanischer Wende der deutschen Lyrik herbeigeführt hat, wird leicht übersehen, dass er an den "Liedern" als den erst im Gesang sich vollendenden Kunstwerken festgehalten hat, also in dieser Hinsicht ein vorgoethischer Konservativer geblieben ist. Erst von hier aus erklärt sich zureichend auch seine bleibend zeitgebundene und dennoch fortschreitend mit der eigenen Dichtung die Grenzen weit hinter sich lassende Passion für Singspiele und Opern: eine Leidenschaft, die schließlich mit der Vollendung von "Faust II" gekrönt wird. Dem Gelingen dieses Gesamtkunstwerkes sui generis, bei dem die symbolischen Bildvisionen ihre Entsprechung in der zu höchster Kunst gesteigerten Sprachmusik gefunden haben, gehen die Jahrzehnte der unerfüllten, weil unerfüllbaren und also enttäuschten Hoffnungen voraus, die Goethe in "seine" Komponisten gesetzt hatte.
Der Erste, Philipp Christoph Kayser, gehört zur Heerschar der Vergessenen. Selten genug, dass einer von denen durch die Archäologen der Musikhistorie aus dem Schattenreich, "wo Tote nichtig und sinnlos wohnen", wieder ans Licht geholt wird. Ob Kayser solche Gunst auch ohne die zeitweilige Zusammenarbeit mit Goethe gewährt worden wäre?
Von anderer Statur war der Zweite in der aufsteigenden musikalischen Trias: Johann Friedrich Reichardt. Dessen Goethe-Kompositionen sind zwar alles andere als Nebenwerke; dennoch beruht sein Rang nicht allein auf ihnen. Überdies ist dieser auch schriftstellerisch begabte deutsche Kosmopolit eine symbolträchtige und dadurch allein schon faszinierende Figur jener Epoche, in der das Unterste zuoberst geriet, um alsbald wieder rückwärtszulaufen. Reichardt begann dreiundzwanzigjährig seine Laufbahn als Kapellmeister von Friedrich dem Großen. Auch von dessen Nachfolger auf dem Preußenthron wird Reichardt so geschätzt, dass ihm Freiheiten und Beurlaubung weit über das zeitübliche Maß hinaus gewährt werden. Deshalb kann es den ewig Unruhigen auch in das Paris der Revolution treiben. Der utopische Enthusiasmus, der ihn dort ergreift, trübt ihm die Sehschärfe über die nicht zu verletzenden Grenzen. Miller charakterisiert ihn treffend als einen "Meister im Verkennen einer Situation". Die Entlassung und damit der "Sturz ins Bodenlose" trifft Reichardt 1794. Goethes Fazit: "Und so war er von der musikalischen Seite unser Freund, von der politischen unser Widersacher." Aber der Riss bedeutete nicht das Ende der Verbindung.
Der dritte Name der Trias: Carl Friedrich Zelter. "Endliches, Unendliches Gespräch", so lautet die Bezeichnung des Hauptschiffes von Millers Goethe-Kathedrale. Das Gespräch beginnt unauffällig zu der Zeit, in der die Verbindung mit Reichardt in der schärfsten Krise steckt. Es dauert, zum "Freundschaftsbund" geworden, bis 1832: Acht Wochen nach Goethe stirbt auch Zelter.
Die Hoffnung des Dichters, dass sich mit dem "frisch akquirierten Komponisten" die nie aufgegebenen Träume von größeren Formaten realisieren würden, erfüllte sich zwar nur sehr bedingt, aber in seinem schon bald geweckten "Urvertrauen" sah Goethe sich nicht getäuscht. Zelter, dem Sohn und Erben eines erfolgreichen Bauunternehmers, war die bürgerliche Sicherheit in die Wiege gelegt worden, und er hat sie zeitlebens zu schätzen gewusst. Aber das musikalische Elementarwissen hatte er sich in der Jugend autodidaktisch aneignen müssen. Im Unterschied zu jenen, die meinten, über den "Maurer und Musiker" witzeln zu sollen, wusste Goethe die bürgerliche Solidität des gestandenen Mannes zu schätzen, der während der Jahre ihrer wachsenden Freundschaft Leiter der Berliner Singakademie, Mitglied der Akademie der Künste, Professor an der Universität und zumal ein erfolgreicher Lehrer wurde.
Dass Felix Mendelssohn Bartholdy, das Wunderkind, "der neue Mozart", zu seinen Schülern zählte, war ein Glück, das Zelter mit Goethe geteilt hat. Vierzehnmal war Zelter in Weimar. Vergeblich versuchte er, Goethe wenigstens einmal zu einem Besuch von Berlin zu bewegen, das doch im Hinblick auf Musik und Musiktheater so viel mehr zu bieten hatte. Die Gewinner dieser von Miller genau analysierten Abstinenz sind wir Nachgeborenen. Denn die in der Provinz-Residenz doch stets mit Spannung erwarteten Neuigkeiten aus der Hauptstadt haben zum facettenreichen Kolorit einer der wichtigsten Goethe-Korrespondenzen beigetragen.
In die beiden Zelter-Teile ist, als "phantasmagorisches Zwischenspiel", das Aufeinandertreffen von Goethe und Beethoven eingeschoben. Obwohl der Komponist den Dichter tief verehrt hat, verhehlte er nicht seinen Unwillen darüber, dass Goethe "die Hofluft zu sehr" behage. Hierher gehört natürlich die Legende, die sich darum gerankt hat, wie die beiden im böhmischen Prominentenbad Teplitz Napoleons Gemahlin, der österreichischen Kaisertochter und nunmehrigen Kaiserin von Frankreich, samt ihrem Tross von österreichischen Herzögen begegnen. Wohl bezweifelt Miller den Wahrheitsgehalt der Überlieferung, der zufolge der Dichter, beiseitetretend, "den Hut artig in der Hand", die fällige Reverenz erweist, während der Musiker "grimmig sich und dem Hut den Weg durch die höfische Adelswelt" bahnt.
Kein Pardon für Neunmalkluge.
Aber Miller zitiert, allem Zweifel zum Trotz, die dubiose "Quelle" mit sichtlichem Behagen, und nicht allein, um hinter der Anekdote die fundamentale Unterschiedenheit der beiden "Statthalter der Kunst auf Erden" ins Relief zu treiben. Im Kleingedruckten der Anmerkungen schließt das Forschungsresümee mit robust-frischem Freimut: "Ich für meinen Teil mache kein Hehl aus der Tatsache, dass ich in meinem geschichtlichen Erinnerungstheater ungern auf die Szene im Schlosspark verzichten würde."
Wenn auch, freilich aus anderen Gründen, das Beethoven-Kapitel als einziges weniger wohlproportioniert erscheint als die übrigen, lässt "Zelter II" das sogleich vergessen. Denn auf diesem, dem wahren Höhenzug des Buches wird nicht nur eine Fülle von musikwissenschaftlichem, literargeschichtlichem, soziologischem Material der Jahrzehnte bis 1832 souverän bewältigt, sondern auch die für eine angemessene Interpretation des Briefwechsels nötige Filigranarbeit geleistet. Nicht schlichtes Einfühlungsvermögen ist da gefordert, sondern Urteilsfähigkeit und Sensibilität für die psychologische und philologische Dechiffrierung.
Sie gelingt. Damit widerfährt dem einzigartigen Freundespaar und mit ihm jenen, die zu seiner Geisteswelt gehörten, die Gerechtigkeit, die von den blinden Verehrern ebenso verfehlt wird wie von den nachgeborenen Neunmalklugen: Es ist die höhere Gerechtigkeit des vom Bund mit den Musen geadelten historischen Bewusstseins.
ECKHARD HEFTRICH.
Norbert Miller: "Die ungeheure Gewalt der Musik". Goethe und seine Komponisten. Carl Hanser Verlag, München 2009. 448 S., Abb., geb., 24,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
So ehrenhaft die Aufgabe, die sich der Autor stellt, so wenig überzeugend erfüllt Norbert Miller sie in seiner Studie zu Goethes Musikverständnis. Zu diesem Schluss kommt Stephan Speicher, nachdem er sich von Miller Goethes Begegnungen mit den Komponisten Felix Mendelssohn-Bartholdy, Philipp Christoph Kayser und Johann Friedrich Reichardt hat schildern und auseinandersetzen lassen und damit Goethes Präferenz erstens der Person (vor dem musikalischen Werk), zweitens des Ideals der Einfachheit (der Melodie) und drittens der Dichtung (wie auch sonst). Goethes Verhältnis zur Musik als ein von Abwehr und Bewunderung bestimmtes, eher selektives, mindestens aber zurückhaltendes zu bezeichnen, erscheint Speicher angemessen. Nur dass der Autor mit seinem "mit geschäftiger Hand" ausgebreiteten Material eigentlich das Gegenteil beweisen wollte.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
"Norbert Millers Studie schließt elegant und kenntnisreich eine Forschungslücke. ... Millers glänzend geschriebene, umfassende Würdigung von Goethes Musikgenossenschaft zeichnet die Grenzen von Goethes Genie-Musikverstand scharf nach... [eine] fulminante Studie." Kai Luehrs-Kaiser, Die Welt, 01.08.09
"Ein Buch zum Lesenlernen wie zum genauen Hören." Holger Noltze, Literaturen 10.09
"In der Gründlichkeit, mit welcher Norbert Miller der Geschichte einzelner Liedvertonungen nachforscht, setzt er Massstäbe." Sigfried Schibli, Basler Zeitung, 06.01.10
"Miller hat dem Dichter und seinen Komponisten ein hinreißendes Buch gewidmet." Eckhard Heftrich, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 21.01.10
"Ein Buch zum Lesenlernen wie zum genauen Hören." Holger Noltze, Literaturen 10.09
"In der Gründlichkeit, mit welcher Norbert Miller der Geschichte einzelner Liedvertonungen nachforscht, setzt er Massstäbe." Sigfried Schibli, Basler Zeitung, 06.01.10
"Miller hat dem Dichter und seinen Komponisten ein hinreißendes Buch gewidmet." Eckhard Heftrich, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 21.01.10