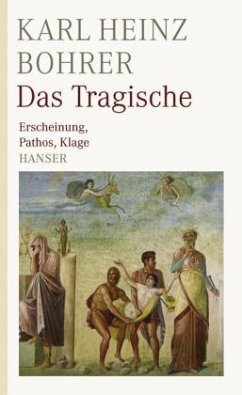Vor 2500 Jahren fanden Aischylos, Sophokles und Euripides in Athen eine Theatersprache, die uns bis heute bewegt. Ein wesentliches Element der attischen Tragödie ist der Schrecken: Er soll beim Zuschauer moralische reinigende Wirkungen entfalten. In der Moderne hat sich die Kunst von Ansprüchen der Moral befreit. Karl Heinz Bohrer konzentriert sich bei seiner Interpretation der griechischen Tragödien deshalb auf ästhetische Fragen. Aus dieser Perspektive werden Verbindungslinien sichtbar, die aus dem antiken Griechenland und der Welt der Polis in die Moderne führen. Die Ästhetik des Schreckens sorgt dafür, dass uns das attische Theater nicht zur Ruhe kommen lässt.

Der Traum des Aischylos und der schöne Schrecken: Karl Heinz Bohrer sucht „Das Tragische”
In den „Hiketiden” des griechischen Tragödiendichters Euripides gibt es eine Verfassungsdebatte. Eigentlich handelt diese Tragödie, um 423 vor Christus in Athen aufgeführt, von den trauernden Müttern der im Kampf gegen die Stadt Theben Gefallenen. Diese „Schutzflehenden”, so der Titel des Stücks auf deutsch, erhoffen sich von Athen Hilfe, weil Theben sich weigert, ihre toten Söhne zu bestatten – ein Problem, das man auch aus Sophokles’ „Antigone” kennt. Es geht also eigentlich um Asylsuche, um Leid und Krieg. Als aber in einer Szene des Dramas ein Gesandter aus Theben eintrifft und mit der Frage beginnt: „Wer ist der Alleinherrscher (tyrannos) dieses Landes?”, da reagiert Theseus, der in Athen regiert, unwirsch: „Du irrst schon am Anfang deiner Rede, Fremder, wenn du hier einen Tyrannen suchst. Denn nicht von einem Einzelnen wird die Stadt beherrscht: sie ist frei. Das Volk bekleidet Jahr um Jahr der Reihe nach die Ämter, wobei es nicht dem Reichtum einen Vorrang gibt, sondern auch der Arme gleiches Recht besitzt.”
Daraufhin entspinnt sich bei Euripides eine Kontroverse über die beste Staatsform. Der diktaturfreundliche Thebaner warnt vor der Herrschaft des inkompetenten „Pöbels”, Theseus hingegen lobt die Gleichheit vor dem schriftlich kodifizierten Gesetz und die Redefreiheit in der Demokratie. Das ist paradox und anachronistisch, denn Theseus, der Anwalt der Volksherrschaft, ist in den „Hiketiden” schließlich selber Alleinherrscher und repräsentiert als Gründungsheros der Stadt das frühe Königtum Athens vor der Einführung der Demokratie. Die Demokratie, von der dieser Theseus spricht, ist also nicht diejenige der mythischen Zeit oder auch Nicht-Zeit, in der das Drama spielt; es ist vielmehr diejenige Demokratie, in der Euripides’ Zuschauerschaft, in der das versammelte athenische Publikum zur Zeit der Uraufführung des Theaterstücks gelebt und intensiv Politik betrieben hat. So kann ein König für die radikale Direktdemokratie sprechen.
Solche Verschränkungen sind typisch für die große Zeit der griechischen Tragödie im fünften Jahrhundert vor Christus: Zum einen führt sie große Menschen aus dem mythologischen Adel vor, die Schreckliches tun und erleiden. Es sind Figuren, deren Schicksal, wie schon Aristoteles analysierte, nur dann zur exemplarisch starken Tragik gerät, wenn beides, Figur wie Schicksal, eine gewisse Größe hat. Insofern ist die attische Tragödie nicht in dem Sinne „bürgerlich”, wie es das so betitelte Trauerspiel seit dem 18. Jahrhundert ist. Zum anderen aber kommen bei Aischylos, Sophokles und Euripides immer wieder zeitdiagnostische Konkretionen zum Vorschein, die das Allgemeinmenschliche oder das Mythisch-Ästhetische mit Reflexionen über aktuelle Probleme verbinden: Probleme einer politischen und gesellschaftlichen Gegenwart, in der der erobernde Mensch die Grenzen des Gewohnten immer weiter ausdehnte. Insofern ist die attische Tragödie doch bürgerlich, oder besser: bürgerschaftlich – sie sprach bei ihrer Aufführung zum kollektiven Dionysos-Fest die Menge der athenischen Bürger an, und zwar in einem Theater am Hang der Akropolis, in dem öfters auch Volksversammlungen abgehalten wurden.
Ungeheuer ist viel, doch kaum etwas ist ungeheurer als die Abneigung des Literaturwissenschaftlers und Merkur-Herausgebers Karl Heinz Bohrer gegen psychologische, historische, ethnologische, moralisierende oder (geschichts-)philosophische Interpretationen der Tragödie. Von Mythos zu Logos, von Schuld zu Sühne, von Kult zu Kultur, von Mitleid und Schrecken zur Katharsis – all solche teleologischen, sinnstiftenden Modelle haben, stärker oder schwächer dosiert, den Geschmack des Fortschritts.
Und die Freunde des Fortschritts sind Bohrers Freunde nicht. Deshalb ist so etwas wie jene Demokratie-Passage bei Euripides für ihn gar nicht tragisch, obgleich sie in einer Tragödie steht. Denn alles, was nach Rhetorik und Politik, nach Dialog und Räsonnement aussieht (und davon gibt es bei den großen drei attischen Tragikern gar nicht wenig), all das zählt nicht. „Das Tragische” – so lautet der Titel von Bohrers neuem Buch – manifestiert sich ihm nämlich ausschließlich in der „Erscheinung des Schreckens qua sprachlicher Gestaltung”.
Nicht im spannungsvollen Ineinandergreifen von Zeit- und Grundsatzfragen, sondern nur im grandiosen, unauflösbaren Pathos wird, so der Autor im Anschluss an Gedanken Friedrich Nietzsches, „die Ästhetik der Tragödie ernst genommen”. Dazu gehöre auch „das Ästhetischwerden des Bösen”, etwa bei Klytämnestra in Aischylos’ „Agamemnon” oder in Euripides’ „Bakchen” . Mit seiner Betonung der schrecklichen Epiphanie will Bohrer dem seit Aristoteles und Hegel hartnäckig immer wieder erscheinenden „untragischen Zeitgeist” wehren. Deshalb besteht sein Buch über die Tragödie auch nur zur einen Hälfte aus Untersuchungen über die attischen Tragiker, zur anderen Hälfte jedoch aus Kapiteln über Charles Baudelaire.
Der war zwar kein Dramatiker, aber die Verbindung besteht trotz der Gattungsdifferenz laut Bohrer darin, dass der Lyriker des 19. Jahrhunderts gleichfalls mit einem „dramatischen Gestus” die „Evokation des schönen Schreckens” zum Programm gemacht habe. Baudelaire, der Pionier der Moderne, teile mit der wahren Tragödie des Altertums die frenetische Trauer über die „Unwiederbringlichkeit des Verlorenen” und die Unendlichkeit des Leidens. Nimmt man eine Stelle in den „Fleurs du Mal” hinzu, die vom „Traum des Aischylos” spricht, der wiederum Shakespeares grausame Lady Macbeth imaginiert, sowie weitere Anknüpfungen an antike Stoffe, dann lässt sich unter der Anleitung von Karl Heinz Bohrer aus Baudelaire und den Alten ein epochenübergreifendes Bündnis schmieden: ein Bündnis zugunsten eines nicht-progressiven, vernunftskeptischen Modernitätsverständnisses. Ein Bündnis gegen jegliche political correctness des geschichtlichen Denkens, denn diese lauert in der moralisierenden Tragödieninterpretation ebenso wie in den historistischen Kulturwissenschaften, die, wiewohl vom Autor durchaus zur Kenntnis genommen, der ästhetischen Wucht des Tragischen nicht beizukommen vermögen.
Während Baudelaire „die Tragödie in Permanenz installiert” hat, konnte es, so Bohrer, nur den „eudämonistisch-utopistischen” Strömungen der jüngeren Zeit einfallen (etwa George Steiner oder Peter Szondi), das Tragische für erledigt zu erklären. Doch diese Zeiten sind vorbei, heute herrscht eine ernstere Zeitstimmung, „denn offenbar reichen die gängigen Maßstäbe der Vernunft nicht aus, um Wirklichkeit und Sittlichkeit in Übereinstimmung zu bringen”.
Es erübrigt sich wohl noch auszusprechen, dass aus diesen pointierten und zum Teil nicht zum ersten Mal geäußerten Grundannahmen ein äußerst einseitiges Buch entstanden ist. Aber es ist zugleich ein gelehrtes, faszinierendes und immer wieder erhellendes Buch geworden. Karl Heinz Bohrer – motiviert von der „Erinnerung an eine Aufführung von Aischylos’ ,Agamemnon‘ durch die Oberprima meines Gymnasiums” – hat nicht nur attische Tragödien eingehend studiert, sondern durchaus auch Etliches von der altertumswissenschaftlichen Forschung darüber. Und in der Tat legt der Autor den Finger darauf, dass die Altertumswissenschaft aus einem verständlichem Überdruss an dem früheren hohen Ton eines nietzscheanisch-tragisch gefärbten Humanismus in den letzten Jahrzehnten zu einer eher rationalistischen, rezeptionsästhetischen, kulturgeschichtlich oder politisch „erklärenden” Deutung der Tragödie geneigt hat.
Gegenüber solchen „harmonisch-historisierenden” Lektüren, wie Bohrer sie despektierlich nennt, arbeitet er vielfach zu Recht heraus, dass in der griechischen Tragödie von dem poetisch gestalteten Schrecken des Leides und der Gewalt immer auch etwas stehen bleibt; dass es dafür keine „Auflösung” gibt. So warnt Bohrer vehement davor, die „Orestie” des Aischylos bloß von ihrem Ende her zu lesen, also die Überwindung einer monströsen Geschichte der Blutrache durch die Installierung eines demokratischen Rechtsstaates in der Schlusssequenz der Trilogie als eine Salvierung aller tragischen Grässlichkeiten zu verstehen. Mit dem Gerichtsverfahren am Schluss, das Orestes, den Mörder der mörderischen Mutter, freispricht, sei kein „Sieg der Rationalität” ausgedrückt, mit dem sich etwa die über die ganze Trilogie elaborierte Stimmung der Angst und das Faktum der Brutalität einfach in Luft auflösten.
In ähnlicher Weise nimmt Bohrer sich weitere Stücke vor. In den zuletzt auf dem Theater wieder sehr beliebten „Bakchen” des Euripides ist für ihn „kein Schuld- oder Schicksalsdiskurs auszumachen”. Die „Antigone” von Sophokles dürfe nicht als politisch-moralisches Lehrstück, als dramatisierte Wertedebatte missverstanden werden, so werde Antigones tragischer Todesdrang übersehen. Und die berühmteste aller griechischen Tragödien, Sophokles’ „König Ödipus”, sei nicht im aufklärerischen Sinne vom bedingungslosen Wissenwollen, vom Drang nach Selbsterkenntnis getragen. Nicht Schillers „tragische Analysis” betreibe Ödipus bei der Aufdeckung von Vatermord und Inzest, sondern „die langsame Verfertigung der Angst beim Reden”.
Das Furchtbare verschwindet nicht, so könnte man Bohrers Tragödiendeutung zusammenfassen. Es hat Kraft und ist auch oft berechtigt, wenn der Autor das spezifisch Poetische der Tragödien betont und die „Eigendynamik imaginativer Angstbilder” vor Augen stellt. Wegen seiner anti-konsensuellen und anti-weltverbesserlichen Agenda, die selbst immer wieder dem Furor des Überzeugten nicht entkommt, wird der Erkenntnisgewinn dieses Buches indes deutlich getrübt. Das Drama der Tragödien, also die Handlung, wird von Bohrer erklärtermaßen missachtet. Die lyrischen Klagen des Chors stehen derart im Mittelpunkt, dass man meinen könnte, die attischen Tragödien seien ein einziges Chorlied. Und die Baudelaire-Griechen-Konstruktion, hergestellt durch die „emphatische Ausdrucksform”, ist bestenfalls willkürlich.
Leben wir wieder in tragischeren Zeiten, wie Bohrer meint? Der große Erfolg der griechischen Tragödien auf dem Theater, den Hellmut Flashar jüngst wieder dokumentiert hat, könnte dafür sprechen. Zur ausgewogenen Erklärung dieser Stücke kann dieses Buch nicht dienen. Aber wer mit Hilfe des Tragischen der Harmlosigkeit zu entkommen sucht, der kann mit Karl Heinz Bohrers Buch beginnen. JOHAN SCHLOEMANN
KARL HEINZ BOHRER: Das Tragische. Erscheinung, Pathos, Klage. Carl Hanser Verlag, München 2009. 413 Seiten, 24,90 Euro.
Die Freunde des Fortschritts sind Bohrers Freunde nicht
Die „Antigone” des Sophokles ist keine Wertedebatte
„Die Inszenierungen der griechischen Tragödie durch die französische Regisseurin Ariane Mnouchkine”, schreibt Karl Heinz Bohrer in seinem neuen Buch, haben „die überwältigende Ausstrahlungskraft im schieren Zeigen des schönen Schreckens verdeutlicht”. Das Bild zeigt eine Szene aus Euripides’ „Iphigenie in Aulis”, 1990 im Rahmen von Mnouchkines „Atriden”-Projekt am Théâtre du Soleil aufgeführt. Foto: Martine Franck/Magnum
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.sz-content.de
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
Michael Jeismann schätzt Karl-Heinz Bohrer für seinen "bösen Blick" und den unerschrockenen Ästhetizismus, mit denen er die "ängstlich-behäbige Bundesrepublik" zu verachten und provozieren pflegte. Jeismann zufolge scheint Bohrer ein Ende der optimistisch-hedonistische Grundstimmung im Land zu spüren und damit einem neuen Zugang zum Tragischen die Möglichkeit eröffnet. In seinem Buch macht er sich an eine "Systematik des tragischen Phänomens", das er als "theatralischen Exzess der Emotion" begreift, nicht gattungs- und nicht zeitgebunden. Für Bohrer habe nach Jeismanns Darstellung das Tragische keinen Sinn und keine Vernunft, es sei nur "Überwältigung und Erscheinung" und deshalb genau der richtige Ausdruck der Moderne, dieser "Tragödie in Permanenz".
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH