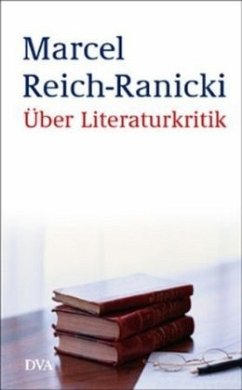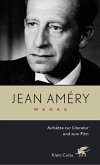Welche Aufgabe hat die Literaturkritik? Welche Funktion übt sie aus? Welche Rolle kommt ihr zu? An wen wendet sie sich? Was will sie erreichen?
Seit mindestens zweihundertfünfzig Jahren werden diese Fragen in Deutschland gestellt und immer wieder mehr oder weniger erregt debattiert. Denn sie treffen ins Zentrum des literarischen Lebens - gestern wie heute. Daher büßen sie, sooft sie auch erörtert und beantwortet wurden, nichts von ihrer Aktualität ein. Jene, die über diese Fragen diskutieren und diesmal besonders leidenschaftlich und bisweilen sogar unerbittlich, die vielen Schriftsteller, Leser und natürlich auch Kritiker, möchten wir an eine Arbeit von Marcel Reich-Ranicki erinnern. Vor vielen Jahren entstanden, ist sie gerade jetzt von besonderem Interesse und bestens geeignet, der Orientierung in den aktuellen Auseinandersetzungen zu dienen.
Der vorliegende Essay wurde 1970 als Einführung zu Reich-Ranickis Buch »Lauter Verrisse« geschrieben; der Band fasst Aufsätze über Günter Eich, Hans Magnus Enzensberger, Günter Grass, Peter Härtling, Günter Kunert, Anna Seghers, Martin Walser, Peter Weiss und andere zusammen. Der ursprüngliche Titel dieses Essays lautete: »Nicht nur in eigener Sache. Bemerkungen über Literaturkritik in Deutschland«. Die ersten beiden Absätze, die Auswahl und Gegenstand des Bandes »Lauter Verrisse« betreffen, wurden hier weggelassen. Davon abgesehen, wird der Text von 1970 unverändert nachgedruckt.
Seit mindestens zweihundertfünfzig Jahren werden diese Fragen in Deutschland gestellt und immer wieder mehr oder weniger erregt debattiert. Denn sie treffen ins Zentrum des literarischen Lebens - gestern wie heute. Daher büßen sie, sooft sie auch erörtert und beantwortet wurden, nichts von ihrer Aktualität ein. Jene, die über diese Fragen diskutieren und diesmal besonders leidenschaftlich und bisweilen sogar unerbittlich, die vielen Schriftsteller, Leser und natürlich auch Kritiker, möchten wir an eine Arbeit von Marcel Reich-Ranicki erinnern. Vor vielen Jahren entstanden, ist sie gerade jetzt von besonderem Interesse und bestens geeignet, der Orientierung in den aktuellen Auseinandersetzungen zu dienen.
Der vorliegende Essay wurde 1970 als Einführung zu Reich-Ranickis Buch »Lauter Verrisse« geschrieben; der Band fasst Aufsätze über Günter Eich, Hans Magnus Enzensberger, Günter Grass, Peter Härtling, Günter Kunert, Anna Seghers, Martin Walser, Peter Weiss und andere zusammen. Der ursprüngliche Titel dieses Essays lautete: »Nicht nur in eigener Sache. Bemerkungen über Literaturkritik in Deutschland«. Die ersten beiden Absätze, die Auswahl und Gegenstand des Bandes »Lauter Verrisse« betreffen, wurden hier weggelassen. Davon abgesehen, wird der Text von 1970 unverändert nachgedruckt.

Lob der Deutlichkeit, Tadel des Understatements: Marcel Reich-Ranickis Manifest zur Literaturkritik / Von Hans Ulrich Gumbrecht
Es gibt mindestens einen Traum der Aufklärung, der bis heute nicht ausgeträumt ist. Dieser Traum verspricht uns, daß eifrig-systematisierendes Sammeln von Wissen und Texten - im achtzehnten Jahrhundert nannte man noch alle Texte "Literatur" - in eine Welt führen soll, wo die Konturen der Wahrheit, die Konturen einer einfachen und kompakten Wahrheit, mit der Wucht endgültiger Evidenz hervortreten. So bedingungslos glaubten zum Beispiel Denis Diderot und sein Freund Jean Le Rond d'Alembert an diesen Traum, daß sie den 1751 erschienenen ersten Band der von ihnen begründeten Encyclopédie mit einem Faltblatt versahen, auf dem - das erhoffte Ende des Encyclopédie-Unternehmens vorwegnehmend - die elementaren Grundstrukturen des Wissens schon in erhabener Einfachheit vorgezeichnet waren. Niemand in Deutschland hat während der vergangenen Jahrzehnte diesen Traum - und all seine Probleme - leidenschaftlicher und mit breiterer öffentlicher Resonanz zur Wirklichkeit eines Lebens und eines Werkes gemacht als der Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki.
Sein Glaube an Aufklärung und an sich selbst als Aufklärer gibt ihm eine - für viele Intellektuelle irritierende - Unbeirrbarkeit. Möglicherweise erklärt diese Unbeirrbarkeit, warum Reich-Ranicki vor kurzem - offenbar als Reaktion auf die Walser-Affäre - einen programmatischen Text "Über Literaturkritik" unverändert wieder veröffentlichte, der vor zweiunddreißig Jahren zum erstenmal erschienen war. Denn, so könnte man den Diskurs der Aufklärung noch einmal zitierend ergänzen, was sich einmal als wahr und praktikabel bewährt hat, bedarf auch später keiner Korrekturen mehr. Und wie Diderots und d'Alemberts Faltplan des Wissens, so hat auch die Welt der Literaturkritik in Marcel Reich-Ranickis Sicht ebenso klare wie einfache Konturen. Er geht davon aus, daß "die Literatur" - ein für allemal, ist wohl unterstellt - die "Möglichkeit und Aufgabe" hat, "der Realität ihrer Gegenwart beizukommen" (was immer das genau bedeuten mag). Fern von aller romantischen Genie-Schwärmerei, setzt Reich-Ranicki weiter voraus, daß "der Kritiker", wenn er denn sein "Gewerbe" versteht und nicht "seinen Beruf verfehlt" hat (was passieren kann, wenn er sich dagegen sträubt, gelegentlich wie ein "Schulmeister" zu wirken), daß dieser Kritiker imstande sein muß, die literarischen "Arbeiten" in "Verrissen" oder "Hymnen" vor allem nach den zwei Noten "miserabel" oder "glänzend" zu klassifizieren. Und wie nicht anders vom Vetter eines "Schulmeisters" zu erwarten, "mißbilligt" und "schimpft" der Literaturkritiker so besonders "nachdrücklich" und "kräftig", weil er sich "insgeheim nach dem Guten" - in der Literatur natürlich - "sehnt" (manchmal nennt Reich-Ranicki sein "Schimpfen" auch "Negation").
Es gibt eigentlich nur eine Komplikation in Marcel Reich-Ranickis Welt. Das ist die Tatsache, daß er als Kritiker ausgerechnet in Deutschland schreibt, in einem Land, wo die Literaturkritik, behauptet er, "schlecht" ist und sich offenbar permanent auf einem "beschämenden Tiefstand" befindet. Jeder gebildet-demokratische Deutsche würde wie Marcel Reich-Ranicki den tatsächlich schweren Stand der kritischen Gesinnung in Deutschland mit dem sogenannten "historischen Sonderweg" der Nation assoziieren. Das versetzt ihn dann auch in die argumentativ beneidenswerte Lage, Angriffe auf die (Literatur-)Kritik als Angriffe auf Demokratie und Freiheit deuten und verurteilen zu können. Während sich aber Reich-Ranickis Verweis auf die so gern beschworene deutsche Negativ-Tradition kaum widersprechen läßt, fällt andererseits auf, wie wenig Skrupel er hat, historische Detailgenauigkeit bestimmten rhetorischen Effekten zu opfern. Zum Beispiel ist es sicher nicht angemessen, Immanuel Kant, den Autor der drei großen "Kritiken" aus der deutschen Aufklärung, zum Ahnherrn eines allgemein kritischen Geistes und sogar zum Gründungsvater der Literaturkritik zu machen: denn Kants philosophischer Begriff von "Kritik" ist nicht identisch mit der alltagssprachlichen Bedeutung desselben Worts. Keinesfalls trifft auch zu, wie Reich-Ranicki schreibt, daß sich die Germanistik erst nach 1871, also erst im Zeitalter Richard Wagners, den Texten des Mittelalters zugewandt haben soll. Im Gegenteil - es war ebendie Begeisterung für das Mittelalter, welche ein gutes halbes Jahrhundert vorher die institutionelle Geburt der Germanistik motiviert hatte.
Aber all das sind wohl nur Nebensächlichkeiten im Buch eines Autors, der ohnehin - wie seine Vorbilder aus der Aufklärung - einmal festgestellte Wahrheiten nicht der historischen Relativierung ausgesetzt sehen will. So gelingt es Reich-Ranicki, mit einer Fülle von geschickt ausgewählten Stellen aus den Texten berühmter deutscher Literaturkritiker den Eindruck zu erwecken, daß eine geradlinige Tradition von Lessing über Nicolai, August Wilhelm und Friedrich Schlegel, Fontane, Tucholsky, Musil und Hofmannsthal, Curtius, Benn, Sieburg und Barthes (sie alle sind zitiert) - gar nicht umhin kann, in der Gegenwart eben bei Marcel Reich-Ranicki anzukommen. Kritisiert wird allein (und zu Recht) Goethes Unterscheidung zwischen "zerstörender" und "produktiver Kritik", weil sie versucht, literarische Autoren durch Anrufung der Aura von Literatur gegen jegliche kritische Attacken in Schutz zu nehmen.
So robust und so immun gegen historische Veränderung wirken die Grundprinzipien von Reich-Ranickis Literaturkritik, weil sie auf ein fast überdeutlich konturiertes Weltbild gebaut sind. Dieses Weltbild unterscheidet beständig zwischen extremen Gegenpolen und Gegenwerten, zwischen "miserabel" und "glänzend" vor allem, aber auch zwischen "Untertanengesinnung" und "Kritik", zwischen "bitterernst" und "heiter", oder zwischen dem "Geheimnisvollen" und der "Klarheit". Ambivalenzen kommen hier nicht vor, und so ist Reich-Ranickis Leser am Ende kaum verwundert über den erstaunlichen Satz: "Deutlichkeit heißt das große Ziel der Literaturkritik."
Sollte Deutlichkeit in der Literaturkritik nicht eher ein Mittel zum Zweck als "ein großes Ziel" sein, fragt man sich beim zweiten Hinsehen etwas überrascht, ein Mittel zum Zweck der Werbung für gute Bücher etwa oder auch - warum denn nicht? - zur "schulmeisterlichen" Verurteilung "miserabler Arbeiten"? Doch es scheint Marcel Reich-Ranicki Ernst zu sein mit dieser Verabsolutierung der "Deutlichkeit" zum höchsten Wert in seiner Welt. Deshalb rät er - trotz aller enthusiastischen Bezugnahmen auf Friedrich Schlegel - von Ironie und Understatement ab, weil sie "nicht gerade die Deutlichkeit des Urteils zu steigern" scheinen; und deshalb stemmt er sich mächtig gegen die Meinung vieler Kritiker-Kollegen, daß es auf "Rechthaben oder Unrechthaben" eigentlich gar nicht ankomme. Nein, im Gegenteil, schreibt Reich-Ranicki, gerade auf das Rechthaben komme es an - und außerdem liefere das Nachleben der Bücher (gemeint ist ihre Kanonisierung oder Nichtkanonisierung) ein Kriterium zur Bestätigung von falschen und richtigen Urteilen.
Die in jedem Urteil unvermeidlichen Komponenten von "Subjektivität" und "Individualität" aber, aus deren Reflexion die romantische Form der Literaturkritik entstanden war, will Marcel Reich-Ranicki nicht akzeptieren. Eben deshalb gerät ihm seine historische Traditionslinie wohl so verdächtig gerade und eindeutig. Eben deshalb auch verwickelt er sich in paradoxale Formulierungen, wenn er auf die Subjektivität des Urteils zu sprechen kommt: "Hier, in der Relativität und Subjektivität, in der Fragwürdigkeit jeglicher Kunstbeurteilung hat ihre tiefsten Wurzeln jene berühmte Krise: Sie ging der erst durch die Entwicklung der Presse notwendig gewordenen Institutionalisierung der Kritik voran. In diesem Sinn mag die Misere der Kritik nicht etwa eine zeitweilige Erscheinung, sondern eine unvermeidliche Folge sein - ein permanenter Zustand, der sich gleichwohl ändert; und der sich in gewissen Grenzen natürlich auch verändern läßt." Wenn die "Misere" der Literaturkritik aber eine "unvermeidliche Folge" der Urteils-Subjektivität sein soll, wie könnte diese "Krise" dann je nicht permanent sein? Und was sollte man daran "gleichwohl ändern" wollen und können?
Glücklicherweise hält sich Marcel Reich-Ranicki selbst nicht besonders strikt an die massiven Vorgaben seines literaturkritischen Weltbilds. Entgegen allen expliziten Vorbehalten gegen die Relativierung von Werten und gegen die Ironie, erweist er sich ab und an - gekonnter vielleicht als irgendein anderer deutscher Kollege aus der eigenen und der nachfolgenden Kritikergeneration - als ein Meister der Selbstrelativierung und der Selbstironie. Auf der letzten Seite seines Manifests zur Literaturkritik etwa findet man die folgende Beschreibung seiner Reaktion auf die Lektüre von "Verrissen" zu eigenen Büchern: "Ich will nicht verheimlichen, was ich mir während der Lektüre dieser Verrisse in der Regel dachte - daß hier von sachlicher und fundierter Kritik überhaupt nicht die Rede sein könne, daß es sich vielmehr um oberflächliche, ungerechte und bösartige Attacken handle, die meine Absichten gänzlich verkennen und auf perfide Weise entstellen und auch noch unentwegt Zitate aus dem Zusammenhang reißen." Darauf folgt ein wunderbar trockener Satz der entwaffnenden Selbstrelativierung: "Kurz und gut: Ich reagierte ebenso wie jeder andere Autor."
Ähnlich wie mit der Ironie geht es Reich-Ranicki auch mit der Subjektivität, gegen die er seine Welt der Literaturkritik doch eigentlich schützen will. Wahrscheinlich hat kein anderer Kritiker in der jüngeren Geschichte der deutschen Literatur mit so unverstellter Subjektivität verurteilt und gelobt wie er - und man kann diesen Mut wohl nur mit der Vermutung erklären, daß Reich-Ranicki bei allem Streben nach Deutlichkeit und Objektivität am Ende gegenüber der eigenen Subjektivität blind ist; so blind wie seine Vorbilder aus dem achtzehnten Jahrhundert, bevor sie begannen, das Prinzip der Kritik auf die Aufklärung selbst anzuwenden.
Jene Kollegen und - vor allem - jene Literaturwissenschaftler aber, die Reich-Ranicki deshalb naiv genannt haben, sollten vielleicht zuerst nach dem blinden Fleck in ihrer eigenen Sicht des literarischen Lebens suchen. Denn ist es etwa kein Verdienst, daß Marcel Reich-Ranicki durch seine Schimpf- und Lobestiraden - in gedruckter Form und am Bildschirm - über die Jahre mehr Leser der deutschen Sprache für das Reden über Literatur und für die literarischen Texte begeistert hat als irgendein anderer Literaturfreund im Land? Wäre ein solcher Erfolg je einem Kritiker möglich gewesen, der sich durch alle intellektuell obligatorischen Schleifen der Selbstreflexion gezwängt hätte? Wie könnte also der ehemalige Buchklub der Talkshow-Mutter Oprah Winfrey, die bis vor wenigen Monaten die amerikanische Gegenwartsliteratur unserer Gegenwart in Millionen von Exemplaren an die Fernsehgemeinde vertrieben hat, wie könnte Oprah Winfreys Buchklub etwas anderes gewesen sein als die amerikanische Antwort auf unseren Marcel Reich-Ranicki?
Marcel Reich-Ranicki: "Über Literaturkritik". Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart und München 2002. 80 S., geb., 9,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Nichts geringeres unternimmt der nach Stanford ausgewanderte Literaturwissenschaftler Hans-Ulrich Gumbrecht, als Marcel Reich-Ranicki in dessen Heimatblatt - anlässlich der unveränderten Wiederveröffentlichung dieses Bandes nach 32 Jahren - zu unterstellen, dass sein literaturkritisches Reflexionsniveau nie über das 18. Jahrhundert hinausgelangt ist. Anders, so Gumbrecht - im Ton immer freundlich -, sei der Glaube Reich-Ranickis an die Objektivität des literarischen Urteils kaum zu erklären. Zugrunde liegt, meint Gumbrecht, "ein fast überdeutlich konturiertes Weltbild" (nun: er hat nicht schlicht gesagt), für "Ambivalenzen" habe Reich-Ranicki nichts übrig. Immerhin gibt es auch Komplimente: gegen die eigenen Überzeugungen beweise der Kritiker "ab und an" doch Sinn für "Selbstrelativierung" und "Selbstironie". Und ein Argument zählt auch für Gumbrecht: die Bücher hat Reich-Ranicki so immer an die Leser und Leserinnen gebracht. Er sei - Achtung: vergiftetes Lob - darin nicht weniger als das Vorbild für die (einstige) große Auflagenmacherin Amerikas, Oprah Winfrey.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
„Er lehrt uns, was Kultur bedeutet.“