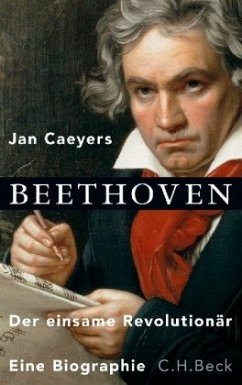Die Kompositionen Ludwig van Beethovens gehören zum unvergänglichen Erbe der Musikgeschichte. Doch wer war der Schöpfer dieser Musik, der uns mit unsterblichen Werken wie dem Fidelio, der Missa solemnis, seinen Klaviersonaten, seinen Streichquartetten und der Neunten Sinfonie beschenkt hat? Jan Caeyers entwirft in dieser großen Biographie ein faszinierend lebendiges Portrait des Künstlers.
Der Autor stellt uns Beethoven als eine Ausnahmeerscheinung der Musikwelt vor, ohne musikhistorisches oder gar musiktechnisches Wissen vorauszusetzen. Er erhellt in dieser meisterhaft erzählten Biographie den menschlichen wie den künstlerischen Werdegang seines Protagonisten, indem er die Entstehungsgeschichte seiner Werke mit Beethovens persönlicher Entwicklung - die zwischen Generosität und Kleinlichkeit, zwischen Enthusiasmus und Verzweiflung oszilliert - verwebt. Dabei erschließen sich zugleich die Arbeitsbedingungen, die wirtschaftlichen Nöte sowie das musikalische und gesellschaftliche Leben in der Provinz und in der Metropole Wien an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert. Auch beschreibt Caeyers die Zwänge dieser Epoche, denen sich selbst ein Genie wie Beethoven nicht entziehen konnte und die es verhindert haben, dass er die einzige große Liebe seines Lebens zu der "unsterblichen Geliebten" hat leben können.
Eine wunderbare Biographie für Beethoven-Kenner, für Beethoven-Freunde und für all jene, die es werden möchten.
Der Autor stellt uns Beethoven als eine Ausnahmeerscheinung der Musikwelt vor, ohne musikhistorisches oder gar musiktechnisches Wissen vorauszusetzen. Er erhellt in dieser meisterhaft erzählten Biographie den menschlichen wie den künstlerischen Werdegang seines Protagonisten, indem er die Entstehungsgeschichte seiner Werke mit Beethovens persönlicher Entwicklung - die zwischen Generosität und Kleinlichkeit, zwischen Enthusiasmus und Verzweiflung oszilliert - verwebt. Dabei erschließen sich zugleich die Arbeitsbedingungen, die wirtschaftlichen Nöte sowie das musikalische und gesellschaftliche Leben in der Provinz und in der Metropole Wien an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert. Auch beschreibt Caeyers die Zwänge dieser Epoche, denen sich selbst ein Genie wie Beethoven nicht entziehen konnte und die es verhindert haben, dass er die einzige große Liebe seines Lebens zu der "unsterblichen Geliebten" hat leben können.
Eine wunderbare Biographie für Beethoven-Kenner, für Beethoven-Freunde und für all jene, die es werden möchten.

Die Beethoven-Biographie von Jan Caeyers lässt nichts aus, erklärt viel und hält sich raus: Vermessung eines epochalen Klangraums, gebaut von einem Ungewöhnlichen.
Von Gerhard Stadelmaier
Man stelle sich vor: Der berühmte Theaterkritiker hat genug vom Theater. Und will nur noch Musik: "Spielt künftig das Beste, was wir haben. Spielt, was an unsren stolzesten Stolz erinnert. Und wenn ihr keine Stücke wißt, so nehmt euch fünfzig Musiker. Und sprecht kein Wort. Und spielt an jedem Abend Beethoven. Beethoven. Beethoven." Fordert Alfred Kerr am 22. September 1914 im Berliner "Tag". Der Erste Weltkrieg war erst ein paar Wochen alt.
Abgesehen davon, dass Kerr dann doch bei seinem dramatischen Leisten blieb - dass einer martialischen Schicksalslage nur noch mit gewaltigen Tönen, nicht mehr mit windigen Dialogen beizukommen sei, lag auf der Zeitgeisthand: Wir kennen keine Parteien mehr, wir kennen nur noch Beethoven! Schon Bismarck soll bekannt haben, immer wenn er die "Appassionata", Beethovens Klaviersonate f-Moll (op. 57), höre, werde er zu einem "tapfereren Menschen". Obwohl (oder weil?) die "Appassionata" ein einziger fahler, atemlos rasender Schmerzenswutschrei ist, versehen nur mit einer Andante-con-moto-Scheintröstung am Variationenabgrund.
Aber auch auf der nüchterneren professionellen Ebene geht Beethoven offenbar über alles Normale. Leonard Bernstein schrieb 1980, als er seine Wiener Konzertmitschnitte der neun Sinfonien auf Schallplatten vorlegte, schlicht vom "größten aller Komponisten", der "einem Satelliten gleich" in den "unendlichen Kosmos" gesandt sei. Auch ein Karl Böhm ließ, als er, skandalumwittert, zu Beginn seiner kurzen Direktorenzeit ans Pult der Wiener Staatsoper trat, lieber den Buh- und Pfeiforkan im Parkett über sich ergehen, als dass er mit dem Einsatz zur Ouvertüre von Beethovens "Fidelio" den inszenierten Aufruhr hätte zum Schweigen bringen mögen. Diese Musik sei ihm "zu heilig" dafür gewesen.
Und der nüchterne Orchestererzieher Hermann Scherchen, der unerbittlich Beethovens ungeheuer rasche Metronomangaben bei den Sinfonien einhielt und auch sonst keinerlei Pathos-Spaß verstand, berichtet, wie er als "Knabe von neun Jahren" Beethovens Violinromanze in F-Dur von seinem Schulorchester gespielt hörte, völlig erschüttert war, sich die Noten vom Solisten auslieh, diese über Nacht abschrieb und am folgenden Tag "mit verweinten Augen, aus voller Kehle singend, ganz außer mir" durch die Straßen von Potsdam taumelte.
Beethoven wirkt. Und überwältigt. Wie kein Zweiter (außer ihm vielleicht nur noch Wagner). Und er fordert offenbar: ein Bekenntnis. Weil er in ein Leben eingreift. Mindestens aber: eine Haltung. Umso überraschender, dass jetzt auf 832 Seiten Beethovens Leben, Leiden, Lieben und Wirken biographisch vermessen wird - ohne dass der Autor irgendeine Spur von Wirkung zeigte. Kein Bekenntnis. Er liegt vor dem Übermächtigen, die sinfonische Musikwelt seit seinem Auftreten Beherrschenden und mit dem Schlusschor der Neunten nationenhymnenweit Überspannenden weder auf dem Bauch, noch stürzt er ihn vom Sockel. Er geht einfach um ihn herum und beguckt ihn.
Der letzte Satz des Buches "Es ist Viertel vor sechs" bezeichnet die Sterbestunde Beethovens am 26. März 1827 in Wien. Danach kommt nichts mehr. Die Biographie beginnt mit einem "Prolog", in dem der Autor in einer Art historischer Reportage Beethovens Leichenzug vergegenwärtigt (mit Zehntausenden Teilnehmern, Grillparzers Grabrede und den Komponistenkollegen, die den Sarg tragen) - und endet mit Beethovens letztem Atemzug. So schließt sich ein Kreis. Und der Autor fungiert sozusagen als Beethovens Lebenslaufbursche, der den Lebens- und Schaffenskreis des Komponisten in kleinen, sorgfältigen, manchmal auch etwas umständlichen Schritten ausmisst, wenn er sich häufig auf ein "Dazu später mehr" zurückzieht, als habe er alle Zeit der Welt - und alle Seiten seines Verlags.
Gerade dadurch aber, dass er sich heraushält, die Monumentalquadratur des Ludwig-Kreises erst gar nicht versucht, entwickelt "Beethoven. Der einsame Revolutionär" eine wundersame Wirkung der attraktiven, distanziert neugierigen Nüchternheit. Jan Caeyers, holländischer Dirigent und Musikwissenschaftler, benimmt sich als Biograph wie ein interessierter Beobachter, der geduldig zuschaut und nachzeichnet, wie eine seltsame Figur, "ein ungewöhnliches Kind", sich wie in einem groß angelegten biographisch-fotografischem Säurebad entwickelt. Kein Held, kein Titan, kein Monument. Sondern ein hochinteressanter musikalischer Aufsteiger. Keine Solo-Erscheinung wie Mozart, die gleich "da" war. Sondern das Produkt eines Betriebes, das innerhalb von "Netzwerken", einem der Lieblingswörter des Autors, sich bewegt. Wie überhaupt Caeyers flott-unbekümmert den gerade gängigen modisch-methodischen Jargon den alten Figuren als Pointenkappe aufsetzt. So kennzeichnet er das Palais des Fürsten Lobkowitz, der in Wien und auf seinen vielen Landsitzen teure Orchester und Probenräume samt fortschrittlichen Musikbibliotheken unterhielt, als "Center of excellence" (fehlte nur noch, dass dort "Credit Points" vergeben wurden). Und Carl Czerny, Schüler von Beethoven, wird als "lebende Jukebox" tituliert, die im Hause des Fürsten Lichnowsky auf Opuszahl-Zuruf des Hausherrn das gewünschte Werk aus dem Interpretenärmel schüttelt. Oder wenn Beethoven als "Composer in residence" des Theaters an der Wien bezeichnet wird, als seien die Arbeit an der Oper "Leonore" und deren qualvolle Erweiterung zum späteren "Fidelio" eine angelsächsische Frühgeburt der Salzburger Festspiele gewesen. Und wenn er erörtert, ob Antonie von Brentano als eine der "Unsterbliche Geliebte"Kandidatinnen in die engere Wahl komme, dann folgert Caeyers, die schöne, aber verheiratete Dame, deren Mann dauernd um sie war, habe wohl kaum mit Beethoven "ein Aufhupferl in der Damentoilette" hinlegen können.
Wenn Caeyers aber gleichzeitig das Lebensdrama der jungen Witwe Josephine von Brunsvick entwirft, die, einst Klavierschülerin des sofort entflammten Meisters, sich zweimal unglücklich verehelichte, doch in einer gewissen Nacht in Karlsbad wohl mit Beethoven schlief, das daraus entstandene Kind aber ihrem Ex, mit dem sie gerade in Scheidungsverhandlungen stand, unterschob, dann wird der Biograph trotz aller illustrierten Bettvorlegerei zum nüchternen Aktenkundler, der den berühmten, nie abgeschickten Brief "An die unsterbliche Geliebte" (es muss Josephine gewesen sein!) vom 3. Juli 1812 liest wie eine Anleitung zum überglücksschwänglichen rasenden Unglücklichsein. Und der voyeuristisch so glanzvoll wie dezent unterhaltene Leser nimmt es gerne hin, wenn dann dem lyrisch-poetisch punktierten Beginn der As-Dur Sonate op. 110 ein sehnsuchtsstammelndes "Joooo-se-phiii-ne" rhythmisch unterlegt wird.
Die drei Kapitel, die er der "unsterblich Geliebten" widmet (samt kritischer Kandidatinnensichtung), sind nur einer der zentralen Knüpfungsknoten im Beziehungsnetzwerk, in das Cayers seinen Beethoven einspinnt. Er fängt naturgemäß mit den familiären Bonner Katastrophenmaschen an, in denen das vom schwachen Vater zum pianistischen Wunderkind dressierte junge Improvisationsgenie in ein Geflecht verwoben ist aus Fürstendienst (Bratscher im Hoforchester) und Adelsfreunden, die ihn nach Wien weiterempfehlen, wo Beethoven auch wieder ein Leben lang in einem Netz von adeligen, später auch bürgerlichen Unterstützern gehalten, alimentiert, benutzt wird. Um Leibrenten kämpft, mit Verlegern taktiert, Kritikern droht ("sie verstehen's nicht"), Honorare in die Höhe treibt und wieder und immer wieder auf die Adelsbagage der Lichnowskys, Lobkowitz, Kinskys, aufs Kaiserhaus, vertreten durch seinen Klavier- und Kompositionsschüler Erzherzog Rudolph, zurückkommt. Dies alles hat Teil am schönsten Skandal, den ein so gewaltiges Buch-Unternehmen machen kann: den Skandal der Lesbarkeit.
Sorgsam wägend und zum Teil elegant bis glänzend formulierend, trennt Caeyers die Spreu vom Weizen, die Lüge von der Legende, die Anekdote von den Wahrscheinlichkeiten, analysiert kühl und schildert schonungslos den Krankheitsverlauf Beethovens (Fleckfiebertyphus, Ertaubung, Leberschäden, Reizdarm) und zieht daraus keine anderen Schlüsse, als sie Beethovens dokumentiertes Verhalten nahelegen. Kein Überschwappen ins spekulativ Psychologische. Die qualvolle Episode an Beethovens Lebensende, als er um die Vormundschaft für seinen Neffen Karl mit seiner Schwägerin ("Hurenweib") erbittert kämpfte und den Jungen panisch eifersüchtig überwachte, bekommt keinen Stich ins naheliegend verkrampft Homoerotische. Sondern: ins nobel Menschenmusikalische. Beethoven habe, so Caeyers, eben geglaubt, einen Menschen wie Karl ebenso formen zu können wie ein musikalisches Thema. Und sei daran gescheitert.
Obwohl Caeyers nichts Neues liefert und das Alte nur sorgfältig neu erzählt und in fünf große Teile wie in fünf großen, schwungvoll übertitelten Sinfoniesätzen (vom "Künstler als jungem Mann" über die "Zeit der Gärung", "Der Herrscher", "Masse und Macht" bis hin zum "einsamen Weg") gliedert, wird sein "Beethoven" zum vielstimmigen Lesegenuss. Auch wenn man lange nach dem "Einsamen Revolutionär", den der Untertitel verspricht, suchen muss. Zumal der "Staatskünstler Beethoven" nicht verschwiegen wird, der unsäglich banales Pomp-and-Circumstance-Tralala ("Wellingtons Sieg") zum alliierten Triumph über Napoleon eben auch schreibt. Aber wenn man den Revolutionär dann findet, leuchtet er umso mehr ein. Caeyers findet ihn im Ingenieur Beethoven. Im Tonbaumeister. Im Klangwelten-Architekten. Der in seinen Skizzenbücher oft auf Hunderten von Seiten erst die großen Strukturen und Räume der Komposition sucht und peinlich genau festlegt und den Ablauf bestimmt, ehe er gleichsam als Träger und Balken und Streben die musikalischen Themen einzieht. Dabei hört Caeyers' Beethoven wegen seiner Ertaubung nicht mehr auf die Welt, die Kollegen und die Tradition, sondern auf das, was im Wortsinn "unerhört" in ihm ist. Frei, aber einsam.
Caeyers beschreibt in den besten Passagen seines Buches die großen Sinfonien, Klaviersonaten, Messen, Lieder und Quartette ganz wunderbar unter diesem Signum des "Unerhörten". Und sein Beethoven wird in aller Nüchternheit am Ende zum gewaltigen Zukunftsmusiker, der nun wirklich wie ein Satellit in einen kommenden Unerhörtheitskosmos hineinzuzischen scheint. Und hier wird die Biographie eines Musikers, geschrieben von einem Musiker, selber zu Musik. Sie fängt buchstäblich an zu klingen. Und man hört ihr - so belehrt wie unterhalten - gerne und bewegt zu.
Jan Caeyers: "Beethoven. Der einsame Revolutionär". Eine Biographie.
Aus dem Niederländischen von Andreas Ecke. Verlag C.H.Beck, München 2012. 832 S., geb., 29,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
Jan Caeyers' Beethoven-Biografie wurde bisher sehr unterschiedlich aufgenommen, Wolfram Goertz stellt sich mit seiner besprechung auf die Seite der Enthusiasten. Als Musikwissenschaftler und Dirigent wisse Caeyers, worüber er schreibt, versichert der Rezensent, der sich dank "knapper und treffender" Werkbeschreibungen von aufwändigen Partituranalysen verschont sah. Denn viel interessanter erscheint Goertz das "Psychogramm eines verwirrenden Künstlers", das Caeyers zeichnet, eines Musikers, der um sein Genie durchaus weiß, aber auch immer wieder um seine Anerkennung kämpfen muss. Mitunter musste er die Karten für seine Konzerte auch selbst verkaufen und bei den zuständigen Respektabilitäten antichambrieren. Dem Rezensenten verschafft Caeyers damit ein sehr rundes Bild eines "mühsamen, labilen, aufreibenden, mitunter krawalligen Lebens". Und fürs Protokoll: Als Beethovens berühmte unbekannte "unsterbliche Geliebte", notiert Goertz, identifiziert Caeyers Josephine Brunsvik.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Aus der Kammerdienerperspektive erzählt: Die neue Beethoven-Biographie des flämischen Autors Jan Caeyers
Biographen sind in der Regel keine Theoretiker. Es gilt so viele Dokumente zu wälzen, sich in so viele Sachgebiete einzuarbeiten, dass eine leitende Fragestellung eigentlich nur stören kann. Fleiß und Neugier sind die Tugenden, die das Metier verlangt. Jan Caeyers hat für seine Beethoven-Biographie keine eigenen Archivfunde vorzuweisen, und Passagen wie die zur Geschichte Bonns und der Rolle der Habsburger in ihr lesen sich wie reine Fleißarbeit. Bei Themen jedoch wie der Geschichte des Klavierbaus oder der Frage, wer die Unsterbliche Geliebte war, teilt sich dem Leser auch die Neugier des Autors mit, sodass er gerne belehrt wird.
Andererseits möchte man doch irgendeine neue Perspektive auf den Gegenstand vermittelt bekommen, irgendeinen Grund hören, warum er die ausführliche Beschäftigung lohnt. Man überliest es leicht im Vorwort, und auch später wird es nicht als These formuliert, aber es gibt diese Perspektive. Ihn habe der schwindelerregende Ruhm beeindruckt, den Beethoven innerhalb weniger Jahrzehnte erreichen konnte, und er wollte die unwahrscheinliche Geschichte erzählen, wie jemand in gewissem Maß durch Zufälle, in der Hauptsache aber durch Marketing und das geschickte Nutzen von Netzwerken dazu kommt, das Musikleben eines ganzen Jahrhunderts zu prägen. Beethoven, „der einsame Revolutionär“ – das meint sicher auch die Musik, warum sollte sie dem Autor nicht gefallen? Vor allem meint es die neuartigen Methoden der Karrieregestaltung. Genialität alleine reiche schließlich nicht aus. Und ist nicht, genau betrachtet, vieles, was genial scheint, nur geschickte Selbstvermarktung?
Glück braucht man bei der Geburt. Beethovens Mutter war zwar depressiv, obwohl ihm das einige gute Einfälle beschert haben mag und im Übrigen seiner Verheiratung entgegenstand, die vielleicht seine Kreativität ausgesaugt hätte. Beethovens Vater dagegen, durchaus nicht so arm und erfolglos, wie es gemeinhin dargestellt wird, sorgte für eine Ausbildung zum Wunderkind. Und Beethoven ist ein gelehriger Schüler. Er beschäftigt sich etwa mit Klavier-Variationen, weil die Sonate schon so entwickelt gewesen sei, dass es für einen ehrgeizigen jungen Komponisten kaum ratsam war, sich gerade in dieser Gattung zu profilieren. Glück braucht man auch bei den Mentoren. Beethoven kann den Zufall der habsburgischen Herrschaft in Bonn als Entree-Billett zu Wiener Adelskreisen nutzen.
Die Adligen, das sind die Arrivierten. Ihnen gilt der ganze Hass des Autors. Sie „verbringen den Tag mit Aktivitäten, die ihre Bedeutung durch die Konventionen ihrer Kaste erhalten“: religiöse Feierlichkeiten, Klatsch und Flirt, Karten Spielen, Essen, sich neu Einkleiden, im Sommer zur Wellness-Kur nach Karlsbad. Vor allem arbeiten sie nicht. Das ist als Kritik ganz unberaten, schließlich waren Adlige wesentlich an der Modernisierung von Staat, Landwirtschaft und an der Industrialisierung zumal Böhmens beteiligt. Die Attacke auf die „schwere Form von Moralschwund“ steht auch quer dazu, dass der Autor sich wenig später über die kleinbürgerlichen Ideale der im „Fidelio“ gefeierten Amour conjugal mokiert. Im Übrigen wird breit gezeigt, dass die Adligen nur machen, was alle machen – sie vermarkten sich selber. Die Mütter suchen nach guten Heiratschancen, die Männer nach Distinktionsgewinn.
Und da kann Beethoven ansetzen. Er war bei Karl von Lichnowsky Schützling eines Fürsten, der die Elite der Kulturkonsumenten repräsentierte. Während die Neureichen, die sogenannten Liebhaber, eingängigere Musik bevorzugten, stellte der alte Adel, die Kenner, gerne Aufgeschlossenheit für das Komplexe und Ungewöhnliche heraus. Das war Beethovens Zielgruppe. Er wusste, wo er Überraschendes wie etwa unerwartete Stimmungswechsel einzubauen und wann er Elemente der niederen Musikkultur denen der höheren gegenüberzustellen hatte – was Lichnowsky und die Seinen sehr entzückt haben muss. Beethovens Extravaganzen waren „die richtige Dosis gut durchdachter Unberechenbarkeit“.
Berechenbar geht es bei Jan Caeyers weiter, „Schritt für Schritt, gezielt mit gutem Gespür für die richtige Dramaturgie“. Um die nächste Sprosse der Karriereleiter zu erklimmen, war es notwendig eine Konzertreise ins Ausland zu unternehmen. Mit dem kunstliebenden Generalmajor Franz Josef Maximilian von Lobkowitz wird der „Musik-Pate“, der Toplobbyist gewonnen, was einen Karrieresprung bedeutet. Ein neureicher Industrieller eröffnet breitere Publikumskreise, für die auch der neue kompaktere Streichquartettklang gedacht ist.
Pech hatte Beethoven allerdings, was den Gehörverlust angeht. Aber er reagiert darauf, wie es kein heutiger Mentaltrainer besser empfehlen könnte. Das Heiligenstädter Testament ist ein rhetorisches Meisterwerk, um sich selbst von der Bedeutung seiner künstlerischen Sendung zu überzeugen. Die Eroica krönt als Napoleon-Symphonie eine Propagandaoffensive, um sich aus dem kriegsbedingt verarmenden Wien wegzubewerben. Schlau nutzte Beethoven auch die Möglichkeiten des Verlagssystems. Beim Wiener Kongress wittert er die Gelegenheit, auf sich aufmerksam zu machen und möglicherweise das eine oder andere Angebot aus dem Ausland zu ergattern. Und wo das nicht mehr hilft, verleiht er durch Entsagung als höherer spiritueller Kategorie seiner Einsamkeit etwas Positives.
Sogar das Spätwerk passt ins Schema. Der Hochadel hatte Beethoven eine Rente ausgesetzt, natürlich nicht wegen der Kunst, sondern als Ausdruck des erwachenden österreichischen Nationalismus. Um diese hohen Erwartungen erfüllen zu können, begann er wie ein Besessener die Werke seiner Vorgänger zu studieren, insbesondere den Stile antico, das Bollwerk des Konservatismus und der Orthodoxie.
Während er sich zuvor am Klang der französischen Revolutionsmusik orientiert hatte – das ist übrigens ein guter Hinweis, dem Caeyers leider nicht nachgeht –, setzte er jetzt einen Schlusspunkt hinter den heroischen Stil und wandte sich dem Kontrapunkt und einer eher verhaltenen, aber wahrhaftigen Expressivität zu: Authentizität als sublimste – und spezifisch deutsche – Form der Selbstdarstellung.
Der Autor würde sicher beschwichtigen, es sei doch gar nicht so gemeint. Aber das eben macht die Sache unangenehm. Mephisto hat seinen Platz in Gottes Schöpfung, es ist richtig, auf die ökonomische Rückseite der Kunst hinzuweisen. Hier aber rückt alles in eine Kammerdienerperspektive. Beethoven ist nicht von Schiller begeistert, sondern Schiller war damals en vogue. War Goethe nicht in Wahrheit verstimmt, dass Beethoven Kontakte hatte, von denen er nur träumen konnte? Flotte Wendungen wie Medienhype, Marketing-Mix, Imagekampagne, Hitliste, High-Society-Geselligkeit, Hautevolee-Geselligkeit beschwören eine Ironiegemeinschaft mit Lesern, die wissen, wie es in der Welt schon immer zugegangen ist. Dumm, wer nicht mitmacht.
Andererseits möchte man etwas Besseres sein. Und so kritisiert man aufgrund von Werten, deren Wertlosigkeit man belächelt. Goethe wird als 63-jähriger Frauenheld bezeichnet, über den in Karlsbad gemunkelt wird. Von wem? Von den damaligen Paparazzi, die über jeden Schritt der VIPs berichten? Und haben die dann recht? Im Namen der kleinbürgerlichen Ideale des „Fidelio“? Beethovens Extravaganzen dienen dem Hochadel zur Distinktion, während die Biedermeier sich wohlig einspinnen in den Kokon leichter, gewohnter, gewiss nicht beunruhigender Kunst. Ja, wie soll er denn komponieren?
Der Autor ist flämischer Musikwissenschaftler, durch eine allerdings in der Fachwelt unbeachtete Arbeit über Rameaus Harmonielehre ausgewiesen. Zu Beethovens Kompositionen gibt er zwei Interpretamente. Beethoven habe in Tonartenzyklen komponiert, und Beethoven habe die Sätze durch subthematische Zusammenhänge verbunden. Beides ist eher unwesentlich und gewiss nicht typisch. Vom Ideengehalt liest man nur, dass er da sei. „Man muss sich viel Mühe geben und sich jahrelang mit Beethovens späten Werken auseinandersetzen, bis man das Wesentliche daran erfasst. Aber gilt das nicht auch für den Faust?“ Warum muss man? Und was ist das Wesentliche? Was könnte es überhaupt sein in einer Welt, in der alle nach Karriere streben? Immerhin, über die wesentlichen Ereignisse von Beethovens Leben und deren historischen Zusammenhang lernt man in diesem Buch nichts Falsches.
GUSTAV FALKE
JAN CAEYERS: Beethoven. Der einsame Revolutionär. Eine Biographie. Aus dem Niederländischen von Andreas Ecke. Verlag C. H. Beck, München 2012. 832 Seiten, 30,80Euro.
Die Adligen, das sind die
Arrivierten. Ihnen gilt der ganze
Hass dieses Biographen
Vom Ideengehalt in der Musik
Beethovens liest man in
diesem Buch nur, dass er da sei
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de
"Äußerst kurzweilig und kenntnisreich. Der Autor zeichnet ein lebendiges Charakterbild des großen Musikers in einer Zeit des Übergangs."
Handelsblatt, Simone Wermelskirchen
"Es sind diese klugen Erkenntnisse, die das Buch zu weit mehr als einer Biographie machen. Caeyers sieht Zusammenhänge zwischen Leben und Schaffen und weiß, wann er schweigen muß."
Der Opernfreund.de, Andreas Ströbl
"Sorgsam wägend und elegant bis glänzend formulierend, trennt Caeyers die Spreu vom Weizen, die Lüge von der Legende, die Anekdote von den Wahrscheinlichkeiten, analysiert kühl und schildert schonungslos."
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Gerhard Stadelmaier
"Hier wird die Biographie eines Musikers, geschrieben von einem Musiker, selber zu Musik. Sie fängt buchstäblich an zu klingen."
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Gerhard Stadelmaier
"Heraus ragt die Biografie von Jan Caeyers, die schon den Charakter eines Standardwerks hat."
Die Presse, Nadia Rapp-Wimberger
"Jan Caeyers ist es gelungen, eine leichtfüßige Biografie zu schreiben, die mit Liebe zum Detail und feinem Sinn für Humor glänzt."
arte Magazin Buchtipp, Lydia Evers
"Eine fundierte, leicht lesbare Biografie."
NZZ am Sonntag, Manfred Papst
"Caeyers versteht es, über Musik zu schreiben, ohne in den technischen Jargon musikwissenschaftlicher Analyse zu fallen."
Deutschlandradio Kultur, Holger Noltze
"Alles über den Meister und die Bedingungen seines nicht einfachen Lebens."
Frankfurter Neue Presse
Handelsblatt, Simone Wermelskirchen
"Es sind diese klugen Erkenntnisse, die das Buch zu weit mehr als einer Biographie machen. Caeyers sieht Zusammenhänge zwischen Leben und Schaffen und weiß, wann er schweigen muß."
Der Opernfreund.de, Andreas Ströbl
"Sorgsam wägend und elegant bis glänzend formulierend, trennt Caeyers die Spreu vom Weizen, die Lüge von der Legende, die Anekdote von den Wahrscheinlichkeiten, analysiert kühl und schildert schonungslos."
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Gerhard Stadelmaier
"Hier wird die Biographie eines Musikers, geschrieben von einem Musiker, selber zu Musik. Sie fängt buchstäblich an zu klingen."
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Gerhard Stadelmaier
"Heraus ragt die Biografie von Jan Caeyers, die schon den Charakter eines Standardwerks hat."
Die Presse, Nadia Rapp-Wimberger
"Jan Caeyers ist es gelungen, eine leichtfüßige Biografie zu schreiben, die mit Liebe zum Detail und feinem Sinn für Humor glänzt."
arte Magazin Buchtipp, Lydia Evers
"Eine fundierte, leicht lesbare Biografie."
NZZ am Sonntag, Manfred Papst
"Caeyers versteht es, über Musik zu schreiben, ohne in den technischen Jargon musikwissenschaftlicher Analyse zu fallen."
Deutschlandradio Kultur, Holger Noltze
"Alles über den Meister und die Bedingungen seines nicht einfachen Lebens."
Frankfurter Neue Presse