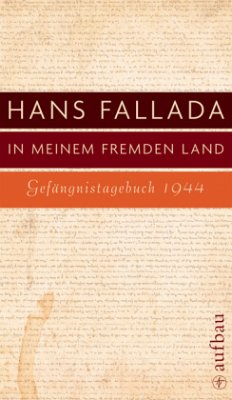'Ich habe das Leben wie alle gelebt, das Leben der kleinen Leute, der Masse.'
Im Herbst 1944 resümiert Hans Fallada in einer Gefängniszelle sein Leben in der NS-Diktatur, die Zeit der inneren Emigration. Unter den Bedingungen der Haft, in ständiger Angst vor Entdeckung schreibt er sich vom Alpdruck der Nazizeit frei. Seine freimütigen, bisweilen provokanten Erinnerungen galten lange Jahre als verschollen. Mit dieser Edition werden sie erstmals veröffentlicht.
Bekenntnishaftes lag dem Erzähler Fallada fern, doch in der seelischen Bedrängnis des Jahres 1944 wird die Selbstreflexion zur Überlebensstrategie. Im 'Todeshause' bringt er seine politische Abrechnung zu Papier. 'Ich weiß, daß ich wahnsinnig bin. Ich gefährde nicht nur mein Leben, ich gefährde [.] das Leben vieler Menschen, von denen ich berichte', notiert der Getriebene. Er schreibt von Bespitzelung und Denunziation, von der Gefährdung seines Lebensquells, der literarischen Arbeit, und vom Schicksal vieler Freunde und Zeitgenossen wie Ernst Rowohlt und Emil Jannings. Zur Tarnung und um Papier zu sparen, verwendet er Kürzel. Seine Notate, den Blicken der Wärter ständig ausgesetzt, werden zu einer Art 'Geheimschrift'. Am Ende gelingt es ihm, das Manuskript aus dem Gefängnis zu schmuggeln.
'... noch heute, nach elf Jahren habe ich mich nicht an diese braunen Uniformen und an die Bulldoggenschnauzen ihrer Träger gewöhnen können. ... Sie zerstören jeden Menschen - und mit den Puppen, die dann zurückbleiben, haben sie leichtes Spiel.'
Im Herbst 1944 resümiert Hans Fallada in einer Gefängniszelle sein Leben in der NS-Diktatur, die Zeit der inneren Emigration. Unter den Bedingungen der Haft, in ständiger Angst vor Entdeckung schreibt er sich vom Alpdruck der Nazizeit frei. Seine freimütigen, bisweilen provokanten Erinnerungen galten lange Jahre als verschollen. Mit dieser Edition werden sie erstmals veröffentlicht.
Bekenntnishaftes lag dem Erzähler Fallada fern, doch in der seelischen Bedrängnis des Jahres 1944 wird die Selbstreflexion zur Überlebensstrategie. Im 'Todeshause' bringt er seine politische Abrechnung zu Papier. 'Ich weiß, daß ich wahnsinnig bin. Ich gefährde nicht nur mein Leben, ich gefährde [.] das Leben vieler Menschen, von denen ich berichte', notiert der Getriebene. Er schreibt von Bespitzelung und Denunziation, von der Gefährdung seines Lebensquells, der literarischen Arbeit, und vom Schicksal vieler Freunde und Zeitgenossen wie Ernst Rowohlt und Emil Jannings. Zur Tarnung und um Papier zu sparen, verwendet er Kürzel. Seine Notate, den Blicken der Wärter ständig ausgesetzt, werden zu einer Art 'Geheimschrift'. Am Ende gelingt es ihm, das Manuskript aus dem Gefängnis zu schmuggeln.
'... noch heute, nach elf Jahren habe ich mich nicht an diese braunen Uniformen und an die Bulldoggenschnauzen ihrer Träger gewöhnen können. ... Sie zerstören jeden Menschen - und mit den Puppen, die dann zurückbleiben, haben sie leichtes Spiel.'

Unsicherer Kantonist: Hans Falladas Gefängnistagebuch des Jahres 1944
Die paradoxe Biographie dieses Schriftstellers gleicht einem Kolportageroman. Rudolf Ditzen, der sich als Schriftsteller Hans Fallada nannte, Sohn eines Reichsgerichtsrats, psychisch labil, durchwanderte nicht nur die Sanatorien, sondern nach wiederholten Unterschlagungen auch die Gefängnisse. Von drei Süchten war er besessen, von der Alkohol-, der Rauschgift- und der Schreibsucht. Immer wieder ins gesellschaftliche Zwielicht zurücksinkend, bewahrte er sich doch einen klaren Blick für die Realität der Gesellschaft. So konnte er zum erzählerischen Sachwalter des "kleinen Mannes" und zum Chronisten der zwanziger Jahre, der Weimarer Republik werden. Aus der Vielzahl seiner Romane ragen vor allem der Welterfolg "Kleiner Mann - was nun?" von 1932, "Wer einmal aus dem Blechnapf frisst" von 1934, und, drei Jahre später, "Wolf unter Wölfen" hervor.
Zur verkappten Selbstanalyse eines völlig zerrütteten und desolaten Ichs wurde der 1944 in der gefängnishaften Landesanstalt Strelitz entstandene Roman "Der Trinker": ein bestürzendes Psychogramm vom Willensverlust eines Süchtigen. In dieses Romanmanuskript hinein versteckte Fallada neben einigen Erzählungen mit kaum lesbarer Kleinschrift und raffiniert getarnter Anordnung der Zeilen sein "Gefängnistagebuch 1944". Es wurde entziffert von Jenny Williams und Sabine Lange, deren Nachwort und Kommentare der Leser nicht überschlagen sollte, und liegt nun unter dem Titel "In meinem fremden Land" im Druck vor.
Es ist nicht das erste hinter geschlossenen Mauern entstandene Tagebuch Falladas. Schon 1924 gelang es ihm während einer mehrmonatigen Haft im Gefängnis von Greifswald, seine Beobachtungen und Erfahrungen in der Zelle und beim Arbeitseinsatz schriftlich festzuhalten. Von diesem 1999 im Aufbau Verlag erschienenen Tagebuch unterscheidet sich grundsätzlich das von 1944. Nicht die Qualen des Lebens in der Anstalt sind der Gegenstand der Berichte, sondern die Erfahrungen des Schriftstellers in der Hitlerdiktatur.
Daraus hätte ein eindringliches selbstbiographisches Dokument werden können. Aber es ist hier wie in allen Fällen, wo die Absicht der Selbstrechtfertigung Tatsachen zwar nicht leugnet, wohl aber verbiegt. Halten wir uns zunächst an die Vorzüge des Tagebuchs. Es zeigt an Beispielen eigener Erlebnisse, mit welcher Rüpelhaftigkeit und Rücksichtslosigkeit schon bald nach der "Machtergreifung" Hitlers Organe der Partei und der SA Hetzjagden beginnen und alle geltenden Rechte außer Kraft setzen. Versiert erzählt sind die anekdotischen Geschichten von seinem Verleger, dem genialen Tausendsassa Ernst Rowohlt, und die Beispielfälle von Peter Suhrkamps Willensstärke und Hilfsbereitschaft. Ein wundersamer Traum aus der Zeit des Luftkriegs, vom völlig autarken Leben in einem Luftschutzraum, einem wahren unterirdischen Palast, offenbart, wie viel Poesie dieser von den Furien seiner Psyche und seiner Süchte gejagte Schriftsteller auch im Repertoire hatte. Oft aber kann man zwischen den Zeilen die ungewollte Selbstenthüllung dessen mitlesen, der seine Fahne notfalls auch nach dem Wind hängt, die versteckte üble Nachrede nicht scheut und die Rhetorik des Anwalts seiner selbst beherrscht.
So passt die Gebärde des hasserfüllten Nazigegners nicht zur Bereitschaft, auf Goebbels' Wunsch die Vorlage für einen Film zu schreiben, in dem Emil Jannings einen Volkshelden spielen sollte, einen Droschkenkutscher, der zum Zeugen nationalen Wandels und nationaler Größe wird. Das Unternehmen zerschlug sich, übrig blieb damals der erbötige Roman "Der eiserne Gustav". So wird die anfänglich achtungsvolle Schilderung der harten Lebensschule Peter Suhrkamps entwertet durch die bereitwillige Wiedergabe von Gerüchten, er habe nach der Entmächtigung des jüdischen Verlegers Samuel Fischer in erbschleicherischer Absicht mit den Nazis paktiert - was sicher nicht dazu geführt hätte, dass Suhrkamps Gesundheit im Konzentrationslager ruiniert wurde, wie es tatsächlich geschah. Noch ärgerlicher sind die gewundenen Begründungen Falladas für sein Verbleiben im Lande, trotz aller Schikanen, für seine Treue zum deutschen Volk. Mit seinen verbrämten Nadelstichen gegen Schriftsteller im "sicheren Exil" schwenkte er ganz auf die Argumentationslinie von Wortführern der "inneren Emigration" ein, die nach dem Krieg manchem Verbannten die Rückkehr verleideten.
Stark ist dieses Tagebuch dort, wo Fallada in bewährter Weise Geschichten erzählt und der Leser nicht mehr fragt, wo der Lebensbericht in die Erfindung übergeht - er nimmt das Buch wie ein Stück fiktionalisierter Zeitgeschichte. Sobald aber Urteile über bekannte Personen des literarischen Lebens gefällt werden, endet die Freiheit der Fiktion. In seinen besten Romanen ein unbestechlicher Erzähler, bleibt Fallada in diesem Tagebuch ein unsicherer Kantonist.
WALTER HINCK
Hans Fallada: "In meinem fremden Land". Gefängnistagebuch 1944. Hrsg. von Jenny Williams und Sabine Lange. Aufbau Verlag, Berlin 2009. 333 S., geb., 24,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

„In meinem fremden Land”: Hans Falladas verstörendes Gefängnistagebuch aus dem Jahr 1944
Ein irritierender Text ist das, ein autobiographisches Dokument, schwankend zwischen Selbstekel und Selbstzweifel, Selbstmitleid und Selbsthass, emotional, ungerecht, kaum analytisch, auf der Suche nach Legitimation für die eigene sogenannte „innere Emigration”. Seine Erfahrungen mit der Brutalität und zunehmenden Misere des „Dritten Reichs” will Hans Fallada nicht nur schildern, sondern er will schonungslos abrechnen: „Noch heute nach elf Jahren habe ich mich nicht an diese braunen Uniformen und an die Bulldoggenschnauzen ihrer Träger gewöhnen können. Sie zerstören jeden Menschen – und mit den Puppen, die dann zurückbleiben, haben sie leichtes Spiel.”
Aber der große Abscheu gegenüber den Nazis ist nur die eine Seite. Denn der Autor Fallada verhielt sich eben auch opportunistisch, verstrickte sich kleinmütig und erpressbar in den Netzen des Propagandaministeriums oder wechselte zwischen kleinkarierter Streiterei und furchtsamem Wegducken vor Nazibürgermeistern. Er verhielt sich eben wie der größte Teil der Deutschen, in seinen Worten: „Ich habe das Leben wie alle gelebt, das Leben der kleinen Leute.” Auch das kann man in diesem manchmal in seiner Mischung aus Verblendung, Klarsichtigkeit, Empörung und Weinerlichkeit verstörenden Tagebuch lesen.
Schäbige Kompromisse
Hans Fallada, als Rudolf Ditzen 1893 in Greifswald geboren und 1947 in Berlin gestorben, Erfolgsschriftsteller der Neuen Sachlichkeit Ende der zwanziger Jahre und Anfang der dreißiger Jahre („Kleiner Mann – was nun?”), drogen- und alkoholsüchtig seit frühen Tagen, in jungen Jahren deshalb als Buchhalter auch mehrfach straffällig geworden wegen Beschaffungsunterschlagungen, schrieb dieses in jeder Hinsicht eindringliche Tagebuch, als er 1944 in die Heil- und Pflegeanstalt Neustrelitz-Strelitz eingewiesen worden war, nachdem er im Streit mit seiner gerade von ihm geschiedenen Frau in den Tisch geschossen hatte und daraufhin festgenommen worden war.
Zu dieser Zeit waren Falladas Lebensumstände ziemlich zerrüttet. Nicht nur die langjährige Ehe mit Anna Ditzen zerfiel, auch seine Schriftstellerei schien am Ende. Die Drangsale der NS-Herrschaft bis in ein so kleines Dorf hinein wie Carwitz, wo Fallada wohnte, die kleinkarierten Zänkereien mit Ämtern und Nachbarn, hinter denen immer Denunziation, Festnahme und Schlimmeres lauerten, der Verlust seines Verlages, nachdem Rowohlt verboten worden war – all das und das Gefühl, sich, wie zurückgezogen auch immer, doch zu beschmutzen mit schäbigen Kompromissen, prägten die letzten Lebensjahre des Schriftstellers.
Doch die Monate in der Neustrelitzer Anstalt, zusammengesperrt mit Sittlichkeitsverbrechern und unzurechnungsfähigen Gewalttätern, nutzte Fallada, um sich durchs Schreiben gleichsam aus dem eigenen Sumpf herauszuziehen. Hier entstand der Roman „Der Trinker” und eben dieses Tagebuch, das er in winziger Schrift zwischen die Zeilen des Romans schrieb, dabei die raren Blätter, die ihm die Anstalt gewährt hatte, immer wieder wendend und drehend und auch noch zwischen Sütterlin- und lateinischen Buchstaben wechselnd. So entstand ein Schriftbild, als seien Ameisen dichtgedrängt übers Papier gelaufen. Den Herausgeberinnen Jenny Williams und Sabine Lange sind die Entzifferung und der unbedingt notwendige Aufschlüsselungsapparat sowie ein gewissenhaft die inhaltliche Problematik umreißendes und den Text richtig einschätzendes Nachwort zu danken.
Am Ende seiner Haft gelang es Fallada, diesen brisanten, für ihn bei Entdeckung durch die Schergen durchaus lebensgefährlichen Text aus dem Gefängnis zu schmuggeln. Später, einen Tag nach Kriegsende, am 9. Mai 1945, begann er, ihn als Typoskript abzuschreiben und zu bearbeiten mit dem Ziel, seinen Nazihass besonders zu verdeutlichen. „Diese Erinnerungen”, heißt es im Prolog des Typoskripts, „die beweisen, dass alles was Hitler tat, das Grosse wie das Kleine, schlecht war, möchten dazu ein Teil beitragen”, dass „es nie wieder etwas Ähnliches wie den Nazismus geben” darf.
Doch solche gutgemeinten Absichten gibt es im Originaltagebuch nicht, sie würden auch die Lektüre nicht sehr lohnen. Es sind im Gegenteil jene Stellen der Finsternis, an denen Fallada die fatale Mischung aus Selbstmitleid, Vorurteilen und vermeintlicher Ahnungslosigkeit, die so typisch für den Tonfall im Nachkriegsdeutschland ist, wenn über die Hitlerzeit gesprochen wurde, naiv und nahezu unkontrolliert hinschreibt oder sogar schriftstellerisch auslebt.
So gibt es offen antisemitische Äußerungen, wenn er betont, dass die Juden „selbst die Schranke zwischen sich und den anderen Völkern errichtet” hätten und „eine andere Einstellung zum Geld hatten wie ich”. Oder er erzählt von jenem vielgeliebten, unbestechlichen jüdischen Lektor Paul Mayer im Rowohlt Verlag, der sich nach 1933 plötzlich mit dem ihm bis dahin verhassten Volontär Leopold Ullstein zusammentat: „Immer hatten sie etwas zu bereden, und wenn einer von uns andern ins Zimmer kam, so schwiegen sie.” Dann kommen Sätze, die zeigen, wie widerstandslos Fallada den alltäglichen antisemitischen Ressentiments bis zur absurden Verdrehung der Tatsachen hin folgt: „Sie waren die Juden, und wir waren die Gojim, sie gehörten zusammen, und wir waren die Außenseiter. In jenen Wochen begriff ich, daß dem Juden in der Stunde der Gefahr der gegensätzlichste, der schwierigste Jude näher stand als sein getreuester Freund von anderem Blut.” Im späteren Typoskript wird dergleichen natürlich abgeschwächt und revidiert, sicher auch unter dem Eindruck der Berichte über KZ und Holocaust.
Reichstagsbrand als Happening
Eine andere makabre Facette des Tagebuchs stellen jene Passagen dar, in denen Fallada ins Fabulieren gerät. Es beginnt mit einer Kneipenszene, in der er Ernst Rowohlt ein Denkmal setzt als vitalem Literatur- und Lustmenschen. Doch es ist der Tag des Reichtagsbrandes. Das Ereignis wird für die Literaten zu einer Art Happening. Das Porträt des Verlegers Peter Suhrkamp wächst sich in Falladas Text zur infamen Verleumdungsnovelle aus, indem er das damals von manchen aufgebrachte üble Gerücht von Suhrkamp als „Erbschleicher” des S. Fischer-Verlages zur bösen Charakterstudie aufbläst.
Neben solchen Abgründen, zu denen auch die hässlichen Attacken gegen die Emigranten in ihrem falschen Glück gehören, während er doch lieber mit seinem „unselig-seligen” deutschen Volk untergehen wollte, gibt es am Ende allerdings auch eine Vision wie von der erdabgewandten Seite des Mondes: Hans Fallada träumt sich eine Privatwelt unter der Erde, in der er und seine Familie das „tausendjährige Reich” überleben. Doch als sie wieder ans Tageslicht treten, fragen die neuen Menschen bitter: „Begrabenes Leben. Wie konntet ihr das tun? Wie konntet ihr euren Kindern das antun?” Der Wahnwitz dieser Imagination ehrt den Autor, weil sie unverhohlen Angst, Verzweiflung, Ohnmacht, Fluchtwunsch und Vergeblichkeit, der eigenen Geschichte zu entkommen, in einem Bild absoluter Ausweglosigkeit beschwört.
HARALD EGGEBRECHT
HANS FALLADA: In meinem fremden Land. Gefängnistagebuch 1944. Herausgegeben von Jenny Williams und Sabine Lange. Aufbau Verlag, Berlin 2009. 333 Seiten, 24,95 Euro.
Der Schriftsteller Hans Fallada – oben ein Foto von 1943 – schrieb in der Strelitzer Anstalt winzige Mikrogramme, um Papier zu sparen – hier ein Ausschnitt von der Seite, auf der im Manuskript des Romans „Der Trinker” das Gefängnistagebuch beginnt. Fotos: SZ-Photo, Akademie der Künste Berlin
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.sz-content.de
Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension
Rezensentin Katrin Hillgruber zeigt sich alles in allem beeindruckt von dieser "authentischen Analyse" der NS-Herrschaft, die der Schriftsteller Hans Fallada heimlich in Form eines Gefängnistagebuchs niederschrieb. Nach einem Angriff auf seine Frau war er, der schon so oft in Kliniken und Heilanstalten eingeliefert werden musste, 1944 inhaftiert worden. Zwar waren seine Ansichten bisweilen sehr fragwürdig, so bezeichnet die Rezensentin etwa seine antisemitische Haltung mitfühlend als "vom Zeitgeist affiziert", auch nennt sie ihn einen Regimekritiker. Trotzdem enthält das Tagebuch genug "schreckliche und komische Momente", um die Lektüre lohnenswert und zu einem eindrücklichen und stimmigen "Sittengemälde" zu machen. Besonders gut gefallen Hillgruber Falladas "zutiefst menschliche Spontaneität", seine Spottlust und auch gegen die "maliziöse Fantasie", mit der er über Peter Suhrkamp herzieht, hat sie letztlich nichts einzuwenden.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH